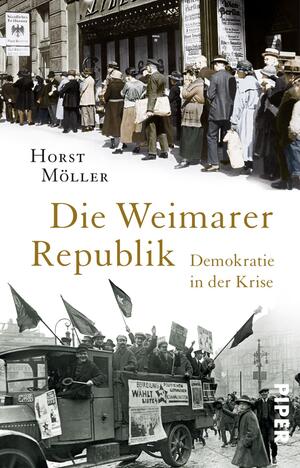
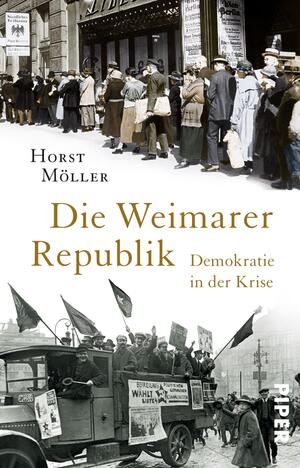
Die Weimarer Republik Die Weimarer Republik - eBook-Ausgabe
Demokratie in der Krise
Die Weimarer Republik — Inhalt
Die erste deutsche Republik, 1918 nach dem Ende des Ersten Weltkrieges ausgerufen, stand von Beginn an unter keinem guten Stern. Die Erfahrung der Niederlage und die harten Bestimmungen des Versailler Friedensvertrages waren eine schwere Hypothek. Links- wie rechtsradikale Strömungen untergruben das Vertrauen in den demokratischen Staat ebenso wie Inflation und Arbeitslosigkeit. Anschaulich schildert Horst Möller Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur der Weimarer Republik. Er zeigt, dass die Erwartungen an den neuen Staat wohl zu hochgesteckt waren, die junge Demokratie jedoch erheblich mehr leistete, als unter den extremen Bedingungen der Zeit zu erwarten war. Für die Neuveröffentlichung wurde dieses Standardwerk komplett überarbeitet, deutlich erweitert und spiegelt den aktuellen Stand der Forschung wider.
Leseprobe zu „Die Weimarer Republik“
Das Thema
„Wir haben den Krieg verloren. Diese Tatsache ist keine Folge der Revolution.“ Kein Zweifel, diese Feststellungen des Volksbeauftragten Friedrich Ebert in der Eröffnungssitzung der Nationalversammlung am 6. Februar 1919 trafen zu. Kein Zweifel aber auch, dass ein erheblicher Teil des deutschen Volkes nicht bereit war, diese Tatsachen anzuerkennen. „Sehr wahr! links. – Lebhafter Widerspruch rechts“ – die Protokollnotiz charakterisiert die Situation, die Fronten waren klar. Die Republik aber war, ob sie wollte oder nicht, aus Kriegsniederlage und [...]
Das Thema
„Wir haben den Krieg verloren. Diese Tatsache ist keine Folge der Revolution.“ Kein Zweifel, diese Feststellungen des Volksbeauftragten Friedrich Ebert in der Eröffnungssitzung der Nationalversammlung am 6. Februar 1919 trafen zu. Kein Zweifel aber auch, dass ein erheblicher Teil des deutschen Volkes nicht bereit war, diese Tatsachen anzuerkennen. „Sehr wahr! links. – Lebhafter Widerspruch rechts“ – die Protokollnotiz charakterisiert die Situation, die Fronten waren klar. Die Republik aber war, ob sie wollte oder nicht, aus Kriegsniederlage und Revolution geboren, diese Erbschaft konnte sie nicht ausschlagen.
Schon der Versammlungsort der am 19. Januar 1919 nach allgemeinem, gleichem und geheimem Wahlrecht gewählten Verfassunggebenden Nationalversammlung ist symbolisch: das Nationaltheater im idyllischen thüringischen Städtchen Weimar, untrennbar verbunden mit einem Höhepunkt deutscher Kultur. Hier hatte deutscher Geist sich am weitesten über das Elend deutscher Politik erhoben.
Weimar – nicht Berlin: Gewiss war es kein Zeichen von Stärke, die Verfassungsberatungen aus der revolutionär erregten Millionenstadt, der preußischen Reichshauptstadt, dem Sitz von Reichstag, Reichsregierung und Staatenausschuss, in die Provinz zu verlegen. Auch noch im Januar 1919 standen alle genannten Institutionen zur Disposition, die während trüber Novembertage 1918 spontan aufflammende Revolution war noch nicht beendet. Zwar waren ihre Weichen in Richtung auf eine demokratische Republik gestellt, doch war diese Weichenstellung links wie rechts umstritten, die Nation zerrissener denn je. Die Reichshauptstadt war voller ausgemergelter, verstümmelter Soldaten, ein Millionenheer von Hungernden, Arbeitslosen, Unzufriedenen bevölkerte die deutschen Städte.
Welch ein Gegensatz zu jenen fieberheißen Augusttagen des Jahres 1914, als das deutsche Volk sich einig wie nie im Taumel der Kriegsbegeisterung verlor! Nur wenige standen damals abseits, Linke zumeist, Pazifisten allemal. „Ich kenne keine Partei mehr, ich kenne nur Deutsche!“, hatte der preußische König und deutsche Kaiser Wilhelm II. damals ausgerufen, und alle kamen, auch die als „vaterlandslose Gesellen“ diskriminierten Sozialdemokraten. Auch sie waren wie die meisten Deutschen überzeugt, es handele sich um einen Deutschland aufgezwungenen Verteidigungskrieg und stimmten am 4. August 1914 im Reichstag geschlossen für die Bewilligung der Kriegskredite, bis es seit 1915 über diese Frage zu einer Spaltung der SPD-Reichstagsfraktion kam und nur noch der Mehrheitsflügel bei dieser Linie blieb. Tatsächlich aber ging es im August 1914 führenden Staatsmännern und politisch einflussreichen Gruppen keineswegs nur um Verteidigung, sondern um zum Teil weitreichende Kriegsziele, die in den Kontext des europäischen Vorkriegsimperialismus und des Hegemonialstrebens des Deutschen Reiches gehören: Doch blieb diese Erkenntnis auch nach Ende des Krieges den Deutschen noch weitgehend verschlossen. Darum war die Empörung über den Kriegsschuldartikel des Versailler Friedensvertrages, der Deutschland die Alleinschuld am Weltkrieg zumaß, so groß.
Die vom 6. Februar 1919 bis zum 21. Mai 1920 tagende Weimarer Nationalversammlung stand von Beginn an vor der Notwendigkeit, mit Problemen der jüngsten deutschen Vergangenheit fertigzuwerden. Zu ihren Hauptaufgaben zählte nicht nur Beratung und Beschluss einer neuen Verfassung, sondern auch die Ratifizierung des dem Deutschen Reich von den Siegern aufgezwungenen Friedensvertrages von Versailles, der umfangreiche Gebietsabtretungen, finanzielle Reparationsleistungen sowie eine Reihe völkerrechtlicher Diskriminierungen enthielt.
Die Weimarer Republik ist bis zu ihrem Ende mit der Abtragung dieser existenzbedrohenden kriegsbedingten Hypotheken beschäftigt gewesen. Die Geschichte der Weimarer Republik könnte also ausschließlich unter dem Aspekt ihrer Vorbelastungen und Schwäche geschrieben werden. Aber ist eine so verengte Optik historisch angemessen, ist sie gerecht? Oder sollte nicht vielmehr auch die Leistung dieses Staates, der erste Versuch einer deutschen Demokratiegründung unter denkbar ungünstigen Umständen gewürdigt werden? Kein Zweifel, die Chancen der demokratischen Republik waren von Beginn an gering, doch war sie nicht zwangsläufig zum Scheitern verurteilt.
Die Geschichte von Weimar ist ein Thema, welches ohne das Wissen der Nachlebenden vom Scheitern dieser Republik zwischen Monarchie und nationalsozialistischer Diktatur und um die Folgen dieses Scheiterns nicht darstellbar ist. Sie ist also auch ein Lehrstück deutscher Zeitgeschichte, ein Lehrstück politischer Bildung von ungebrochener Aktualität über Möglichkeit und Gefährdung einer Demokratie. Von melancholisch stimmender Ambivalenz ist die Geschichte der Republik beherrscht. Und so stehen im Mittelpunkt der folgenden Darstellung Entstehung und Bewährungsproben des verfassungspolitischen Systems im Zusammenhang von Gesellschaft, Wirtschaft, Außenpolitik und Kultur in der Kernzeit der Republik von 1919 bis 1930 sowie ihre Auflösung 1930 bis 1933.
I. Zwei Reichspräsidenten – Chance und Scheitern
Zwei Reichspräsidenten hatte die Republik, Friedrich Ebert und Paul von Beneckendorff und von Hindenburg. Verkörpert der eine die Chance der Republik, so der andere ihr Scheitern.
Friedrich Ebert – Sozialdemokrat in Kaiserreich, Revolution und Republik
Als Sohn eines Schneidermeisters wurde Friedrich Ebert im Jahr der Bismarck’schen Reichsgründung 1871 geboren. Er entstammte einer konfessionell gemischten Ehe, wurde aber katholisch erzogen. Der junge Ebert lernte das Sattlerhandwerk, ließ sich nach Wanderjahren 1891 in der Hansestadt Bremen nieder und wurde Gastwirt. Seit 1893 stand er in den Diensten der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands: als Arbeitersekretär, Redakteur und schließlich als Sekretär des Parteivorstands der SPD. Wegen dieses Amtes übersiedelte er 1905 in die Reichshauptstadt und widmete sich ausschließlich der Parteiarbeit.
Eberts intensive Beratung von Arbeitern, beispielsweise in Fragen der Sozialversicherung, provozierte immer wieder den Unmut seiner Arbeitgeber. Entlassung folgte auf Entlassung. Aber auch in seinen unsteten frühen Jahren war Ebert kaum zu irritieren – er wollte den Menschen helfen, und er half ihnen, ganz gleich, welche Widerstände er damit heraufbeschwor. Sein ständiger Stellenwechsel war also keineswegs Folge eines unruhigen, vagabundierenden Charakters. Vielmehr hatte er während seiner Sattlerlehre Ungerechtigkeit im Arbeitsleben erfahren, und von da an kämpfte er für die Rechte der Arbeiter. Das war zunächst noch nicht Parteiarbeit, sondern Gewerkschaftsarbeit, die ihn nicht wenige materielle Opfer kostete; oft genug stand er beruflich vor dem Nichts. Erst als Redakteur der Bremer Bürgerzeitung, wie paradoxerweise die Zeitung der Bremer Sozialdemokraten hieß, gewann er, nach dem Fehlschlag einer von ihm organisierten Genossenschaftsbäckerei, Boden unter den Füßen; endlich konnte er seine sozialpolitische Arbeit verbinden mit dem Erwerb des Lebensunterhalts. Nun erhielt er 25 Mark Wochenlohn, aber das reichte nicht aus zu wirtschaftlicher Selbstständigkeit, zur Gründung einer Familie. Und so wurde Friedrich Ebert auf Drängen seiner künftigen Frau Luise Rump – die Hochzeit fand am 9. Mai 1894 statt – Gastwirt.
Das war ein Beruf, der ihm eigentlich nicht besonders lag, hatte er doch keine Neigung, mit seinen Gästen zu trinken, kaum Neigung auch zu zwang- und zweckloser Geselligkeit. Trotzdem wurde seine Gastwirtschaft in Bremen bald zu einem Zentrum sozialpolitischer Arbeit für Gewerkschaft und Partei. Bei sozialdemokratischen Arbeitern sprach es sich schnell herum, dass der Wirt ein stets hilfsbereiter und rechtskundiger Berater seiner Gäste war. Ohne diese Bezeichnung zu führen, entstand hier eine Art „Arbeitersekretariat“ – ein Indiz für den praktischen Sinn Eberts und seine Neigung zur Organisierung von Selbsthilfe für die Arbeiter. Eine solche Tätigkeit interessierte ihn schon damals mehr als marxistische Theorie. Zwar hatte auch er, wie viele aufstrebende junge Parteigenossen, seinen Karl Marx gelesen, bildungsbeflissen dessen schwieriges Hauptwerk Das Kapital durchgearbeitet, aber zum Marxisten in streng ideologischem Sinn war er dadurch kaum geworden. Schließlich war für die konkrete, hier und heute zu leistende Gewerkschaftsarbeit, um die es ihm zu tun war, mit dem nationalökonomisch-philosophischen Buch auch nicht viel anzufangen. Der gedrungen wirkende, kräftig gebaute kurznackige Mann mit dem mächtigen Kopf stand eben mit beiden Beinen auf der Erde.
Und das blieb auch so, als er allmählich über seinen sozialpolitischen Wirkungskreis hinauswuchs und erst zu lokaler, dann zu überregionaler politischer Tätigkeit gelangte. Nie hat er sich durch aufdringlichen Ehrgeiz hervorgetan. Friedrich Ebert war ein Mann, der unter keinem erkennbaren, durch kleinbürgerliche Herkunft bedingten Aufstiegstrauma litt, obwohl ihm die ersehnte Gymnasial- und Universitätsbildung verschlossen geblieben war; ein Mann, der sich in ungezählten Stunden autodidaktisch das notwendige Wissen erarbeitet hatte und dessen politisches Augenmaß zweifellos dem der meisten seiner akademisch gebildeten Zeitgenossen weit überlegen war; ein Mann schließlich, dem für seine Überzeugungen kein persönliches Opfer zu groß war, der Mut und Verantwortungsbereitschaft besaß und all seine hohen Ämter mit natürlicher Würde und mit Takt ausübte.
Parlamentarische Erfahrung hatte er bereits seit 1900 als Mitglied der Bremer Bürgerschaft gesammelt, bevor er beim großen Wahlerfolg seiner Partei im Jahre 1912 in den Reichstag einzog. Damals hatte die SPD trotz der ungerechten und sie benachteiligenden Wahlkreiseinteilung 27,7 Prozent der Mandate erreicht und war damit zur weitaus stärksten Partei geworden: wegen des konstitutionellen Regierungssystems und der Parteienkonstellation im Reichstag half ihr das jedoch nicht. Doch stärkte der gegenüber der vorhergehenden Reichstagswahl von 1907 erzielte extreme Zugewinn von 16,9 Prozent bei Ebert und seinen Freunden die Überzeugung, die Partei werde früher oder später auf evolutionär-parlamentarischem Wege ihre Ziele erreichen, zumal wenn es ihr gelänge, das Wahlsystem zu reformieren. Verhältniswahlsystem zur echten Repräsentation des Volkswillens wurde so zu einem Credo der Partei – aus Überzeugung und aus politischem Interesse .
Als Gegner der Parteilinken, die zum Teil Anhänger des politischen Massenstreiks waren, wurde Friedrich Ebert einer der beiden Nachfolger des schon legendären Parteivorsitzenden August Bebel. Ebert, ein ausgleichender und undoktrinärer Kopf, wurde neben dem intellektuelleren, eher zum linken Parteiflügel tendierenden Rechtsanwalt Hugo Haase 1913 auf dem Parteitag der SPD in Jena zum Mitvorsitzenden gewählt. Haase erhielt von 473 abgegebenen Delegiertenstimmen 467, Ebert 433 .
Nach dem sich 1915/16 verschärfenden Dissens innerhalb der SPD-Fraktion über die Bewilligung der Kriegskredite, gegen die der Minderheitenflügel um den Partei- und Fraktionsvorsitzenden Hugo Haase gestimmt hatte, wurde Ebert am 11. Januar 1916 als Haases Nachfolger zu einem der drei Fraktionsvorsitzenden gewählt; am 14. Juni 1918 schließlich wurde er Vorsitzender des Hauptausschusses des Reichstags, der Nationalliberale Gustav Stresemann sein Stellvertreter. In das Oktoberkabinett des Prinzen Max von Baden 1918 war Ebert selbst nicht eingetreten, hatte aber die Regierungsbeteiligung in einer großen Reichstagsrede vom 22. Oktober begründet: „Es wäre für uns gewiß bequemer gewesen, draußen zu stehen und unsere Hände in Unschuld zu waschen … Wir sind in die Regierung hineingegangen, weil es heute um das ganze deutsche Volk, um seine Zukunft, um Sein oder Nichtsein geht … Wir wissen, was wir mit unserem Schritt gewagt haben.“
Der erfahrene Parlamentarier und Parteifunktionär wusste nur zu gut, welches Erbe die Sozialdemokraten anzutreten sich anschickten, hatte er doch seine Rede mit dem Hinweis darauf begonnen, eine nüchterne Prüfung der militärischen und politischen Lage müsse die neue Regierung dazu führen, ein Waffenstillstandsgesuch abzusenden, hatte er doch bereits hier prophylaktisch die „demagogische Verlogenheit“ zurückgewiesen, dass die Demokratie auf Kosten deutscher Interessen zur Macht gelange .
Dies war Eberts letzte Rede im alten, 1912 gewählten Reichstag des Kaiserreichs. In ihr skizzierte Ebert sowohl die künftige Situation Deutschlands im internationalen Kräftefeld angesichts der unabwendbaren Niederlage als auch die innenpolitische Perspektive nach dem bevorstehenden Kriegsende. Von den „englischen und französischen Chauvinisten und Imperialisten“ erwartete er nichts Gutes, umso mehr versuchte er den amerikanischen Präsidenten Wilson unter Berufung auf dessen 14-Punkte-Programm auf einen gerechten Frieden ohne Demütigung des niedergerungenen Gegners zu verpflichten; Ebert vermied in seiner Rede das Wort „Feind“. Er appellierte an Wilson, für einen Frieden einzutreten, der „keinen Rachegeist, keinen Revanchegedanken zurückläßt“. Ebert schlug einen Völkerbund vor, der notfalls mit Machtmitteln garantiere, dass „an Stelle der Gewalt das Recht“ ins Völkerleben trete. Er bedauerte, dass die Deutschen während des Krieges das Selbstbestimmungsrecht anderer Völker angetastet hatten, und bemängelte, dass die Demokratie in Deutschland erst in dem Augenblick realisiert werde, in dem sich der „militärische Vorteil auf Seiten unserer Gegner“ zeige.
Die mit der Oktoberregierung des Prinzen Max eingeleitete Entwicklung sah Ebert als Wendepunkt in der deutschen Geschichte: „Es ist der Geburtstag der deutschen Demokratie … Im alten Deutschland waren ganze Klassen, Nationen und Konfessionen von der schaffenden Mitwirkung im Staate nahezu vollständig ausgeschlossen … Für Volk und Reich ist die Demokratisierung zur Lebensnotwendigkeit geworden. Hier gilt das bekannte Wort: Wenn die Völker fortschreiten und die Verfassungen stillstehen, kommen die Revolutionen. Die besitzenden Klassen Deutschlands können froh sein, wenn der deutsche Volksstaat sich im Wege der politischen Entwicklung durchsetzt. Blicken Sie nach Rußland, und Sie sind gewarnt!“
Der Kernpunkt des von Ebert so bezeichneten „Systemwechsels von großer Tragweite“ lag in der Institutionalisierung des Prinzips der Volkssouveränität. Die Parlamentarisierung der Reichsleitung, die mit der neuen Regierungsbildung faktisch, wenngleich noch nicht staatsrechtlich akzeptiert worden war, bedeutete für Ebert den ersten Schritt in Richtung auf eine Staatsform, in der „das Volk durch seine frei gewählten Vertreter seine Zukunft gestalten“ sollte.
Von Sozialismus war in dieser Rede Eberts wenig zu spüren; zwar ließ er das sozialdemokratische Fernziel einer „Aufhebung der Klassengegensätze“ und der „Beseitigung der wirtschaftlichen Ausbeutung“ anklingen, sah aber als Nahziel eine Demokratisierung der Verfassung im Rahmen der „bestehenden Wirtschaftsordnung“ an.
Auch die von ihm anvisierten Verfassungsänderungen erwuchsen aus der politischen Erfahrung der letzten Jahre, nicht einer Reißbrettkonstruktion. Er prangerte das „persönliche Regiment“ des Monarchen ebenso an wie die „ganz absolutistische Stellung des Großen Generalstabs, der verfassungsmäßig weder dem Reichskanzler noch dem Reichstage verantwortlich ist“. Zweifellos traf er damit einen neuralgischen Punkt der unter dem Einfluss des Krieges modifizierten Reichsverfassung. Ebert verlangte eine umfassende Verantwortlichkeit des Reichskanzlers und der Reichsminister gegenüber dem Reichstag und eine Unterordnung der militärischen Führung unter die politische. Der Frage der Demokratisierung von Wahlrecht und Regierungssystem Preußens widmete Ebert besondere Aufmerksamkeit. Auffällig ist, wie eindeutig er Preußen von der heftig kritisierten preußischen Führungsschicht trennte und die Überlebensfähigkeit des deutschen Hegemonialstaats von seinem Modernisierungspotenzial abhängig sah.
Eberts Reichstagsrede ließ analytischen Scharfsinn und programmatischen Anspruch erkennen, sie bestach nicht durch Rhetorik, sondern durch Augenmaß und Nüchternheit. Sie enthielt scharfe Kritik, riss aber für Einsichtige und Reformwillige keine unüberwindlichen Gräben auf, da er bei aller Härte in der Sache moderat im Ton blieb, die Rede eines Mannes – auch das muss hier gesagt werden –, den der Krieg schreckliche Opfer gekostet hatte: Zwei seiner Söhne starben auf dem Schlachtfeld. Trotzdem ließ er sich durch persönlichen Schmerz nicht zum unversöhnlichen Hass gegenüber denjenigen hinreißen, die zweifelsfrei Mitverantwortung an diesem Krieg trugen. Ein Mann, für den patriotische Loyalität keine Phrase war, ein Mann, der Phrasen nicht mochte. Er mochte auch keine Demagogie, so wenig er die Unordnung vertrug, in der sie am besten gedeiht. Zur sozialen Demokratie, aber in geordneten Reihen – so lautete sein Programm.
Was eigentlich hätte den Deutschen in diesen verwirrten, aufgeregten Zeitläufen von Kriegsniederlage und Revolution Besseres widerfahren können als dieser Friedrich Ebert? Haben die Deutschen gewusst, welches Kapital ein solch besonnener Mann mit klarem Blick für das Notwendige und Sinn für das Machbare bedeutete? Vieles, allzu vieles spricht dafür, dass nur eine Minderheit dies erkannt hat. Theodor Heuss sagte in einer Gedenkrede über Eberts Tod: „Als vor einem Vierteljahrhundert der vierundfünfzigjährige Mann starb, da spürte die Nation in einem jähen Erschrecken, mancher auch in Scham, was die Nation an ihm besessen hatte, um freilich diese Einsicht bald genug wieder zu vergessen. Es soll und darf nicht vergessen werden.“
Was hatte eine große Zahl von Deutschen gegen diesen Friedrich Ebert einzuwenden? „Der akademischen Weihe nicht teilhaftig, die auch im kaiserlichen Deutschland die Tore in die obere Gesellschaft öffnete, konnte … Ebert nicht mehr als ein einzelner emporsteigen, sondern nur noch in seiner Klasse und durch seine Klasse“, bemerkte ein Ebert-Biograf . Und hier liegt wohl ein Schlüssel zum Verständnis für das Verhältnis der Deutschen zu ihrem ersten Reichspräsidenten. Wäre sein Aufstieg über die üblichen Wege erfolgt, die in der Gesellschaft des Kaiserreichs möglich waren, weil sie innerhalb derjenigen gesellschaftlichen Normen verliefen, die die soziale Herkunft sekundär werden ließen, etwa über die akademische Bildung, wäre wohl auch ein Friedrich Ebert akzeptiert worden, wie Gustav Stresemann akzeptiert wurde. Allerdings hätte dies eine politische Orientierung im Rahmen des konservativ-liberalen Parteienspektrums vorausgesetzt. Ebert aber war in den Augen der Gesellschaft nicht als Individuum, sondern als Typus emporgekommen, über Partei und Gewerkschaft. Er war Exponent sozialer Schichten und politischer Organisationsformen, die im Kaiserreich nichts galten oder doch Außenseiter blieben.
Beständig und willensstark wie Ebert war, konnte es kaum zweifelhaft sein, welchen Kurs der geschickte Taktierer steuern würde, als er seit dem 9. November 1918 vor der Alternative stand, die Radikalisierung der Revolution zuzulassen oder auf ihre schnelle Beendigung durch Begründung einer parlamentarischen und demokratischen Republik hinzuwirken. Durch sein Handeln bezog Ebert Stellung in dem die SPD charakterisierenden Zwiespalt zwischen programmatischem Sozialismus und pragmatischem Reformismus – ohne je dieses Problem durch prinzipielle Reflexion lösen zu können oder auch nur lösen zu wollen. Man mag darin Eberts Grenze sehen, erwies sich der Parteivorsitzende doch auch hier als Praktiker und Pragmatiker. Tatsächlich hat er die Partei unbeirrt geführt, ideologisch beherrscht aber hat er sie nie. Eberts Aufstieg in der SPD stand unter dem Zeichen eines zunehmenden Widerspruchs zwischen Theorie und Praxis der Sozialdemokratie, und doch sah es so aus, als berühre ihn diese Problematik kaum, denn er war stets ein Mann der Praxis. Er teilte weder die Ängste noch die weitreichenden geschichtsphilosophisch begründeten Hoffnungen der Sozialdemokratie, hatte weder das Trauma der Bismarck’schen Sozialistengesetze noch die marxistisch gefärbten Zukunftserwartungen.
Ebert war unverkennbar ein Mann der zweiten Generation, zwar ein loyaler Mitarbeiter August Bebels, aber ideologisch bereits weit von ihm entfernt. Als der ältere Parteigenosse Hermann Molkenbuhr Ebert 1905 in sein neues Amt als Sekretär des Parteivorstands einführte, packte ihn Entsetzen, wollte der junge Mann doch allen Ernstes Schreibmaschine und Telefon anschaffen. Wusste der junge Genosse denn nichts von den Verfolgungen, an die sich ältere Parteigenossen nur zu gut erinnerten, war er nicht in der Lage, konspirativ zu denken? Nun war das am 21. Oktober 1878 erstmals erlassene Reichsgesetz „wider die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie“ nach dem 30. September 1890 nicht mehr verlängert worden – und das war immerhin eineinhalb Jahrzehnte her. Trotzdem dachte die zum Teil überalterte Parteiführung zu dieser Zeit noch kaum an aktive Einflussnahme auf die Staatsgeschäfte zum Zwecke allmählicher Demokratisierung und konnte realistischerweise auch noch nicht daran denken. Doch wurde dies immer mehr die Perspektive Eberts, wenngleich auch er sich kaum der Einsicht entziehen konnte, die SPD stehe in einem gefährdeten Abseits: Am 30. Juli 1914 beschloss der Parteivorstand, Ebert und Otto Braun mit der Parteikasse in die Schweiz zu schicken, damit die Partei, wenn sie bei Kriegsausbruch in Deutschland verboten werden sollte, aus der Emigration weitergeführt werden könnte. Die Vorsichtsmaßnahme erwies sich als überflüssig, Friedrich Ebert kehrte schon nach wenigen Tagen zurück, die SPD stimmte der Bewilligung der Kriegskredite zu.
Solche Vorsicht stammte aus historischer Erfahrung und zeigte die aus ihr resultierenden Ängste der Sozialdemokraten, zeigte auch, wie fundamental sich die Situation 1918 veränderte: Die Partei, die nahezu ein halbes Jahrhundert Oppositionspartei gewesen und zeitweilig in die Illegalität getrieben worden war, wurde nun plötzlich zur Regierungspartei – im Gefolge einer Revolution, die nicht ins theoretische Konzept passte und die man nur zögernd akzeptierte. War es verwunderlich, dass die SPD die Regierungsverantwortung während der Weimarer Republik oft nur halbherzig mittrug? Auch hier bedeutete Ebert eine Chance, zählte er doch zu den wenigen zur Regierung befähigten und die Regierungsbeteiligung der SPD bejahenden Sozialdemokraten. Zudem vermittelte er der sozialen Basis der Partei eine weite Perspektive: Er konnte die Arbeiterschaft aus dem politischen Getto führen, in dem sie seit Jahrzehnten lebte, er war ein Symbol für die Möglichkeit politischen Aufstiegs ohne Verleugnung der Herkunft.
Ebert personifizierte die von Max Weber so genannte Verantwortungsethik, er übernahm diese schwere politische Rolle, obwohl er wusste, dass sie persönlich und politisch Opfer kosten würde. Den Zwiespalt der Partei zwischen der reinen sozialistischen Lehre und praktischer, Kompromisse und Koalitionen erfordernder Politik zur Meisterung der Staatskrise musste er in seiner Person ertragen, und er ertrug ihn. Wäre er der Programmatiker gewesen, den man zuweilen an ihm vermisst, er hätte diesen Weg nicht gehen können. Sicher fehlte es ihm an Brillanz und Glanz, aber auch darin war er typisch für die Partei, die er vertrat. Tatkraft, Willensstärke, Besonnenheit, ein klares Konzept, ein Ziel – auf diese Eigenschaften kam es im Winter 1918/1919 an, und Friedrich Ebert besaß sie.
Geheimrat von Schlieben stürzte bleich ins Vorzimmer des Reichskanzlers Prinz Max von Baden: „Die Revolution marschiert. Die Massen sind von Norden her von den Borsigwerken nach dem Stadtinnern zu in Bewegung und haben soeben fast kampflos die Kaserne der Garde-Füsiliere besetzt.“ Das war um 10 Uhr 30 am 9. November 1918, einem Samstag . Pausenlos war in den letzten Tagen und Stunden beraten worden: Wie kann der Ausbruch der Revolution auch in der Reichshauptstadt vermieden werden? Die Lage war äußerst brenzlig, dieses Mal würde es so glimpflich nicht abgehen wie beim politischen Massenstreik Ende Januar/Anfang Februar 1918, an dem zwar in Berlin rund 300 000, im Ruhrgebiet rund 500 000 Arbeiter teilnahmen, der aber von der SPD nicht gewollt wurde und über dessen Form auch in der USPD Uneinigkeit bestand. Damals hatte das Streikprogramm der Berliner Arbeiterräte zwar durchgehende Demokratisierung der gesamten Staatseinrichtungen und das gleiche, direkte und geheime Wahlrecht für alle Männer und Frauen über 20 Jahre in Preußen gefordert, nicht aber die Republikanisierung oder den Thronverzicht des Kaisers. Damals waren die Sozialdemokraten Friedrich Ebert, Philipp Scheidemann und Otto Braun in die Streikleitung eingetreten, um die Führung der Massen nicht den Linksradikalen zu überlassen, obwohl sie den Massenstreik als politisches Kampfmittel ablehnten.
Nun, im November, stand alles auf dem Spiel: Das Heer der Unzufriedenen war um ein Vielfaches größer, die USPD eindeutig für die Revolution, die in mehreren Städten des Reiches bereits ausgebrochen war.
Am 30. Oktober verhinderten Matrosen das – militärisch sinnlose und ohne Absprache mit der Reichsleitung und der Obersten Heeresleitung angeordnete – Auslaufen der Hochseeflotte und setzten damit ein unübersehbares Signal. Nur wenige Tage später ergriff die Matrosenmeuterei Kiel, am 4. November war die Hafenstadt in der Hand von Arbeiter- und Soldatenräten. Am 7. November verschärften die Mehrheitssozialdemokraten, die seit dem 4. Oktober in der Reichsregierung des Prinzen Max von Baden vertreten waren, ultimativ ihre Forderung nach Thronverzicht des Kaisers. Nur so glaubte die Parteiführung um Friedrich Ebert und Philipp Scheidemann die revolutionäre Bewegung steuern zu können: Die allgemeine Stimmung im Volke sehe im Kaiser den Schuldigen, ob mit Recht oder mit Unrecht, sei jetzt gleichgültig, hatte der Parteivorsitzende Ebert am 6. November dem Vertreter der Obersten Heeresleitung, General Groener, erklärt . Am 7./8. November begann die Revolution in München, der Linkssozialist Kurt Eisner rief die Republik aus, König Ludwig III. entfloh mit unbekanntem Ziel, am 8. November unterzeichnete der Herzog von Braunschweig für sich und seine Nachkommen den Thronverzicht. Die Ereignisse überstürzten sich.
Alle dem Interfraktionellen Ausschuss des Reichstags und dem Kriegskabinett angehörenden Mitglieder der Mehrheitsparteien – Nationalliberale, Zentrum und Fortschrittliche Volkspartei – waren sich in dieser Situation mit ihren sozialdemokratischen Kollegen einig, dass weitere gravierende Verfassungsänderungen nach der am 28. Oktober erfolgten faktischen Parlamentarisierung der Reichsleitung notwendig seien. Das galt vor allem für den Hegemonialstaat Preußen, wo die seit Langem überfällige Abschaffung des Dreiklassenwahlrechts erst in letzter Minute, am 24. Oktober, die Zustimmung des Herrenhauses gefunden hatte, aber noch nicht durchgeführt worden war, da verfassungsgemäß mehrere Lesungen erfolgen mussten. Demokratisches Wahlrecht, Parlamentarisierung und Regierungsbeteiligung der SPD auch in Preußen, Verstärkung des sozialdemokratischen Einflusses in der Reichsregierung: all das wollten die übrigen Parteien der Mitte, die mit der SPD im Reichstag die Mehrheit bildeten, akzeptieren. An der „Kaiserfrage“ aber schieden sich die Geister, ungeachtet der Feststellung des Zentrumspolitikers Fehrenbach, der unter dem Eindruck des sozialdemokratischen Ultimatums am 8. November erklärte: „Ich stehe unter der Empfindung, daß wir über etwas debattieren, was um 4 Uhr vielleicht nicht mehr wichtig ist. Bis heute Nachmittag hat die Abdankung des Kaisers zu erfolgen.“
Doch erfolgte die Abdankung an diesem Freitag nicht mehr, und auch am folgenden Vormittag lag trotz ständiger Telefonate zwischen der Reichshauptstadt und dem Großen Hauptquartier im belgischen Spa, wo der Kaiser sich in diesen Tagen aufhielt, keine Abdankungserklärung vor. Den Sinn einer solchen Erklärung sahen sowohl die Reichskanzlei als auch die Parteien des Interfraktionellen Ausschusses, so weit sie sie für notwendig hielten, keineswegs in der Abschaffung der Monarchie. Vielmehr meinten sie, nur durch einen Thronverzicht Wilhelms II. die Monarchie retten zu können. Auch General Groener, der noch in seiner Besprechung mit Vertretern der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion und der Generalkommission der Gewerkschaften am 6. November in Berlin „kurz und scharf“ erklärt hatte, von einer Abdankung des Kaisers könne keine Rede sein, da man unmöglich der Armee im letzten Ringen mit dem Feind den Obersten Kriegsherrn und damit ihren „autoritativen Halt“ nehmen könne, hatte binnen weniger Tage seinen Sinn geändert: Als er am Morgen des 9. November Vortrag hielt, beendete er seinen Bericht in Übereinstimmung mit dem Chef der Obersten Heeresleitung, von Hindenburg, mit der nachdrücklichen Empfehlung sofortiger Abdankung . Die in den Noten des amerikanischen Präsidenten Wilson unverhohlen geforderte Abdankung hatte Staatssekretär Philipp Scheidemann in einem Brief an Reichskanzler Prinz Max von Baden am 29. Oktober 1918 mit der Begründung aufgenommen, „daß die Aussicht, zu erträglichen Bedingungen des Waffenstillstands und des Friedens zu gelangen, durch das Verbleiben des Kaisers in seinem hohen Amte verschlechtert wird“ . Doch noch am 1. November erklärte der Kaiser dem Staatsminister Drews, der ihm im Auftrag des Reichskanzlers eingehend und realistisch Vortrag über die militärisch und politisch aussichtslose Lage gehalten hatte: „Nun, ich will Ihnen gleich erklären: Ich danke nicht ab.“
Nach dramatischer Zuspitzung der Situation und dem sozialdemokratischen Ultimatum vom 7. November rang sich der vom Reichskanzler und schließlich auch von der Militärführung gedrängte Kaiser zu einer Bereitschaftserklärung durch, die der Reichskanzlei am 9. November gegen 14 Uhr übermittelt wurde: „Um Blutvergießen zu vermeiden, sind Seine Majestät bereit, als Deutscher Kaiser abzudanken, aber nicht als König von Preußen.“
Nicht aber als König von Preußen! 9. November, 14 Uhr: zu spät, wie alle anderen Reformversuche auch, das Deutsche Kaiserreich und das Königreich Preußen zu retten. Kein gefährlicherer Augenblick für eine schlechte Regierung als der, in dem sie sich zu reformieren beginnt, so hatte Alexis de Tocqueville über eine andere Revolution, die Französische von 1789, geurteilt . Einsicht in die militärisch ausweglose Situation, Reform der zunehmend ungerechten Wahlkreiseinteilung im Reich, Parlamentarisierung des Reiches, Wahlrechtsreform in Preußen – immer fand sich die preußische Führungsschicht erst zu Konzessionen bereit, wenn die Entwicklung nicht mehr aufzuhalten und nichts mehr zu retten war. Nichts ist symptomatischer dafür als der Kampf um die Beseitigung des Dreiklassenwahlrechts zum Preußischen Abgeordnetenhaus, für das sich die konservative Mehrheit noch bis Anfang Oktober 1918 der Unterstützung der Obersten Heeresleitung versichern wollte. Erst als diese Unterstützung aus Gründen militärpolitischen und – wie sich später zeigen sollte – weitsichtigen innenpolitischen Kalküls versagt wurde, stimmte man einer Wahlrechtsänderung zu, zu einem Zeitpunkt, als bereits Millionen deutscher Soldaten gefallen waren, als alle Einsichtigen diese Opferbereitschaft und Pflichterfüllung als Kehrseite der Gleichberechtigung in der Ausübung staatsbürgerlicher Rechte ansahen.
So bedeutend die Verdienste der adlig, militärisch, protestantisch, ostelbisch und auch etatistisch geprägten konservativen Führungsschicht in der Geschichte Preußens auch waren, so kläglich war ihr Versagen in den letzten Jahren der Monarchie, so belastend ihr allzu langer Abschied von der Macht, die sie nicht teilen wollte und die sie auch deshalb verlor. Schon die Mitbeteiligung der lange Zeit diskriminierten „Reichsfeinde“ – vor allem der Sozialdemokraten, in geringerem und sich abschwächendem Maße aber auch des katholischen Zentrums und der Fortschrittler – hätte, zur rechten Zeit, noch ausgereicht. Denn auch die Sozialdemokraten waren in ihrer Mehrheit, wie sich spätestens im August 1914 gezeigt hatte, keine unpatriotischen Revolutionäre mehr, wenn sie es je gewesen waren. So ist dem württembergischen Liberalen Conrad Haußmann, Reichstagsabgeordneten und Staatssekretär im Kriegskabinett des Prinzen Max und späteren Vorsitzenden des Verfassungsausschusses der Weimarer Nationalversammlung, zuzustimmen: „Der Geburtsfehler der Oktoberregierung war, daß sie erst Oktoberregierung war. Eine Septemberregierung und vor allem eine Märzregierung hätte noch handeln können.“
Noch einmal Samstag, 9. November 1918: Gegen 14 Uhr traf die Bereitschaftserklärung des Kaisers in Berlin ein. Was konnte sie noch bewirken? Nichts mehr. Der Reichskanzler, ein Prinz von Geblüt und alles andere als ein Revolutionär, nicht einmal ein Anhänger des Parlamentarismus, aber ein in dieser Situation einsichtiger Mann, glaubte nach der am Vormittag eingehenden Ankündigung der Erklärung nicht mehr auf ihren definitiven Wortlaut warten zu können; Reichskanzler Prinz Max von Baden hielt es für seine staatsbürgerliche Pflicht, den als feststehend mitgeteilten Entschluss des Kaisers bekannt zu geben, so lange es noch einen Sinn hatte . Konsequent ließ er über Wolffs Telegraphisches Büro gegen zwölf Uhr die seit Tagen erwartete und nun nicht mehr vermeidbare – von Geheimrat Simons formulierte – Nachricht verbreiten: „Der Kaiser und König hat sich entschlossen, dem Throne zu entsagen. Der Reichskanzler bleibt noch so lange im Amte, bis die mit der Abdankung des Kaisers, dem Thronverzicht des Kronprinzen des Deutschen Reiches und von Preußen und der Einsetzung der Regentschaft verbundenen Fragen geregelt sind. Er beabsichtigt, dem Regenten die Ernennung des Abgeordneten Ebert zum Reichskanzler und die Vorlage eines Gesetzentwurfs wegen der sofortigen Ausschreibung allgemeiner Wahlen für eine Verfassunggebende deutsche Nationalversammlung vorzuschlagen, der es obliegen würde, die künftige Staatsform des deutschen Volkes … endgültig festzustellen.“
Nicht aber als König von Preußen … Die kaiserliche Absichtserklärung war also bereits Makulatur, als sie in der Reichskanzlei einging. Die zwei Stunden früher veröffentlichte Bekanntmachung des Prinzen Max ging in allen Punkten über sie hinaus: sie kündigte den Thronverzicht nicht an, sondern erklärte ihn.
9. November 1918: Um neun Uhr hatten die mehrheitssozialdemokratischen Mitglieder des Reichskabinetts, Scheidemann und Bauer, endgültig ihren Austritt aus der Regierung erklärt, nachdem der Parteivorstand Verhandlungen mit den Unabhängigen Sozialdemokraten beschlossen hatte und die SPD unter dem Eindruck der immer mehr um sich greifenden revolutionären Massenbewegung zu dem Entschluss gelangt war, „bei einer notwendigen Aktion gemeinsam mit den Arbeitern und Soldaten vorzugehen. Die Sozialdemokratie solle dann die Regierung ergreifen, gründlich und restlos, ähnlich wie in München, aber möglichst ohne Blutvergießen.“
Aber auch der Versuch des Prinzen Max, durch eigenmächtiges Vorpreschen für die Monarchie noch zu retten, was zu retten war, erwies sich als verspätet, wurde durch Ereignisse überholt, an denen er selbst unmittelbar beteiligt war: In der sich zuspitzenden revolutionären Situation, in der der sozialdemokratische Parteivorstand sich in letzter Minute an die Spitze der Bewegung stellte, um sie steuern zu können, gelangte der Reichskanzler zu der Einsicht, dass er die Einsetzung einer Regentschaft nicht mehr abwarten könne und dem Vertreter der stärksten Partei sofort das Amt des Reichskanzlers anbieten müsse.
Ob Ebert nun lange gezögert hat oder nicht, schließlich akzeptierte er; er schätzte wie der Prinz den von solcher Amtsübergabe ausgehenden staatsrechtlichen Effekt positiv ein. Allerdings konnte es nur ein Effekt sein, staatsrechtlicher Prüfung hielt eine solche Amtsübergabe nicht stand, war doch nach der noch geltenden Reichsverfassung der amtierende Reichskanzler keineswegs befugt, sein Amt selbstständig an einen Nachfolger zu übergeben. Aber Legalitätseffekte haben manchmal größere politische Wirkung als die Legalität selbst, und politische Plausibilität besaß der Vorgang zweifellos, hatte doch die stärkste politische Partei in ihrem Ultimatum vom 7. November eine Verstärkung ihres Einflusses im Reichskabinett gefordert: nur mit ihrer Hilfe konnte eine weitere Radikalisierung der Revolution vermieden werden. Als die sozialdemokratische Deputation am 9. November um 12 Uhr 35 beim Reichskanzler erschien, erklärte denn auch Friedrich Ebert: Die Sozialdemokraten hielten es zur Wahrung von Ruhe und Ordnung und zur Vermeidung von Blutvergießen unbedingt für erforderlich, „daß die Regierungsgewalt an Männer übergehe, die das volle Vertrauen des Volkes besitzen“. Er forderte für seine Partei das Amt des Reichskanzlers und des Oberstkommandierenden in den Marken . Im weiteren Verlauf der Unterredung erklärte der Reichskanzler: „Da wir nicht die Macht in Händen haben, da die Situation so ist, und die Truppen versagt haben, so schlage ich vor, daß der Abgeordnete Ebert den Posten des Reichskanzlers annimmt.“ Nach einem „Moment des Bedenkens“ antwortete Ebert: „Es ist ein schweres Amt, aber ich werde es übernehmen.“
Während noch in der Reichskanzlei unter Vorsitz Eberts mit Vertretern der USPD verhandelt wurde und diese wegen der Abwesenheit ihres Vorsitzenden Hugo Haase keine bindenden Erklärungen über den Eintritt in die Regierung machen konnten, hatte sich die Lage auf den Straßen Berlins weiter zugespitzt: gleich zweimal wurde in dieser Situation die Republik ausgerufen. Philipp Scheidemann war auf die Nachricht hin, dass Karl Liebknecht vom Balkon des Berliner Stadtschlosses rede und beabsichtige, die „Sowjetrepublik“ auszurufen, aus der Kantine auf den Balkon des Reichstagsgebäudes geeilt; der wartenden Menge hielt er – in solchen Augenblicken um zündende Worte nie verlegen – eine improvisierte Rede: „Das deutsche Volk hat auf der ganzen Linie gesiegt; das Alte, Morsche ist zusammengebrochen. Der Militarismus ist erledigt. Die Hohenzollern haben abgedankt. Ebert bildet die neue Regierung. Alle sozialistischen Richtungen werden ihr angehören. Jetzt besteht unsere Aufgabe darin, diesen glänzenden Sieg, diesen vollen Sieg des deutschen Volkes, nicht beschmutzen zu lassen … Es lebe die deutsche Republik.“ Tatsächlich war Scheidemann damit den Radikalen zuvorgekommen, denn der Linkssozialist Karl Liebknecht hielt seine Rede erst ungefähr zwei Stunden später, gegen 16 Uhr: „Ich proklamiere die freie sozialistische Republik Deutschland, die alle Stämme umfassen soll, in der es keine Knechte mehr geben wird, in der jeder ehrliche Arbeiter den ehrlichen Lohn seiner Arbeit finden wird. Die Herrschaft des Kapitalismus, der Europa in ein Leichenfeld verwandelt hat, ist gebrochen. Wir rufen unsere russischen Brüder zurück. Sie haben bei ihrem Abschied zu uns gesagt: ›Habt ihr in einem Monat nicht das erreicht, was wir erreicht haben, so wenden wir uns von euch ab.‹ Und nun hat es kaum vier Tage gedauert.“
Die Konstellation, unter der die Republik ins Leben gerufen worden ist, wurde durch Liebknechts Rede klar erkennbar: Die Republik hatte von ihrem Beginn an mit zwei Gegnern, ja Feinden, zu rechnen – sie standen rechts und links: Die abgelösten politischen Kräfte und Führungsschichten standen ihr ebenso feindselig gegenüber wie die Linkssozialisten, die sich als Agenten der Weltrevolution verstanden und eine Republik nach sowjetischem Vorbild wollten, die „Diktatur des Proletariats“ – eine Diktatur von Parteifunktionären nach dem Motto: Alles für das Volk, nichts durch das Volk.
Was wollte das Volk an diesem denkwürdigen Novembertag? Wer ist „das Volk“? Das deutsche Volk bildete so wenig wie irgendein anderes eine politische oder gesellschaftliche Einheit, es bildete auch keine Einheit im Hinblick auf Konfession, Bildung und Vermögen. Wenn Scheidemann oder Liebknecht von Volk sprachen, dann hatte das wie bei allen Revolutionären einen polemischen und einen reduzierenden Sinn: Sie meinten die sozialen Unterschichten oder, noch eingeschränkter, die Proletarier. Aber zum deutschen Volk gehörten 1918 alle Gesellschaftsschichten, zählten Offiziere und Soldaten, Angestellte und Arbeiter, Handwerker und Händler, Unternehmer und Landwirte, Politiker und Beamte, Professoren und Studenten. Wollten sie politisch dasselbe, konnten sie überhaupt dasselbe wollen?
Und noch einmal, ein letztes Mal in dieser Geschichte, 9. November 1918: „Als der trübe Novembertag anbrach, zeigte sich nichts, was ihn von anderen Tagen abhob. Die Verkehrsmittel waren vollständig im Betrieb und die Arbeitermassen strömten wie sonst in die Fabriken, Bureaus und Geschäftshäuser. Der Spießer konnte ruhig seinen gewohnten Morgenkaffee trinken. Revolutionsstimmung war äußerlich nirgends sichtbar.“ Nicht nur „der Spießer“ verhielt sich an diesem Samstagmorgen wie gewohnt, es gab auch revolutionäre Arbeiter, die mit dem Ruf geweckt werden mussten, „Steh auf, Arthur, heute ist Revolution“, die sich dann den Schlaf aus den Augen rieben und fragten, ob die Revolution noch Traum oder schon Wirklichkeit sei. Als Arthur sich von Letzterem überzeugt hatte und von den Genossen bewaffnet worden war, stürzte er sich jedoch sofort mit dem Ruf „Mach’s gut Cläre!“ ins revolutionäre Getümmel. Der 9. November blieb nicht so friedlich, wie er scheinbar begonnen hatte, schließlich hatte die SPD-Führung um acht Uhr den Generalstreik ausgerufen, die zum linken Flügel der SPD zählenden „revolutionären Obleute“ hatten wegen der am Vortag erfolgten Verhaftung ihres Mitglieds Ernst Däumig zum Kampf für die sozialistische Republik aufgefordert, Hunderttausende waren auf den Straßen der Reichshauptstadt, Demonstrationen, Aktionen bewaffneter Revolutionäre, Besetzungen von Schlüsselstellungen, Schießereien, Tote und Verletzte bestimmten das Bild.
Am Sonntag, dem 10. November, habe in Berlin der „volle Umsturz“ gesiegt, berichtete ein Chronist, dabei sei unter anderem „der kaiserliche Marstall, in dem kaisertreue Offiziere sich zur Wehr gesetzt haben sollen (gefunden hat man keine), der Schauplatz einer heftigen Schießerei“ geworden. „Im ganzen verlief der Umsturz indessen unter ungeheurem Aufmarsch der Arbeiter unblutig.“ Was diese Arbeitermassen bewegte, war wohl in erster Linie die Hoffnung, mit dem Umsturz das Deutsche Reich dem Frieden nähergebracht zu haben: Brot und Frieden dürften zu ihren wichtigsten Motiven gezählt haben, als sie auf die Straße gingen.
Und wie sahen adlige und bürgerliche Chronisten das Ende der Monarchie? Der liberale Harry Graf Kessler ging am Schöneberger Ufer vorbei zum Kriegsministerium: „Durch die Königgrätzer Straße zog eine Demonstration gegen den Potsdamer Platz … An der Ecke der Königgrätzer und Schöneberger Straße wurden Extrablätter verkauft: ›Abdankung des Kaisers‹. Mir griff es doch an die Gurgel, dieses Ende des Hohenzollernhauses; so kläglich, so nebensächlich, nicht einmal im Mittelpunkt der Ereignisse. ›Längst überholt‹, sagte Ow schon heute morgen. Ich zog mir zu Hause Zivil an, weil Offizieren die Achselstücke und Kokarden abgerissen wurden … In der Wilhelmstraße sah ich das erste rotbeflaggte Auto, ein feldgraues mit dem kaiserlichen Adler.“ Und Theodor Wolff wunderte sich im Berliner Tageblatt vom 10. November, dass „eine so fest gebaute, mit so soliden Mauern umgebene Bastille so in einem Anlauf genommen worden ist. Es gab noch vor einer Woche einen militärischen und zivilen Verwaltungsapparat, der so verzweigt, so ineinander verfädelt, so tief eingewurzelt war, daß er über den Wechsel der Zeiten hinaus seine Herrschaft gesichert zu haben schien … eine riesige Militärorganisation schien alles zu umfassen, in den Ämtern und Ministerien thronte eine scheinbar unbesiegbare Bureaukratie. Gestern früh war, in Berlin wenigstens, das alles noch da. Gestern Nachmittag existierte nichts mehr davon.“
Wo aber stand des Kaisers Heer, als seine Abdankung diskutiert, Revolutionsgefahr und sozialdemokratisches Ultimatum im Großen Hauptquartier zu Spa erörtert wurden? War dieses Heer einsatzbereit, den Kaiser und die Monarchie zu retten? Wo stand seine Führung, als der Monarch erklärte, friedlich an der Spitze des Heeres in die Heimat zurückkehren zu wollen? War das Heer bereit, trotz aussichtsloser Lage weiterzukämpfen, wäre es gegen die revolutionäre Heimat einsatzfähig gewesen?
General Groener sagte zu seinem Kaiser und König am Morgen des 9. November: „Das Heer wird unter seinen Führern und kommandierenden Generalen in Ruhe und Ordnung in die Heimat zurückmarschieren, aber nicht unter dem Befehl Ew. Majestät, denn es steht nicht mehr hinter Ew. Majestät.“ Am Abend desselben Tages konstatierte der Chef der Obersten Heeresleitung, Generalfeldmarschall von Hindenburg, in realistischer Einschätzung der Lage: „Ich kann es nicht verantworten, daß Ew. Majestät von meuternden Truppen nach Berlin verschleppt und der revolutionären Regierung als Gefangener ausgeliefert werden.“ In widerstrebender Anerkennung seiner Ohnmacht flüchtete der Kaiser, dem Rat seiner engsten Umgebung folgend, in der Dunkelheit des folgenden Morgens nach Holland. Das war das Ende einer mehr als 500-jährigen Geschichte der Hohenzollernmonarchie, es war ein klägliches Ende, und so verwundert es kaum, dass ihre Anhänger mit diesem Ende nichts zu tun haben wollten und wiederum die Fehler nicht in der eigenen Politik suchten.
Wie sah der neue Reichskanzler, der binnen weniger Stunden von einem quasi kaiserlichen zu einem republikanischen Regierungschef wurde, diese Wendung? Er hörte von einigen Arbeitern und Soldaten, die mit Scheidemann wieder in die Reichstagskantine zurückkehrten: „Scheidemann hat die Republik ausgerufen!“ Ebert lief dunkelrot an, schlug die Faust auf den Tisch, schrie: „Ist das wahr?“ und dann: „Du hast kein Recht, die Republik auszurufen! Was aus Deutschland wird, ob Republik oder was sonst, das entscheidet eine Konstituante!“ Verwunderlich, dass der Vorsitzende einer republikanisch-sozialistischen Partei so reagierte, und Scheidemann fragte sich erstaunt, wie ein „solch kluger Mensch“ so reagieren könne, der noch am Vormittag des 9. November Regentschaft, Reichsverweserschaft und Ähnliches als „total erledigtes monarchisches Gerümpel“ bezeichnet hatte.
Eberts Reaktion war keineswegs nur Theaterdonner, vielmehr hatte er immer wieder gefordert, die künftige staatsrechtliche Gestaltung Deutschlands ausschließlich einer aus allgemeinen, gleichen und geheimen Wahlen hervorgehenden Konstituante als Repräsentation des Volkswillens zu übertragen.
„Die Revolution war in erster Linie eine Militärrevolution, sie ist gleichzeitig an weit auseinanderliegenden Stellen der Front und in der Heimat aufgeflammt. Ihr Verlauf war überall derselbe: ein kampfloses Zusammenbrechen, ein Verschwinden der Offiziere, eine Herrschaft der Soldatenräte und dann ein Durcheinander, während die Soldaten und Matrosen zunächst nur eine Art vergnügten Feriengefühls zeigten.“ Das notierte am 30. Dezember 1918 ein kluger zeitgenössischer Beobachter, Ernst Troeltsch . Jetzt die Regierung zu übernehmen hieß, den Tanz auf einem Vulkan wagen. Die Zahl der existenzbedrohenden Probleme des Reiches war unübersehbar: Stabilisierung der Revolutionsregierung, Friedensschluss, Sicherung der Reichseinheit, Sicherung der Versorgung, Rückführung des Millionenheers von Soldaten, Wahrung der Rechtsstaatlichkeit, Bestandsaufnahme der durch den Krieg entstandenen unübersehbaren wirtschaftlichen und sozialen Folgen, Umstellung der Kriegs- auf Friedenswirtschaft, Vorbereitung einer neuen staatlichen und gesellschaftlichen Ordnung … Schon diese wenigen Stichworte zeigen: Keine der vorangegangenen Reichsregierungen hatte vor einer solchen Fülle von Problemen gestanden, keine auch auf machtpolitisch und verfassungspolitisch derart schwankendem Grund. „Wer heute imstande ist, Ordnung zu schaffen und zu bewahren, der ist der Retter des Vaterlandes …“, meinte einer der führenden Politiker des zusammengebrochenen Kaiserreichs . Friedrich Eberts Verdienst ist die Rettung des Deutschen Reiches in diesen Monaten gewesen, aber die Republik ist schließlich gescheitert, nicht mehr zu seinen Lebzeiten, nicht mehr zu seinen Amtszeiten zwar, doch nur wenige Jahre später. Die Frage also ist unabweisbar: War Eberts Weichenstellung in der gegebenen historischen Situation richtig, oder hätte eine andere Politik größere Chancen gehabt, die Republik zu stabilisieren?
Historische Gerechtigkeit verlangt eine erste Einschränkung: Wir Nachlebenden wissen um das Scheitern der Republik, wir kennen wesentliche Ursachen ihres Scheiterns, das seit Jahrzehnten mit zunehmender Intensität erforscht wird. Diese historische Erfahrung konnten die Zeitgenossen von 1918/19 nicht für ihre Entscheidungen verwerten. Es ist wohlfeil, nach 100 Jahren Abstand Ratschläge zu geben. Auf der anderen Seite dürfen und können wir auf die historische Erfahrung nicht verzichten, wir müssen nach den Ursachen fragen und können uns vor historischen Urteilen nicht drücken. Neben dem tatsächlichen Geschehen muss berücksichtigt werden, was im zeitgenössischen Horizont als möglich und praktikabel angesehen wurde.
Was war zur Sicherung der Regierungsgewalt zunächst nötig? Es war Nacht im Hauptquartier des Großen Generalstabs in Spa. Der Erste Generalquartiermeister studierte die Waffenstillstandsbedingungen, die der französische Marschall Foch der deutschen Delegation unter Leitung des Zentrumspolitikers Matthias Erzberger am 8. November übergeben hatte. Sie liefen auf eine Entwaffnung Deutschlands hinaus und forderten eine Räumung nicht nur der von deutschen Truppen besetzten Gebiete einschließlich Elsass-Lothringens, sondern überdies die Einnahme strategisch wichtiger Brückenköpfe im Reichsgebiet durch Frankreich und die übrigen Westalliierten: Mainz, Koblenz, Köln . Ihre Annahme war gleichbedeutend mit dem Eingeständnis, dass das Reich militärisch am Ende war. Der General wusste, dass die Lage militärisch ausweglos war. In Berlin war am Mittag die Revolution ausgebrochen, ihre Radikalisierung stand zu befürchten, schließlich gab es Vorbilder: Erst ein Jahr war es her, seit die bolschewistische Revolution in Russland gesiegt hatte und dort eine „Diktatur des Proletariats“ errichtet worden war. Karl Liebknecht betrachtete die Bolschewisten als seine Brüder, er hatte es ja selbst vor wenigen Stunden gesagt. Der General war über die Lage in der Reichshauptstadt informiert. Schließlich griff er zum Telefon, rief über den geheimen Draht, der Hauptquartier und Reichskanzlei verband, in Berlin an: „Hier Groener“, „Hier Ebert.“
Ergebnis dieses Gesprächs war der für Revolution und Republik folgenreiche „Pakt“ zwischen Ebert und Groener. Zu diesem Zeitpunkt handelten beide aus eigenem Entschluss: Weder hatte Groener den Chef der Obersten Heeresleitung von Hindenburg konsultiert – das geschah erst am folgenden Tag –, noch hatte Ebert Parteivorstand oder Revolutionsregierung befragt – Letztere wurde wenige Stunden später, am gleichen 10. November, von SPD und USPD gebildet. Das Bündnis zwischen der OHL und Ebert war also der erste machtpolitisch entscheidende Akt zur Stabilisierung der Regierungsgewalt. Die Motive der ungleichen Bündnispartner sind klar: Der Reichskanzler besaß zu diesem Zeitpunkt noch keine wirkliche Machtbasis, er wäre sowohl gegenrevolutionären Bestrebungen von rechts – etwa vonseiten des Militärs – als auch linksradikalen Umsturzversuchen des marxistischen Spartakusbundes oder der revolutionären Obleute mehr oder weniger schutzlos ausgeliefert gewesen. Da Ebert aber möglichst rasch die aus der Revolution entstehende Republik parlamentarisch legitimieren wollte und zur Lösung der anstehenden Probleme auf die Mitarbeit der bestehenden Institutionen staatlicher Herrschaft angewiesen war, musste ihm das Angebot Groeners, die OHL stelle sich der neuen Regierung unter bestimmten Bedingungen zur Verfügung, äußerst gelegen kommen.
Groener seinerseits ging von der Notwendigkeit des Waffenstillstands aus, der politisch legitimiert und verantwortet werden musste. Ein gleichrangiges Motiv lag für ihn darin, um jeden Preis eine Revolution nach bolschewistischem Muster verhindern zu wollen. Dieses Ziel aber war nur mit Ebert erreichbar. In diesem Sinne schrieb er am 17. November an seine Frau: „Der Feldmarschall und ich wollen Ebert, den ich als geraden, ehrlichen und anständigen Charakter schätze, stützen, solange es geht, damit der Karren nicht noch weiter nach links rutscht. Wo aber ist der bürgerliche Mut geblieben? Daß eine verschwindende Minderheit das ganze Deutsche Reich samt den Einzelstaaten glatt umwerfen konnte, ist eine der traurigsten Erscheinungen der ganzen Geschichte des deutschen Volkes … Wenn in Berlin die Radikalen mit Liebknecht die Oberhand bekommen sollten, dann ist der Bürgerkrieg unausbleiblich. Dann ist auch kein Frieden zu erwarten. Weder Amerika noch England können mit einer Liebknecht-Regierung Frieden schließen …“
Das Bündnis wurde durch verschiedene Telegramme zwischen Ebert und der OHL sowie entsprechende Aufrufe besiegelt . Die Forderungen der OHL waren nicht unbillig, sie betrafen die Aufrechterhaltung des Gehorsams in der Truppe, die Dienstregelungen und die Sicherung der Verpflegung.
Auf der Grundlage dieses Bündnisses war es Ebert in den nächsten Monaten möglich, seine politischen Ziele konsequent zu verfolgen und die staatsrechtliche Revolutionierung des Reiches zu sichern. Insofern erfüllte das Bündnis seinen Zweck. Und doch hatte es einen Pferdefuß, der sich erst später deutlicher zeigte: Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der Revolutionsregierung war einer der geschicktesten Schachzüge, den die OHL in dieser Situation machen konnte. Die OHL ging von der Tatsache aus, dass der Kaiser vor seiner Flucht nach Holland Generalfeldmarschall von Hindenburg die militärische Kommandogewalt übertragen hatte, sie leitete ihre Legitimation also vom Kaiser und damit der alten Verfassung her, nicht aber von den neuen Machthabern. Für die Argumentation der OHL war es hilfreich, dass der letzte kaiserliche Reichskanzler sein Amt auf Ebert übertragen hatte: So wenig dieser Akt verfassungsrechtlich haltbar war, so wichtig wurde er doch für die politische Legitimierung Eberts gegenüber den bestehenden Behörden und dem Militär – man lebte mit der Fiktion einer quasilegalen Amtsübertragung. Die OHL beanspruchte in dieser Konstellation weiterhin, neben der Revolutionsregierung eigenverantwortlich zu handeln, nicht aber politisch weisungsgebunden zu sein. Angesichts der faktischen Machtkonstellation blieb die schon während des Krieges weitgehend extrakonstitutionelle Stellung der OHL bestehen, wenngleich Ebert in der oben zitierten großen Reichstagsrede vom Oktober 1918 selbst auf die verfassungspolitische Problematik aufmerksam gemacht hatte.
Natürlich hätte Ebert auch anders handeln können, dann aber hätte er erstens einen mehr oder weniger eindeutigen Linkskurs steuern müssen, um sich der marxistischen Kräfte sicher zu sein, und zweitens Bürgerkrieg und totales Chaos, möglicherweise auch den Zerfall des Reiches in Kauf nehmen müssen. Jede dieser Gefahren schien ihm größer als diejenigen, die sich aus dem Bündnis mit der OHL ergaben. Auch mochte er denken, er könne sein im Oktober 1918 in der Reichstagsrede erklärtes Ziel, die extrakonstitutionelle Stellung der Militärs zu beseitigen, auf verfassungsmäßig-parlamentarischem Wege erreichen, wenn die Republik erst einmal etabliert sein würde. Als zwangsläufig musste Ebert die künftige Entwicklung der Reichswehr und die mangelnde Unterordnung unter die politische Führung nicht ansehen.
Ein zweites, nicht weniger bedeutsames Bündnis wurde wenige Stunden später, am 10. November, geschlossen: die Regierungskoalition zwischen SPD und USPD. Dieser Pakt war kurzlebiger, aber kaum weniger folgenreich als der zwischen Ebert und Groener und stand zu diesem gleichsam in einem dialektischen Verhältnis. Zwar waren nicht, wie Scheidemann verkündet hatte, alle sozialistischen Richtungen in der aus je drei Mitgliedern der Unabhängigen und der Mehrheitssozialdemokraten gebildeten Regierung vertreten – die sich „Rat der Volksbeauftragten“ nannte –, aber doch die beiden wichtigsten. Die Parteivorsitzenden Ebert und Haase übernahmen gemeinsam den Vorsitz, doch erwies sich bald, dass der ungleich energischere Ebert unbestritten Primus inter pares der Revolutionsregierung war, wobei ihm gegenüber den staatlichen Instanzen zugutekam, was ihm bei der revolutionären Linken schadete: die nur einen Tag wirksame Ernennung zum Reichskanzler. Ebert scheute sich keineswegs, neben der Bezeichnung Volksbeauftragter auch den Titel Reichskanzler weiterhin zu führen, obwohl die am 10. November gebildete Regierung ihre Legitimation aus Volkssouveränität und Revolution herleitete. Der am 12. November 1918 veröffentlichte „Aufruf des Rats der Volksbeauftragten an das deutsche Volk“ begann daher auch mit dem Satz: „Die aus der Revolution hervorgegangene Regierung, deren politische Leitung rein sozialistisch ist, setzt sich die Aufgabe, das sozialistische Programm zu verwirklichen.“ Es existierte also gleichsam eine doppelte Legitimation: die durch die alten Gewalten und die Selbstlegitimation der Revolutionäre. In staatsrechtlicher Hinsicht war die eine so fragwürdig wie die andere.
In Berlin hätte sich eine reine SPD-Regierung wohl kaum halten können, da Hunderttausende von Revolutionsstimmung ergriffen waren und der Einfluss der USPD auf die hauptstädtischen Massen – zumindest zeitweise – größer war als der der Mehrheitssozialdemokratie. Bedenkt man außerdem, wie stark die auf eine „Diktatur des Proletariats“ hinarbeitenden Kräfte um Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg waren, die ein Zusammengehen mit den „Regierungssozialisten“ strikt ablehnten, dann wird klar: Zwar war gegen die SPD als stärkste politische Partei mit beträchtlichem Massenanhang und Unterstützung der OHL nicht zu regieren, sie bedurfte aber ihrerseits der Koalitionäre, um nicht von der einen oder anderen Seite zerrieben zu werden. Die Taktik Eberts, sofort auf Bündnisse nach beiden Seiten zuzusteuern, erwies sich als erfolgreich.
Dabei hinderten ihn die Differenzen zum neuen Koalitionspartner nicht am unverzüglichen Abschluss, hatte er doch keine Zeit zu verlieren, wenn er die revolutionäre Entwicklung noch kanalisieren wollte. Einig waren sich die Partner über die Aufhebung des Belagerungszustandes und die Gewährung von Grundrechten, ferner über eine Reihe sozialpolitischer Maßnahmen, beispielsweise die Festsetzung des Achtstundentags, sowie die Einführung des allgemeinen, gleichen, geheimen, direkten Verhältniswahlsystems für alle Deutschen über 20 Jahre – einschließlich der bisher vom Wahlrecht ausgeschlossenen Frauen – für sämtliche Wahlen zu öffentlichen Körperschaften. Diese Programmpunkte finden sich denn auch in dem zitierten Aufruf der Volksbeauftragten vom 12. November.
Uneinig waren sich die Partner demgegenüber in der Grundsatzfrage: Sollte die Revolutionsregierung auf die baldige Wahl einer Verfassunggebenden Nationalversammlung hinarbeiten, die souverän über die künftige Verfassung der Deutschen Republik zu entscheiden haben würde? Oder sollte die Revolutionsregierung zunächst Ziele eines revolutionären Sozialismus verwirklichen, beispielsweise die Sozialisierung großer Wirtschaftsunternehmen, die Etablierung des während der Revolution entstandenen Systems von Arbeiter- und Soldatenräten in allen gesellschaftlichen Sektoren – Verwaltung, Wirtschaft, Justiz, Militär – und schließlich im politischen Entscheidungsprozess? Um diese Alternative wurde während der nächsten Wochen gerungen, doch brachte es die revolutionäre Situation mit sich, dass die Regierung eine Grundsatzentscheidung von solcher Tragweite nicht autonom fällen konnte, stand sie doch unter ständigem Druck der Straße, die immer wieder durch revolutionäre Gruppen mobilisiert wurde.
Die scheinbar klare Alternative komplizierte sich durch verschiedene Faktoren: Die Fronten verliefen quer durch die beiden Koalitionsparteien und ihre Anhängerschaft, es gab also auch zahlreiche Befürworter des Rätesystems innerhalb der SPD, ja es amtierten sogar einige bürgerliche Räte. Von den Rätemodellen zu unterscheiden sind die während des Jahres 1918 in Betrieben und beim Militär spontan entstandenen Arbeiter- und Soldatenräte, die während der Revolution politische Funktionen, zum Beispiel auch in den staatlichen und kommunalen Behörden, erhielten.





DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.