
Die Winterrose (Rosen-Trilogie 2) - eBook-Ausgabe
Roman
Absoluter Bestsellercharakter! - Literatursofa
Die Winterrose (Rosen-Trilogie 2) — Inhalt
London, 1900: Die junge India Selwyn-Jones bewegt sich in den feinsten Kreisen. Bis sie als Ärztin im berüchtigten Viertel Whitechapel zu arbeiten beginnt – und dort in leidenschaftlicher Liebe zu dem gefürchteten Gangsterboss Sid Malone entbrennt … Voller Dramatik und Sinnlichkeit erzählt Jennifer Donnelly, die Autorin der international erfolgreichen „Teerose“, von ihrer unbeugsamen Heldin India.
Leseprobe zu „Die Winterrose (Rosen-Trilogie 2)“
In Erinnerung an
Fred Sage
und das London, das er kannte
Doctor, my eyes
Cannot see the sky.
Is this the prize
For having learned how not to cry?
Doktor, meine Augen
Können den Himmel nicht sehen.
Ist das der Preis dafür,
Daß ich gelernt habe, nicht zu weinen?
Jackson Browne
Prolog
London, Mai 1900
Einen Bullen konnte Frankie Betts schon von weitem riechen. Bullen rochen nach Bier und Haarwasser und gingen, als ob ihre Schuhe drückten. In den Armenvierteln unter den vielen hungrigen Leuten nahmen sie sich besonders feist und fett aus, rausgemästet wie sie [...]
In Erinnerung an
Fred Sage
und das London, das er kannte
Doctor, my eyes
Cannot see the sky.
Is this the prize
For having learned how not to cry?
Doktor, meine Augen
Können den Himmel nicht sehen.
Ist das der Preis dafür,
Daß ich gelernt habe, nicht zu weinen?
Jackson Browne
Prolog
London, Mai 1900
Einen Bullen konnte Frankie Betts schon von weitem riechen. Bullen rochen nach Bier und Haarwasser und gingen, als ob ihre Schuhe drückten. In den Armenvierteln unter den vielen hungrigen Leuten nahmen sie sich besonders feist und fett aus, rausgemästet wie sie waren von all den kostenlosen Mahlzeiten, die sie sich zusammenschnorrten.
Bullen machten Frankie rasend. Sie brachten ihn dazu, daß er alles und jeden, der ihm in die Quere kam, niederknüppeln wollte. Und jetzt saß einer direkt neben ihm. Im Barkentine. In der Hochburg der Firma. Und tat so, als wäre er ein ganz normaler Gast. Trank, redete und bestellte Essen.
Was für eine gottverdammte Frechheit!
Frankie drückte seine Zigarette aus. Er schob seine Ärmel zurück, stand auf und wollte den Mann verprügeln, bis ihm das Licht ausging. Doch bevor er dazu kam, stand plötzlich ein frisches Bier auf der Theke. Desi, der Wirt, hatte es hingestellt.
„Du gehst doch noch nicht, Kumpel? Bist doch gerade erst gekommen.“ Desis Stimme klang freundlich, aber seine Augen blinzelten warnend.
Frankie nickte. „Danke“, sagte er mit zusammengepreßten Lippen und setzte sich wieder.
Desi hatte gut daran getan, ihn aufzuhalten. Sid wäre sauer. Er würde sagen, er sei enttäuscht. Frankie war nicht so dumm, Sid zu enttäuschen. So dumm war keiner.
Er trank einen Schluck Bier, zündete eine weitere Zigarette an und schob den Fehler, den er fast begangen hätte, auf seine schlechten Nerven. Es war eine schwierige Zeit für die Firma. Eine gefährliche Zeit. Die Bullen jagten sie gnadenlos. Letzte Woche hatten sie einen Wagen mit Lohngeldern ausgeraubt und waren mit über tausend Pfund abgehauen, was Freddie Lytton, den hiesigen Parlamentsabgeordneten, dazu brachte, ihnen den Krieg zu erklären. Er ließ Sid festnehmen. Ronnie und Desi ebenfalls. Aber der Richter hatte sie wieder laufenlassen. Es stellte sich raus, daß es keine Zeugen gab. Zwei Männer und eine Frau hatten den Überfall gesehen, doch als sie hörten, daß sie gegen Sid Malone aussagen sollten, konnten sie sich plötzlich nicht mehr erinnern, wie die Räuber ausgesehen hatten.
„Die Polizei hat einen Fehler gemacht und den falschen Mann verhaftet“, sagte Sid auf den Stufen von Old Bailey zur Presse, nachdem er freigelassen worden war. „Ich bin kein Krimineller. Nur ein Geschäftsmann, der auf ehrliche Weise seinen Lebensunterhalt verdienen will.“ Das war ein Satz, den er schon oft gebraucht hatte – wann immer die Polizei in seiner Werft oder in seinen Pubs Razzia machte. Er sagte ihn so oft, daß Alvin Donaldson, ein Kriminalinspektor, ihn den „Vorsitzenden“ und seine Bande die „Firma“ getauft hatte.
Lytton war außer sich gewesen. Er schwor, Sids Kopf auf einem Tablett zu servieren. Er schwor, er würde jemanden finden, einen ehrlichen Menschen, der keine Angst hatte, die Wahrheit zu sagen, der sich vor Malone und seiner Verbrecherbande nicht fürchtete, und wenn ihm das gelänge, würde er sie lebenslänglich hinter Gitter bringen.
„Der macht bloß Wind“, sagte Sid. „Will sein Bild in der Zeitung sehen. Schließlich sind bald Wahlen.“
Frankie hatte ihm geglaubt, aber jetzt saß dieser Bulle hier, frech wie Oskar, und er war sich nicht mehr so sicher, ob Sid recht hatte. Frankie sah den Mann an – nicht direkt, sondern im Spiegel über der Bar. Kam er von Lytton? Oder von jemand anderem? Warum hatte man ihn hergeschickt?
Wo es einen Bullen gab, gab es gewöhnlich noch ein Dutzend andere. Frankie ließ den Blick durch den Raum schweifen. Wenn je ein Pub den Namen Räuberhöhle verdiente, dachte er, dann das Bark. Der dunkle niedrige Bau in Limehouse war zwischen zwei Lagerhäuser am Nordufer der Themse gequetscht. Die Vorderseite lag an der Narrow Street, die baufällige Rückseite hing über den Fluß. Bei Flut konnte man die Themse gegen die Rückwand schwappen hören. Frankie kannte fast jedes Gesicht. Drei Kerle aus dem Viertel standen am Kamin und reichten Schmuckstücke hin und her, vier weitere spielten Karten, während ein fünfter Pfeile auf eine Dartscheibe warf. Andere saßen dicht gedrängt um wacklige Tische oder an der Bar, rauchten, tranken, redeten und lachten laut. Prahlten und stolzierten großspurig herum. Kleinkriminelle, alle zusammen.
Der Mann, hinter dem der Bulle her war, prahlte nicht, stolzierte nicht herum und hatte auch sonst nichts an sich, was auf eine geringe Stellung hingewiesen hätte. Er war einer der mächtigsten und am meisten gefürchteten Verbrecherbosse in London, und Frankie dachte, wenn dieser erbärmliche Bulle wüßte, was gut für ihn ist, würde er abhauen. Solange er noch konnte.
Noch während Frankie den Mann beobachtete, kam Lily, das Barmädchen, aus der Küche und knallte so heftig einen Teller vor ihn hin, daß die Brühe auf seine Zeitung schwappte.
„Einmal Limehouse-Eintopf“, sagte sie.
Der Mann starrte auf die dampfende Plörre. „Das ist Fisch“, sagte er ausdruckslos.
„Sie sind mir ein echter Sherlock Holmes. Was erwarten Sie? Lammkarree?“
„Schweinefleisch, dachte ich.“
„Wir sind hier in Limehouse. Nicht auf der grünen Wiese. Das macht zwei Pence.“
Der Mann schob eine Münze über die Bar, dann rührte er mit einem schmutzigen Löffel die graue Brühe um. Knochen und Hautstücke schwammen darin herum, ein Kartoffelschnitz und etwas Sellerie. Ein Brocken glitschiges weißes Fleisch kam nach oben, das schon ziemlich verdorben wirkte.
Karpfen, dachte Frankie. Die sah er oft bei Ebbe. Riesige Apparate mit trüben Augen, die hilflos im stinkenden Flußschlamm zappelten. Einen Bissen davon, Kumpel, dachte er, und du hast eine Woche lang die Scheißerei.
Desi kam herüber. „Irgendwas nicht in Ordnung mit Ihrem Essen?“ fragte er. „Sie haben’s ja nicht mal angerührt.“
Der Fremde legte seinen Löffel weg. Er zögerte.
Sag lieber, daß es schmeckt, dachte Frankie.
„Ich krieg keinen Bissen runter, egal, wie sehr ich mich auch anstrenge“, sagte er schließlich. „Hab bloß von Porterbier gelebt. Sobald ich was anderes eß, dreht’s mir den Magen um.“
„Was? Sonst nichts?“
„Porridge. Milch. Manchmal ein Ei. Die Wachleute im Gefängnis sind schuld daran. Die Bauchtritte, die sie mir verpaßt haben. Davon hab’ ich mich nicht mehr erholt.“
Frankie hätte fast laut herausgelacht.
Desi jedoch nicht. Sein Gesichtsausdruck blieb ungerührt. „Sie waren im Knast?“ fragte er.
„Ja. Einbruch. In einem Juwelierladen oben in Camden. Ich hatte ein Klappmesser in der Tasche, also sagten die Bullen, ich wär’ bewaffnet gewesen. Hab’ fünf Jahre gekriegt.“
„Und Sie sind gerade rausgekommen?“
Der Fremde nickte. Er nahm seine Mütze ab. Ein typischer Gefängnishaarschnitt kam zum Vorschein.
Desi grinste. „Du armer Teufel“, sagte er. „Wo hast du denn eingesessen? In Reading?“
„Petonville.“
„Da hab’ ich selbst mal ’ne Weile gesessen. Der Wärter ist ein übles Schwein. Willocks hieß er. Macht er noch immer allen das Leben zur Hölle?“
„O ja.“
Blödsinn, du dummer Hund, dachte Frankie. Hättest dich umhören sollen.
Es gab keinen Willocks in Petonville. Hatte nie einen gegeben.
Desi schenkte ein neues Glas Porter ein. „Hier, Alter. Geht aufs Haus.“
Als er wegging, um andere Gäste zu bedienen, tauschte er wieder einen Blick mit Frankie aus. Paß auf den auf, sollte das heißen.
Frankie wartete eine Weile, trank einen Schluck aus seinem Glas, rauchte und stieß dann den Mann am Arm an, so daß Bier auf dessen Zeitung schwappte.
„Tut mir leid, Kumpel“, entschuldigte er sich, als hätte es sich um ein Mißgeschick gehandelt. „Jetzt ist deine Zeitung naß.“
„Macht nichts“, sagte der Bulle lächelnd. „Das Schmierblatt taugt sowieso bloß zum Aufwischen.“
Frankie lachte. Der Mann nutzte seine gespielte gute Laune für einen Einstieg. Ganz wie er erwartet hatte.
„Michael Bennett“, stellte er sich vor. „Freut mich, dich kennenzulernen.“
„Roger Evans“, sagte Frankie. „Gleichfalls.“
„Hast du davon gehört?“ fragte Bennett und deutete auf die Titelstory. „Es geht um einen Raub von Lohngeldern. Es heißt, Sid Malone sei’s gewesen. Er sei mit zehntausend Pfund abgehauen.“
Schön wär’s, dachte Frankie. Die Schmierblätter übertrieben immer.
Bennett schlug ein paarmal mit dem Handrücken auf Frankies Arm. „Ich hab’ gehört, Malone versteckt die Knete in einem Boot auf der Themse“, sagte er. „Und einen Teil in einem Warenlager mit Zucker.“
„Ach, wirklich?“
Bennett nickte. „Ich hab’ auch gehört, daß er einiges hier im Bark hat. Wir könnten direkt darauf sitzen“, fuhr er fort und trat mit dem Fuß gegen die Bodendielen. „Du hast nicht zufällig eine Brechstange in der Tasche, was?“
Frankie zwang sich erneut zu einem Lachen.
„Egal, wo er’s lagert, es muß ein großes Versteck sein. Die Firma gibt sich nicht mit Kleinkram ab. Ein Kerl hat mir gesteckt, allein der Raub von Goldbarren hätte ihnen Tausende eingebracht. Tausende! Mann, kannst du dir vorstellen, so viel Zaster zu haben?“
Frankie spürte, wie ihn erneut der Zorn packte. Es juckte ihn in den Fingern. Wie gern hätte er dem Mistkerl die Nase gebrochen. Das würde ihn lehren, sie nicht in die Angelegenheiten anderer Leute zu stecken.
„Benutz dein Hirn, Frankie, nicht deine Fäuste. Dein Hirn“, hörte er Sid sagen.
Bennett berührte wieder Frankies Arm. „Ich hab’ auch gehört, daß Malone regelmäßig in diesen Pub kommt“, sagte er. „Es soll sein Hauptquartier sein.“
„Das ist mir nicht bekannt“, antwortete Frankie.
Bennett beugte sich nahe heran. „Ich müßte mal mit ihm reden. Nur ganz kurz. Weißt du, wie ich ihn finden kann?“
Frankie schüttelte den Kopf. „Tut mir leid, Kumpel.“
Bennett griff in die Tasche und legte eine Zehnpfundnote auf die Bar. Für die meisten Männer in Limehouse waren zehn Pfund ein Vermögen. Frankie tat so, als machte er dabei keine Ausnahme, und steckte sie schnell ein.
„Wir treffen uns hinter dem Pub“, sagte er. „In fünf Minuten.“
Er verließ das Bark durch die Eingangstür und ging durch die Kellertür wieder hinein. Rasch stieg er eine enge Holztreppe, die vom Keller in die Küche führte, und dann eine weitere ins obere Stockwerk hinauf. Er ging einen kleinen Gang hinunter und klopfte zweimal an eine verschlossene Tür.
Sie wurde von einem schlaksigen Mann in Hemdsärmeln und Weste geöffnet, der keine Anstalten machte, den Totschläger in seiner Hand zu verbergen. Hinter ihm, in der Mitte des Raums, saß ein anderer Mann an einem Tisch, der seelenruhig Zwanzigpfundnoten zählte. Er blickte mit seinen grünen Augen zu Frankie auf.
„Schwierigkeiten“, sagte Frankie. „Einer von Lytton. Ganz sicher. Behauptet, sein Name sei Bennett. In fünf Minuten ist er draußen hinterm Haus.“
Der Mann mit den grünen Augen nickte. „Halt ihn dort fest“, antwortete er und zählte weiter.
Frankie eilte die Treppe wieder hinunter und ging durch die Kellertür hinaus. Im Schankraum sah Michael Bennett auf die Uhr neben der Kasse. Es war fast zwei Uhr morgens. Er leerte sein Glas und ließ ein paar Münzen auf der Theke zurück.
„Gute Nacht, Kumpel“, sagte er und nickte dem Wirt zu.
Desi hob grüßend die Hand.
„Wo ist der Abtritt?“ fragte Bennett.
„Was glaubst du, wo du bist? Im Buckingham-Palast?“ fragte Desi. „Pinkel in den Fluß wie alle anderen auch.“
Bennett trat aus der Tür, ging um den Pub herum und stieg dann über ein paar Steinstufen zum Wasser hinab.
Frankie stand hinter einer dichten Reihe von Pfählen und beobachtete ihn, wie er die Hose aufknöpfte und lange pißte. Es herrschte gerade Ebbe. In der Dunkelheit konnte Frankie den Fluß kaum sehen, aber er konnte ihn hören – das Wasser, das gegen den Rumpf der vertäuten Lastkähne schwappte, an Leinen und Bojen zerrte und in kleinen Strudeln vorbeifloß. Als Bennett fertig war, trat Frankie zwischen den Pfeilern heraus.
„Mein Gott!“ japste Bennett. „Hast du mich erschreckt. Hier unten ist’s stockdunkel. Wo ist Malone?“
„Auf dem Weg.“
„Bist du sicher?“
„Hab’ ich doch gesagt, oder?“
„Ich will mein Geld zurück, wenn er nicht auftaucht“, drohte Bennett.
Frankie schüttelte den Kopf und fand, daß er die Rolle des anständigen Kerls schon viel zu lange gespielt hatte. „Keine Sorge. Er kommt schon“, antwortete er.
Die beiden Männer warteten noch etwa zehn Minuten, dann wurde Bennett ungeduldig. Gerade als er sauer zu werden begann, flammte ein Streichholz hinter ihm auf. Er fuhr herum.
Frankie erblickte Sid und Desi. Sie standen am Fuß der Steintreppe. Desi zündete eine Laterne an.
„Michael Bennett?“ fragte Sid.
Bennett starrte ihn an, gab aber keine Antwort.
„Mein Boß hat dir eine Frage gestellt“, sagte Frankie.
Bennett drehte sich zu ihm um. „Dein Boß ? Aber ich dachte … du hast gesagt …“, stammelte er.
„Was willst du?“ knurrte Frankie. „Wer hat dich geschickt?“
Bennett trat einen Schritt zurück, weg von Sid. „Ich will keine Schwierigkeiten machen“, sagte er. „Ich bin bloß hergekommen, um was auszurichten, das ist alles. Eine Bekannte von mir möchte Sid Malone treffen. Sie trifft sich zu jeder Zeit und an jedem Ort mit ihm, aber sie muß ihn unbedingt sprechen.“
„Bist du ein Bulle?“ fragte Frankie. „Hat Lytton dich geschickt?“
Bennett schüttelte den Kopf. „Ich hab’ dir die Wahrheit gesagt. Ich bin Privatdetektiv.“
Malone reckte den Kopf und musterte Bennett.
„Sie müssen mir eine Antwort geben“, sagte Bennett zu ihm. „Sie kennen diese Frau nicht. Die läßt nicht locker. Sonst kommt sie noch selbst her.“
Malone hatte noch immer nichts gesagt, hörte jedoch zu, was Bennett zu ermutigen schien. Er wurde kühner.
„Mit einem Nein gibt die sich nicht zufrieden. Ihren Namen kann ich nicht nennen, den will sie nicht preisgeben. Aber sie weiß ziemlich genau, was sie will, das Miststück, das jedenfalls kann ich Ihnen sagen“, fügte er hinzu und lachte.
Später erinnerte sich Frankie, daß Sids Mund bei dem Wort „Miststück“ gezuckt hatte. Und daß er gedacht hatte, er würde zu einem Lächeln ansetzen. Er erinnerte sich, wie Sid langsam und gelassen auf Bennett zuging, als wollte er ihm die Hand schütteln und für die Nachricht danken. Statt dessen packte er den Mann und brach ihm mit einer einzigen schnellen Bewegung den Unterarm. Der Schmerz ließ Bennett auf die Knie sinken, aber es war der Anblick seiner Knochen, die durch die Haut stachen, der ihn zum Schreien brachte.
Sid packte einen Büschel seiner Haare und riß seinen Kopf zurück. Bennett vestummte. „Hier ist meine Antwort. Laut und deutlich“, sagte er. „Du richtest Fiona Finnegan aus, daß der Mann, hinter dem sie her ist, tot ist. Genauso tot, wie du sein wirst, wenn du dich noch mal hier blicken läßt.“
Sid ließ ihn los, und Bennett sackte in den Schlamm. Dann drehte er sich um und ging weg. Frankie folgte ihm. Desi löschte die Laterne.
„Wer ist diese Frau, Boß?“ fragte Frankie, verwundert über Bennetts Bitte und Sids Reaktion. „Kriegt sie ein Kind?“
Sid gab keine Antwort.
„Ist sie eine Verwandte?“
In der Dunkelheit konnte Frankie nur Sids Stimme hören, aber nicht sein Gesicht sehen. Andernfalls hätte er den tiefen, anhaltenden Schmerz darin erkannt, als er sagte: „Sie ist niemand, Frankie. Keine Verwandte. Sie bedeutet mir überhaupt nichts.“
Erster Teil
Mai 1900
1
Jones!«
India Selwyn-Jones drehte sich um, als sie ihren Namen hörte. Sie mußte die Augen zusammenkneifen, um zu sehen, wer da gerufen hatte. Maud hatte ihr die Brille weggenommen.
„Professor Fenwick!“ rief sie schließlich zurück und strahlte den kahlen, bärtigen Mann an, der durch die vielen Studenten mit Doktorhüten auf dem Kopf auf sie zueilte.
„Jones, Sie schlaue kleine Katze! Ein Walker-Stipendium und den Dennis-Preis! Gibt’s irgendwas, das Sie nicht gewonnen haben?“
„Hatcher hat den Beaton gekriegt.“
„Der Beaton ist Humbug. Jeder Dummkopf kann sich Anatomie merken. Eine Ärztin braucht mehr als nur Wissen, sie muß es anwenden können. Hatcher kann kaum eine Aderpresse anlegen.“
„Pst, Professor! Sie steht direkt hinter Ihnen“, flüsterte India entrüstet.
Die Promotionszeremonie war vorbei. Die Studenten waren zu den Klängen eines flotten Marschs von der kleinen Bühne des Auditoriums hinabgezogen und posierten jetzt für Fotos oder plauderten mit Gratulanten.
Fenwick machte eine wegwerfende Handbewegung. Ihm war nichts peinlich. Er war ein Mann, der klar und offen seine Meinung sagte, gewöhnlich mit voller Lautstärke. India hatte seine Beleidigungen selbst erlebt. Oft genug hatten sie sich gegen sie gerichtet. Sie erinnerte sich an ihre erste Woche in seiner Klasse. Sie sollte einen Patienten mit Rippenfellentzündung befragen. Hinterher hatte Fenwick von ihr verlangt, anhand ihrer Notizen den Fall zu beschreiben. Noch immer hörte sie, wie er sie anschrie, weil sie mit den Worten „Ich glaube …“ begann.
„Sie machen was? Sie glauben?“ schrie er. „Aber ich habe das Gefühl …“, verteidigte sie sich. „Sie sind nicht in meiner Klasse, um zu glauben oder zu fühlen, Jones. Hier geht’s nicht um Theologie. Hier geht’s um Diagnosen, die Aufnahme von Fällen. Sie sind hier nur, um zu beobachten, weil Sie noch viel zu unwissend sind, um etwas anderes zu tun. Glaube und Gefühl vernebeln das Urteil. Was tun sie, Jones?“
„Sie vernebeln das Urteil, Sir“, antwortete India mit hochrotem Kopf.
„Richtig. Glauben und Gefühl bedeuten für Ihren Patienten nur, daß Sie ihm mit dummen Vorurteilen schaden. Sehen Sie ihn an, Jones … Sie sehen das Ödem des Herzkranken und wissen, daß es vom Versagen der Nieren herrührt … Sie sehen die Gallenkolik und wissen, daß sie durch Bleivergiftung hervorgerufen wurde … aber sehen Sie ihn an, Jones, klar und leidenschaftslos, und Sie werden ihn heilen.“
„Kommen Sie, kommen Sie, werfen wir einen Blick hinein“, sagte Fenwick jetzt und deutete ungeduldig auf die Ledermappe unter Indias Arm.
India öffnete sie, weil sie selbst noch einmal einen Blick darauf werfen wollte – auf das braune Dokument mit ihrem Namen in kupferner Prägeschrift und dem Datum 26. Mai 1900, dem Siegel der Londoner Medizinhochschule für Frauen und der Urkunde, daß sie ihr Diplom erhalten hatte. Daß sie jetzt Ärztin war.
„Doktor India Selwyn-Jones. Klingt gut, nicht?“ sagte Fenwick.
„Das stimmt, und wenn ich es noch ein paarmal höre, glaube ich vielleicht selbst, daß es wahr ist.“
„Unsinn. Hier gibt’s einige, die einen schriftlichen Wisch brauchen, um zu glauben, daß sie Ärztinnen sind, aber zu denen gehören Sie nicht.“
„Professor Fenwick! Professor, hier drüben …“, rief eine schrille weibliche Stimme.
„Meine Güte“, sagte Fenwick. „Die Dekanin. Sieht aus, als hätte sie Broadmoor bei sich, den armen Teufel. Sie will, daß ich ihn überzeuge, ein paar von euch anzustellen. Sie haben verdammtes Glück gehabt, den Job bei Gifford zu ergattern.“
„Das weiß ich, Sir. Ich bin schon begierig anzufangen.“
Fenwick schnaubte. „Wirklich? Kennen Sie Whitechapel?“
„Ich habe eine Weile am London Hospital gearbeitet.“
„Mit Hausbesuchen?“
„Nein, Sir.“
„Hm, dann nehm’ ich’s zurück. Gifford hat Glück gehabt.“
India lächelte. „Wie schlimm kann es schon sein? Ich habe in anderen Armenvierteln Hausbesuche gemacht. In Camden, Paddington, Southwark …“
„Whitechapel ist einzigartig in London, Jones. Seien Sie darauf gefaßt. Sie werden dort eine Menge lernen, das steht fest, aber mit Ihrem Kopf, Ihren Fähigkeiten sollten Sie ein schönes Forschungsstipendium an einem Lehrkrankenhaus haben. Und Ihre eigene Praxis. Wie Hatcher. Eine Privatpraxis. Da gehören Sie hin.“
„Ich kann keine eigene Praxis eröffnen, Sir.“
Fenwick sah sie lange an. „Selbst wenn Sie’s könnten, bezweifle ich, daß Sie’s täten. Jemand könnte Ihnen die Schlüssel zu einer komplett eingerichteten Ordination in der Harley Street überreichen, und Sie würden sie zurückgeben und wieder in die Elendsviertel zurückrennen.“
India lachte. „Wahrscheinlich eher zurückgehen, Sir.“
„Immer noch Ihre Hirngespinste, was?“
„Ich ziehe es vor, sie als Ziele anzusehen, Sir.“
„Eine Klinik, nicht wahr?“
„Ja.“
„Für Frauen und Kinder.“
„Ganz richtig.“
Fenwick seufzte. „Ich kann mich erinnern, Hatcher und Sie haben darüber gesprochen, aber ich hätte nie gedacht, es sei Ihnen ernst damit.“
„Harriet nicht, mir schon.“
„Jones, haben Sie auch nur die leiseste Ahnung, was so etwas erfordert?“
„Durchaus.“
„Das Aufbringen der Mittel, die Suche nach einem geeigneten Ort … Allein bei den Regierungsvorschriften wird einem schwindlig. Sie brauchen Zeit, um eine Klinik aus dem Boden zu stampfen, eine Unmenge Zeit, und Sie werden keine freie Minute mehr haben. Sie werden sich schon bei Gifford zu Tode schuften. Wie wollen Sie das alles schaffen?“
„Ich werde einen Weg finden, Sir. Man muß das Außergewöhnliche versuchen“, sagte India entschieden.
Fenwick reckte den Kopf. „Das gleiche haben Sie mir vor sechs Jahren gesagt. Als Sie zum erstenmal hierherkamen. Ich habe allerdings nie verstanden, warum.“
„Warum?“
„Warum eine adelige junge Frau aus einer der reichsten Familien etwas Außergewöhnliches machen will.“
India wurde rot. „Sir, ich bin nicht … ich …“
„Professor! Professor Fenwick!“ rief die Dekanin erneut.
„Ich muß gehen“, sagte Fenwick. Er schwieg einen Moment und sah auf seine Schuhe hinab, dann fügte er hinzu: „Ich scheue mich nicht, Ihnen zu sagen, daß ich Sie vermissen werde, Jones. Sie sind die beste Studentin, die ich je hatte. Rational, logisch, unemotional. Ein leuchtendes Beispiel für meine derzeitige Schar von Dummköpfen. Ich würde Ihnen auch gern sagen, daß der schwierige Teil hinter Ihnen liegt, aber er fängt erst an. Sie wollen etwas anders machen, die Welt verändern, aber vielleicht hat die Welt andere Vorstellungen. Sie wissen das, nicht wahr?“
„Ja, das weiß ich, Sir.“
„Gut. Dann merken Sie sich: Ganz egal, was dort draußen passiert, vergessen Sie nie, daß Sie Ärztin sind. Eine sehr gute. Das kann Ihnen niemand nehmen. Und nicht, weil es hier drin steht“, er tippte auf das Diplom, „sondern weil es hier drin ist.“ Er tippte an Indias Stirn. „Vergessen Sie das nie.“
Jetzt war es India, die auf ihre Schuhe starrte. „Das werde ich nicht, Sir“, flüsterte sie.
Sie wollte ihm für alles danken, was er für sie getan hatte, daß er ein unwissendes Mädchen von achtzehn Jahren aufgenommen und eine Ärztin aus ihr gemacht hatte, aber sie wußte nicht, wie. Sechs Jahre hatte es gedauert. Sechs lange Jahre der Mühen, des Kampfes und der Zweifel. Sie hatte es nur seinetwegen geschafft. Wie konnte sie ihm dafür danken? Wo sollte sie bloß anfangen?
„Professor Fenwick …“, sagte sie, aber als sie aufsah, war er schon fort.
Absoluter Bestsellercharakter!
Ein herrlicher Schmöker, sehr gut geschrieben. Wir haben lange auf ein solches Buch gewartet.
Ein echter Pageturner für Frauen, die Schmöker lieben.
Ein farbenprächtiges Gemälde der damaligen Zeit mit eisernen und wackeren Charakteren, mit Heldentum und Liebesschwur. Ein Historienroman de luxe!



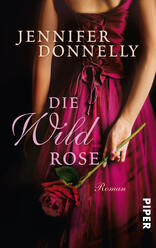











DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.