
Dieses Leben, das wir haben - eBook-Ausgabe
Roman
„Anrührend, komisch, erbarmungslos.“ - Süddeutsche Zeitung
Dieses Leben, das wir haben — Inhalt
Den Alltagsärger hinter sich lassen, die Welt sehen, nachdenken – so hat sich Shepherd den Rest seines Lebens vorgestellt. Seine Frau Glynis kann ihm dabei nicht folgen – sie stellt ihn vor eine tragische Wahl. Nach ihrem mitreißenden Roman „Liebespaarungen“ erzählt Lionel Shrivers neues Buch von den Wandlungen einer Ehe in schweren Zeiten. Und auch von dem Glück, das daraus entstehen kann.
Leseprobe zu „Dieses Leben, das wir haben“
Für Paul. Verloren. Befreit.
Zeit ist Geld.
Benjamin Franklin, Guter Rat
an einen jungen Handwerker, 1748
Kapitel 1
Shepherd Armstrong Knacker
Merrill Lynch Konto-Nr. 934 – 23F917
01. 12. 2004 – 31. 12. 2004
Gesamtnettowert des Portfolios: $ 731 778,56
WAS PACKT MAN ein für den Rest seines Lebens?
Auf ihren Recherchereisen – „Urlaub“ hatten er und Glynis dazu nie gesagt – hatte Shep immer zu viel eingepackt, um für jede Eventualität gewappnet zu sein: Regenzeug, einen Pullover für den Fall, dass das Wetter in Puerto Escondido für die Jahreszeit ungewöhnlich [...]
Für Paul. Verloren. Befreit.
Zeit ist Geld.
Benjamin Franklin, Guter Rat
an einen jungen Handwerker, 1748
Kapitel 1
Shepherd Armstrong Knacker
Merrill Lynch Konto-Nr. 934 – 23F917
01. 12. 2004 – 31. 12. 2004
Gesamtnettowert des Portfolios: $ 731 778,56
WAS PACKT MAN ein für den Rest seines Lebens?
Auf ihren Recherchereisen – „Urlaub“ hatten er und Glynis dazu nie gesagt – hatte Shep immer zu viel eingepackt, um für jede Eventualität gewappnet zu sein: Regenzeug, einen Pullover für den Fall, dass das Wetter in Puerto Escondido für die Jahreszeit ungewöhnlich kalt war. Angesichts der nun unendlichen Eventualitäten war sein erster Impuls, überhaupt nichts mitzunehmen.
Es gab keinen vernünftigen Grund, heimlich von einem Zimmer ins andere zu schleichen wie ein Dieb, der sein eigenes Haus ausrauben wollte – auf leisen Sohlen über die Dielen zu tappen, bei jedem Knarren zusammenzuzucken. Er hatte sich vergewissert, dass Glynis am frühen Abend nicht zu Hause war (wegen eines „Termins“; dass sie nicht erzählt hatte, mit wem oder wo, beunruhigte ihn). Er hatte sich bestätigen lassen, dass Zach bei einem Freund übernachtete ; er hatte seinen Sohn unter dem schwachen Vorwand angerufen, sich nach dessen Plänen fürs Abendessen erkundigen zu wollen, obwohl Zach im vergangenen Jahr kein einziges Mal mit seinen Eltern gegessen hatte. Shep war allein im Haus. Er musste nicht jedes Mal aufschrecken, wenn die Heizung ansprang. Er musste nicht zitternd in der obersten Kommodenschublade nach seinen Boxershorts greifen, als würde man ihn im nächsten Moment am Handgelenk packen und ihm seine Rechte vorlesen.
Nur, dass Shep in gewisser Hinsicht tatsächlich ein Einbrecher war. Vielleicht sogar von der Sorte, wie sie jeder amerikanische Haushalt am meisten fürchtete. Er war etwas früher von der Arbeit nach Hause gekommen, um sich selbst zu stehlen.
Die Innentasche seines großen schwarzen Samsonite-Koffers lag mit offenem Reißverschluss auf dem Bett, so wie sie das auch bei den alljährlichen weniger dramatischen Abreisen getan hatte. Bislang bestand der Inhalt aus: einem Kamm.
Er zwang sich dazu, ein Reiseshampoo und sein Rasierset einzusammeln, wobei er bezweifelte, dass er sich im Jenseits noch rasieren würde. Mit der elektrischen Zahnbürste wurde es schon wieder schwierig. Es gab Strom auf der Insel, ganz bestimmt, aber er hatte herauszufinden versäumt, ob es die Stecker mit den zwei flachen amerikanischen Kontaktstiften waren, die klobigen britischen Dreierstifte oder aber die schlanke europäische Variante mit den weit auseinanderstehenden runden Stiften. Er hätte nicht mal genau sagen können, ob die Stromspannung 220 oder 110 Volt betrug. Schlamperei; genau diese praktischen Details hatten sie sich auf früheren Rechercheexpeditionen immer akribisch aufgeschrieben. Aber in letzter Zeit waren sie überhaupt weniger systematisch gewesen, vor allem Glynis, die auf jüngeren Auslandsreisen nachlässig geworden war und das Wort „Urlaub“ verwendet hatte. Es hätte ihm zu denken geben sollen, und nicht nur das.
Während ihm das misstönende Surren der Oral B im Kopf anfangs noch unangenehm gewesen war, hatte Shep irgendwann nach überstandener Mühe Geschmack an der Glattheit seiner Zähne gefunden. Wie bei jedem technologischen Fortschritt fühlte sich die Rückkehr zum alten Hin und Her der Handzahnbürste unnatürlich an. Aber was, wenn Glynis nach Hause kam, ins Badezimmer ging und feststellte, dass sein blau geringelter Aufsatz fehlte, während ihr rot geringelter noch immer neben dem Waschbecken stand? Es wäre besser, er würde nicht ausgerechnet an diesem Abend ihr Misstrauen wecken. Er hätte problemlos den Aufsatz von Zach nehmen können – er hatte den Jungen das Gerät noch nie benutzen hören –, aber dem eigenen Sohn die Zahnbürste zu entwenden brachte Shep nicht über sich. (Natürlich hatte Shep das Ding mit seinem Geld bezahlt, wie fast alles hier. Und doch fühlte sich nichts in diesem Haus an, als gehörte es ihm. Früher hatte ihn das gestört, aber umso leichter fiel es ihm jetzt, die Salatschleuder, den Heimtrainer und die Sofas zurückzulassen.) Schlimmer noch, er und Glynis benutzten dasselbe Aufladegerät. Er wollte sie nicht mit einer Zahnbürste zurücklassen, die fünf oder sechs Tage lief (er wollte sie überhaupt nicht zurücklassen, aber das war wieder eine andere Geschichte) und seiner Frau den langsam verklingenden Soundtrack zu ihrer neuesten Depression lieferte.
Nachdem er also mit wenigen Drehungen angefangen hatte, die Wandhalterung abzuschrauben, schraubte er sie wieder fest. Beschwichtigend schloss er seinen Zahnbürstengriff wieder an das Aufladegerät an und kramte eine manuelle Zahnbürste aus dem Medizinschränkchen. Er würde sich an den technologischen Rückschritt gewöhnen müssen, was bestimmt auf eine gewisse Weise, die er nicht ganz festmachen konnte, gut für die Seele war.
Es war nie seine Absicht gewesen, einfach die Zelte abzubrechen und das Weite zu suchen, sich ohne Vorankündigung oder Erklärung von seiner Familie loszumachen. Das wäre ja grausam, oder: noch grausamer. Er würde sie zumindest nicht ganz vor vollendete Tatsachen stellen, nicht einfach an der Haustür noch einmal winken. Offiziell würde er ihnen die Wahl geben, wofür er ehrlich gesagt einiges hingeblättert hatte. Die Chancen standen gut, dass er nichts als eine Illusion gekauft hatte, die für ihn persönlich allerdings noch von unschätzbarem Wert sein konnte. Also hatte er nicht nur ein Ticket, sondern gleich drei gebucht. Ohne Rückerstattung. Doch selbst wenn er mit seiner Intuition total danebenlag und Glynis überraschend zusagte, würde Zach noch immer nichts davon halten. Aber der Junge war fünfzehn Jahre alt, und apropos Rückentwicklungen: Ausnahmsweise mal würde ein amerikanischer Teenager machen, was man ihm sagte.
AUS LAUTER ANGST, auf frischer Tat ertappt zu werden, hatte er am Ende zu viel Zeit. Es waren noch ein paar Stunden, bis Glynis nach Hause käme, und der Samsonite-Koffer war voll. Angesichts der Verwirrung über die Stecker und Stromspannungen hatte er noch ein paar manuelle Werkzeuge und ein Schweizer Messer mit eingepackt; von einer Flachrundzange hatte man im üblichen Krisenfall mehr als von einem Blackberry. Nur wenige Hemden, ein paar wollte er zur Auswahl haben. Oder gar kein Hemd. Ein paar Dinge, von denen ein Mann seines Berufsstands wusste, dass sie zwischen zufriedenstellender Unabhängigkeit und der ganz großen Katastrophe entscheiden konnten: Klebeband; diverse Schrauben, Bolzen und Unterlegscheiben; Silikonfett; Dichtungsmittel; Gummibänder (Elastikbänder, wie sein Vater gesagt hätte, aus New Hampshire und von der alten Schule); eine kleine Rolle Draht. Eine Taschenlampe für Stromausfälle und einen Vorrat an Mignonbatterien. Einen Roman, den er sich genauer hätte aussuchen sollen, wenn er schon nur einen mitnahm. Ein Wörterbuch Englisch – Suaheli, Malariatabletten, Insektenschutz. Rezeptpflichtige Cortisonsalbe gegen das hartnäckige Ekzem an seinem Fußgelenk, wobei in der Tube nicht mehr sehr viel drin war.
Um es dabei belassen zu können, sein Merrill-Lynch-Scheckheft. Er sah sich selbst ungern als berechnenden Charakter, aber es stellte sich jetzt als günstig heraus, dass er dieses Konto immer nur auf seinen Namen geführt hatte. Er konnte – würde – ihr natürlich anbieten, ihr die Hälfte zu überlassen; sie hatte keine zehn Cents davon selbst verdient, aber sie waren verheiratet, und Gesetz war Gesetz. Er würde sie allerdings warnen müssen, dass sie selbst mit mehreren hunderttausend Dollar in Westchester nicht weit käme, und über kurz oder lang würde sie nicht mehr „ihre Arbeit“, sondern die eines anderen machen müssen.
Er musste den Samsonite-Koffer mit Zeitungspapier ausstopfen, damit das bisschen kläglicher Krimskrams im Gepäckraum der British-Airways-Maschine nicht hin und her klapperte. Er versteckte ihn in seinem Kleiderschrank und deckte ihn vorsichtshalber mit seinem Bademantel zu. Ein fertig gepackter Koffer auf dem Bett würde Glynis weitaus mehr beunruhigen als eine fehlende Zahnbürste.
Shep machte es sich zur Stärkung mit einem Bourbon im Wohnzimmer bequem. Eigentlich hatte er nicht die Gewohnheit, den Abend mit härteren Sachen einzuläuten als mit einem Bier, Gewohnheiten aber hätten die Dinge an diesem Abend auf unbestimmte Zeit verzögert. Er legte die Füße hoch, ließ den Blick durch das nett, aber billig möblierte Zimmer schweifen und bedauerte es bei keinem einzigen Gegenstand, dass er ihn würde zurücklassen müssen – abgesehen von dem Zimmerspringbrunnen. Über den Abschied von den Dekokissen oder dem gläsernen Wohnzimmertisch war er regelrecht froh. Der Zimmerspringbrunnen hingegen, der auf dem Tisch vor sich hin blubberte, hatte ihn immer mit einem ausgeprägten Mittelschichtsbegehren erfüllt, mit dieser Sehnsucht nach dem, was man ohnehin schon besitzt. Er fragte sich, einfach nur so, ob der Springbrunnen, eingepackt in das Zeitungspapier, das er zwischen seine karge Beute gestopft hatte, in den Samsonite-Koffer passen würde.
Sie nannten ihn immer noch den „Hochzeitsbrunnen“. Das Gerät aus Sterlingsilber hatte vor sechsundzwanzig Jahren bei der bescheidenen Versammlung von Freunden das mittlere Blumengesteck ersetzt und Arbeit, Begabung und, ja, Charakter von Braut und Bräutigam aufs Trefflichste verbunden. Bis heute stellte der Hochzeitsbrunnen das einzige Projekt dar, bei dem er und Glynis fifty-fifty zusammengearbeitet hatten. Shep hatte sich um die technischen Aspekte des Apparats gekümmert. Die Pumpe war gut versteckt hinter einem Bogen Hochglanzmetall, der sich um das Becken wickelte; da der Mechanismus dauerhaft in Betrieb war, hatte er ihn über die Jahre ein paarmal ersetzen müssen. Weil er sich mit Wasser auskannte, hatte er Glynis hinsichtlich Breite und Tiefe der Abflüsse und der Tropfenfallhöhe von Etage zu Etage fachkundig beraten. Glynis hatte die künstlerische Linie vorgegeben und in ihrem alten Studio in Brooklyn die Einzelteile geschmiedet und gelötet.
Für Sheps Geschmack war der Brunnen nüchtern; für Glynis’ Geschmack war er verschnörkelt; sogar stilistisch verkörperte die Konstruktion also ein Treffen der Denkweisen auf halbem Wege. Und der Brunnen war romantisch. Er war oben zusammengeschweißt, und zwei silberne Rinnen teilten sich und fügten sich wie Schwanenhälse erneut ineinander, der eine stützend, der andere sich öffnend, um sein Wasser in die wartende Schale des Gefährten zu ergießen. Ausgehend von einer schmalen Spitze, zogen sich die beiden Hauptlinien ihrer gemeinsamen Schöpfung schwungvoll in breiteren, immer verspielteren Variationen bis zum Becken hinunter. Dort bildeten beide Zuflüsse einen seichten überdachten See, der im buchstäblichen Sinne ein Sammelbecken darstellte. Handwerklich hatte Glynis auf höchstem Niveau gearbeitet. Egal, wie beschäftigt er gewesen war, Shep hatte ihrer Virtuosität die Ehre erwiesen und regelmäßig Wasser nachgefüllt und auch das Silber geputzt, damit der Gelbstich des Metalls nicht noch deutlicher wurde. Sobald er weg war, war es gut möglich, dass sie das Ding ausschalten und irgendwo in die Ecke stellen würde.
Als Allegorie vertraten die ein gemeinsames Becken füllenden Zuflüsse ein Ideal, an dem sie gescheitert waren. Nichtsdestotrotz nahm der Brunnen erfolgreich die Elemente ihrer jeweiligen Persönlichkeit auf. Glynis arbeitete nicht nur mit Metall (oder hatte es mal getan); sie selbst war aus Metall. Steif, unkooperativ und unflexibel. Hart, das Licht reflektierend und widerscheinend vor Trotz. Ihr Körper war lang, mager und eckig wie der Schmuck und das Besteck, das sie früher geschmiedet hatte – ihr Medium hatte sich Glynis auf der Kunstschule nicht zufällig ausgesucht. Sie identifizierte sich mit dem Material, das sich so erbittert gegen jede Handhabung wehrte, dessen Form gegen Veränderung resistent war und das lediglich auf starke Krafteinwirkung reagierte. Metall war aufmüpfig. Bei Misshandlung fing sich das Licht in den Dellen und Kratzern, als hegte es einen Groll.
Sheps Element, ob er wollte oder nicht, war das Wasser. Anpassungsfähig, leicht zu manipulieren und immer geneigt, den Weg des geringsten Widerstands zu nehmen. Shep schwamm mit dem Strom. Wasser war nachgiebig, fügsam und leicht einzufangen. Stolz war er auf diese Eigenschaften nicht; Biegsamkeit erschien ihm wenig männlich. Andererseits war die vermeintliche Passivität des Wassers ein Trugschluss. Wasser war findig. Wie jeder Hausbeitzer mit einem alternden Dach wusste, war Wasser auch heimtückisch; auf seine eigene Art konnte es sich seinen Weg durch alles hindurchbahnen. Wasser hatte eine ganz eigene, hinterlistige Sturheit, eine verstohlene, sickernde Beharrlichkeit, einen Instinkt dafür, die eine vergessene Naht oder offene Fuge zu finden. Früher oder später findet Wasser immer einen Weg hinein oder – wichtiger noch, in Sheps Fall – hinaus.
Die ersten Zimmerspringbrunnen seiner Kindheit, zusammengeschustert aus ungeeigneten Materialien wie Holz, leckten aufs Schlimmste, und sein sparsamer Vater hatte ihn wegen seiner verschwenderischen „Blubbergeräte“ getadelt. Doch Shep wurde erfinderischer und verbaute allerlei Fundstücke: angeschlagene Servierschüsseln, die Gliedmaßen der abgelegten Puppen seiner Schwester. Bis zum heutigen Tag hatte er sein Hobby gepflegt. Als Gegengewicht zur unerbittlichen Funktionalität seines Berufs hatten Zimmerspringbrunnen etwas wunderbar Frivoles.
Diese ausgefallene Freizeitbeschäftigung entstammte bestimmt nicht irgendeiner hochtrabenden Metapher für seinen Charakter, sondern ganz gewöhnlichen Kindheitsassoziationen. Jeden Juli hatten sich die Knackers eine Hütte neben einem rauschenden breiten Fluss in den White Mountains gemietet. Damals genossen Kinder noch das Privileg echter Sommer mit langen Strecken unverplanter Zeit, die sich bis in den diesigen Horizont hineinzogen. Eine Zeit, deren Endlosigkeit zwar eine Lüge, aber immerhin eine betörende Lüge war. Zeit zur Improvisation, Zeit, die man spielen konnte wie ein Saxofon. Also hatte er das Trällern von fließendem Gewässer stets mit Frieden, Gelassenheit und einem trägen Mangel an Druck verknüpft – in dessen Genuss die heutigen Kinder mit ihren Schulferienlagern, Nachhilfestunden, Fechtkursen und organisierten Spielterminen offenbar nicht mehr kamen. Und genau darum ging es ja im Jenseits, erkannte er nicht zum ersten Mal und schenkte sich einen weiteren Fingerbreit Bourbon ein. Er wollte seinen Sommer wiederhaben. Das ganze Jahr über.
KEINE SONNTAGSSCHULKLASSE, KEINE christliche Jugendgruppe hatte bei ihm angeschlagen, aber eine der wirklich charakterbildenden Maßnahmen, die Gabriel Knacker seinem Sohn hatte angedeihen lassen, war die Reise nach Kenia, als Shep sechzehn war. Unter der Ägide eines Austauschprogramms der Presbyterianer hatte der Pastor eine temporäre Stelle als Lehrer in einem kleinen Seminar in Limuru angenommen, eine gute Autostunde von Nairobi entfernt, und die Familie mitgenommen. Zu Gabe Knackers Verzweiflung hatten nicht etwa seine tiefgläubigen Seminarschüler den stärksten Eindruck bei seinem Sohn hinterlassen, sondern der Lebensmittelkauf. Auf dem ersten Proviantierausflug hatten Shep und Beryl ihre Eltern zum örtlichen Markt begleitet, um Papayas, Zwiebeln, Kartoffeln, Maracujas, Bohnen, Zucchini, ein mageres Hühnchen und ein Riesenstück undifferenzierbares Rindfleisch zu kaufen: alles in allem genug Nahrung, um fünf Einkaufsnetze prall zu füllen. Stets die Finanzen im Blick – noch heute musste sich Shep von seinem Vater anhören, er denke immer nur an Geld –, rechnete Shep im Kopf die Shillinge in Dollar um. Die ganze Fuhre hatte weniger als drei Dollar gekostet. Selbst für die Währungsverhältnisse von 1972 war das, für mehr als einen Wochenvorrat, eine lächerliche Summe.
Shep hatte seine Bestürzung darüber zum Ausdruck gebracht – wie konnten die Händler mit so miserablen Preisen überhaupt Profit machen? Sein Vater hatte betont, dass diese Menschen sehr arm seien; ganze Landstriche des umnachteten Kontinents kämen mit weniger als einem Dollar pro Tag aus. Doch der Pastor räumte ebenfalls ein, dass die afrikanischen Bauern Pennybeträge für ihre Ware verlangen konnten, weil sie ihre Ausgaben ebenfalls in Pennybeträgen rechneten. Der Wert eines Dollars war demnach nichts Feststehendes, sondern relativ. Zu Hause in New Hampshire bekäme man dafür eine Schachtel Büroklammern; auf dem kenianischen Land ein zwar gebrauchtes, aber voll funktionstüchtiges Fahrrad.
„Wieso nehmen wir dann nicht unser Erspartes und ziehen hierher?“, hatte Shep gefragt, während sie ihren Einkauf über den Feldweg der Farm schleppten.
In einem seltenen Moment der Milde hatte Gabe Knacker seinem Sohn auf die Schulter geklopft und den Blick über die in flammende äquatoriale Sonne getauchten üppigen Kaffeefelder schweifen lassen. „Das frage ich mich auch.“
Shep bekam die Frage nicht wieder aus dem Kopf. Wenn man in Ostafrika mit einem Dollar pro Tag zumindest über die Runden käme, wie gut ließe es sich dann erst mit zwanzig Dollar leben ?
Schon auf der Highschool hatte Shep mühsam nach Orientierung gesucht. Doch leider war er, genau wie heute sein Sohn Zach, in allen Fächern gut, aber in keinem hervorragend gewesen. In einer Zeit, die der Beherrschung des Abstrakten immer mehr Wert beimaß – bis zur benebelnden Welt der „Informationstechnologie“ waren es nur noch zehn Jahre hin –, bevorzugte Shep diejenigen Aufgaben, deren Ergebnisse er sowohl im Kopf als auch mit den Händen nachvollziehen konnte : ein klappriges Geländer austauschen zum Beispiel. Doch sein Vater war ein gebildeter Mann und erwartete etwas anderes von seinem Sohn, als Handwerker zu werden. Mit seinem wässrigen Herzen hatte Shep als Kind nie rebelliert. In Anbetracht seiner Neigung zum Bauen und Reparieren schien ein Ingenieursstudium das Naheliegende zu sein. Wie er seinem Vater seitdem immer wieder versicherte, hatte er wirklich, ehrlich studieren wollen.
Doch inzwischen war aus der in Limuru geborenen Laune ein fester Entschluss geworden. Sparen mochte aus der Mode gekommen sein, aber ein amerikanisches Mittelschichtsgehalt würde es doch gewiss zulassen, dass man ein wenig Geld auf die hohe Kante legte. Mit Betriebsamkeit, Fleiß und Bescheidenheit – die einstigen moralischen Stützpfeiler des Landes – sollte es doch möglich sein, ein finanzielles Pölsterchen zur Größe eines Rettungsrings aufzublasen und irgendwann einfach ins nächste Flugzeug zu steigen. Ausverkauf in der Dritten Welt: zwei Leben zum Preis von einem. Leben A und Leben B. Seit er volljährig war, hatte Shep sich der Verwirklichung von Leben B gewidmet. Er war nicht mehr sicher, ob der Begriff Fleiß noch passte, wenn man dermaßen hart arbeitete, nur um irgendwann nicht mehr arbeiten zu müssen.
Im Hinblick auf sein wahres Ziel – nämlich Geld – hatte es Shep also instinktiv dorthin gezogen, wo Amerika das meiste davon verwahrte : Er bewarb sich am City College of Technology in New York. Eine Zeit lang nannte Gabe Knacker seinen Sohn charakterlos und beschimpfte ihn wegen seiner Anbetung des Mammon als „Philister“, während Shep überzeugt war, dass Geld – das Netzwerk der finanziellen Beziehungen zwischen dem Individuum und der Welt als Ganzem – eben gerade ein Zeichen von Charakter war; dass sich die Ambitionen eines Mannes am besten danach beurteilen ließen, wie er mit seinem Verdienst verfuhr. Insofern rührte er als anständiges, halbwegs begabtes Kind auch nicht das magere Gehalt seines Vaters als Kleinstadtpastor an (ein Schritt, dem sich Beryl nicht anschloss, als sie vier Jahre später ungeniert von ihrem Vater verlangte, ihr ein Filmstudium an der NYU zu finanzieren). Seit er mit neun Jahren seine ersten fünf Dollar fürs Schneeschippen verdient hatte, war Shep immer für sich selbst aufgekommen, sei es für einen Schokoriegel, sei es für seine Ausbildung.
Da er also entschlossen war, zunächst arbeiten zu gehen und sich sein Studium dann selbst zu finanzieren, hatte er seinen Studienbeginn am City Tech in Downtown Brooklyn aufgeschoben und sich in der Nähe von Park Slope eine Einzimmerwohnung gesucht, einer damals – heute schwer vorstellbar – schäbigen Gegend, und unsagbar billig. Der Wohnungsbestand im Bezirk war heruntergekommen und wimmelte von Familien, die kleinere Reparaturarbeiten vornehmen lassen mussten und sich die halsabschneiderischen Stundenlöhne der gewerkschaftlich organisierten Handwerker nicht leisten konnten. Da er sich im Zuge seiner Mithilfe beim Erhalt des ewig bröckelnden spätviktorianischen Elternhauses in New Hampshire allerhand rudimentäre Elektriker- und Tischlerfähigkeiten angeeignet hatte, hängte Shep in den Lebensmittelläden Flugblätter auf und bot seine Dienste als Handwerker von der alten Schule an. Über Mundpropaganda wurde schnell bekannt, dass da ein junger Weißer war, der zu bescheidenen Preisen Dichtungsringe austauschen und morsche Dielen ersetzen konnte, und schon bald wuchs ihm die Arbeit über den Kopf. Als er den Studienbeginn an der City Tech um ein zweites Jahr verschob, hatte er eine Firma gegründet und beschäftigte als „Der Allrounder“ bereits die ersten Teilzeitkräfte. Zwei Jahre später stellte Shep seinen ersten Vollzeitmitarbeiter ein. Als gestresster Unternehmer genoss Shep wenig Freizeit, und außerdem hatte er gerade geheiratet. Aus reinen Effizienzgründen fungierte Jackson Burdina deshalb nicht nur als Arbeitskollege, sondern, damals wie heute, zudem als sein bester Freund.
Dass Shep nie studiert hatte, war seinem Vater noch immer ein Dorn im Auge, wenn auch unsinnigerweise; der Allrounder hatte expandiert und gedieh auch ohne akademischen Segen.
Das eigentliche Problem war, dass Gabriel Knacker von körperlicher Arbeit nichts hielt – es sei denn, es ging darum, mit dem Friedenskorps für verarmte Dorfbewohner in Mali einen Brunnen auszuheben oder aus reiner Nächstenliebe einem Renter das Dach auszubessern. Für Geldangelegenheiten hatte er keinen Sinn. Er verurteilte jede Tätigkeit, die nicht in direktem Sinne tugendhaft war. Dass eine Welt, in der sich jeder nur dem Guten als Selbstzweck verschrieb, vermutlich rasant zum Stillstand käme, kümmerte den Mann nicht im Geringsten.
Bis vor etwas mehr als acht Jahren hatte Leben A durchaus seine Vorzüge gehabt. Shep hatte nicht das Gefühl, dass er die beste Zeit seines Lebens einem Luftschloss opferte. Körperliche Arbeit hatte ihm immer zugesagt, schon immer hatte er eine gewisse Form von Erschöpfung zu schätzen gewusst, die sich nicht etwa im Fitnessstudio, sondern eher beim Bau von Bücherregalen einstellte. Es gefiel ihm, sein eigener Chef zu sein und niemandem Rechenschaft ablegen zu müssen. Auch wenn sich Glynis als ein anstrengender Charakter entpuppte und sich selbst niemals als glücklich bezeichnet hätte, ließ sich wahrscheinlich behaupten, dass sie mit ihm glücklich war – zumindest so weit, wie sie es eben sein konnte mit einem anderen Menschen. Er war froh, als sie sofort mit Amelia schwanger wurde. Er hatte es eilig, wollte unbedingt in der Hälfte der üblichen Zeit durch sein Leben rasen; es wäre ihm weitaus lieber gewesen, wenn Zach gleich im Anschluss geboren worden wäre und nicht erst zehn Jahre später.
Was das Jenseits betraf, hatte Glynis in der Anfangszeit den Eindruck gemacht, dass sie mit von der Partie sei. Sein Status als Mann mit Mission hatte ihn in ihren Augen wohl überhaupt erst attraktiv gemacht. Ohne seine Vision, ohne das immer konkretere Leben-B-Konstrukt, das in seinem Kopf Gestalt annahm, war Shep Knacker nur einer von vielen Kleinunternehmern, die eine kleine Marktnische entdeckt hatten: also nichts Besonderes. So aber war die Suche nach einem Zielland in Form der allsommerlichen Recherchereise ein belebendes Ritual ihrer Ehe gewesen. Sie waren ein Team, oder zumindest hatte er das geglaubt, bis ihm im letzten Jahr allmählich zu dämmern begann, dass das Gegenteil der Fall war.
Als ihm also im November 1996 ein Kaufangebot gemacht wurde, konnte er nicht widerstehen. Eine Million Dollar. Nüchtern betrachtet erkannte er, dass eine Million nicht mehr das war, was es einmal gewesen war, und dass er Kapitalgewinnsteuer würde zahlen müssen. Dennoch war die Summe noch immer eine ehrfurchtgebietend runde Nummer; ganz gleich, wer alles „Millionär“ wurde, das Wort hatte nichts von seinem Zauber verloren. Zusammen mit den Früchten seines lebenslangen Knauserns würde der Erlös aus dem Verkauf von Allrounder genügend Kapital einbringen, um nie wieder zurückblicken zu müssen. Also spielte es keine Rolle, dass der Käufer – ein Angestellter so faul und schlampig, dass sie den Kerl fast entlassen hätten, bis er zu aller Überraschung an seinen Treuhandfonds kam – ein unerfahrener Großkotz und Schwätzer war.
Und dieser Mensch, Randy Pogatchnik, war jetzt Sheps Chef. Nun ja, anfangs erschien es schon sinnvoll, in seiner ehemals eigenen Firma als Angestellter weiterzuarbeiten – die über Nacht „Handy Randy“ getauft worden war, ein Name, der wohl kaum ein professionelles Firmenimage vermittelte, da „randy“ in den Ohren nicht weniger Amerikaner etwas anzüglich klang: rallig. Die ursprüngliche Idee war gewesen, ein bis zwei Monate dabeizubleiben, um in Ruhe zu packen, diverses Hab und Gut zu verkaufen und zumindest fürs Erste ein Haus in Goa zu finden. Unterdessen hatte Shep das Kapital in bombensicheren Investmentfonds geparkt, um es vor der Schlachtung noch ein wenig zu mästen; der Dow Jones war im Höhenflug.
„Anrührend, komisch, erbarmungslos.“
„›Dieses Leben, das wir haben‹ müssen Sie sich ebenso merken wie die unvergesslich gute Autorin Lionel Shriver. (…) Ein Buch über unser Versagen, wenn es ans Sterben geht. Und die Frage: Wie viel ist uns ein Leben wert? Mit einem so versöhnlichen Ende, dass es schon wieder eine Provokation ist.“
„Einfühlsam. Lionel Shriver schreibt zynisch und zärtlich über Leben, Tod und Seelenheil.“
„Die Romane von Lionel Shriver sind eine Sensation, das gilt auch für ihren neuesten.“
„Intensiv, wahrhaftig und schrecklich ehrlich ist dieser Roman, aber immer auch literarisch aufregend und psychologisch fesselnd.“
„Einzigartige Erzählung über das atemlose Leben des Bürgertums im Hamsterrad.“
„Das spannende und dramatische Porträt einer Ehe, der eine andere Ehe gegenüber gestellt wird, in der der Eigennutz längst die Gemeinsamkeit verdrängt hat.“
„In ›Dieses Leben das wir haben‹ stellt Lionel Shriver die provozierende Frage, wie viel uns ein Menschenleben wert ist. Mit einem sehr tröstlichen Ende, für das ich die amerikanische Autorin jetzt noch bewundere.“
„Lionel Shriver erzählt (…) mit umwerfender Sprachgewalt.“
„Lionel Shriver erzählt die tragische Geschichte dieser Ehe mit genau jener Balance aus Zartgefühl und Humor, die auch die Liebe braucht.“
„Seine großen Themen verhandelt der Roman pragmatisch, auf sachlicher, sinnlicher, unmittelbarer Ebene. (…) Es sind die vermeintlich kleinen, beiläufigen Beobachtungen, die bei Shriver eine eigene Wucht entfalten. (…) So direkt und gradlinig Shrivers Prosa daherkommt, so wahrhaftig ist ihre Charakterzeichnung.“


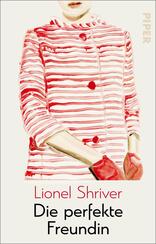











DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.