
Domina (Maestra 2) — Inhalt
Judith Rashleigh hat ihr Ziel erreicht: den Aufstieg von der machtlosen Assistentin eines Auktionshauses zur international erfolgreichen Kunsthändlerin. Zwar ist sie dabei über Leichen gegangen, aber ihr neues Leben als begehrte Galeristin in Venedig ist genau das, wovon sie immer geträumt hat. Und die pikanten Dienste, die hinter den verschlossenen Türen der High Society angeboten werden, sind ganz nach Judiths Geschmack. Doch schon bald wird ihre Vergangenheit sie einholen – und einmal mehr spielt Judith Rashleigh mit dem heißen, zügellosen Feuer …
Leseprobe zu „Domina (Maestra 2)“
Prolog
Ich wollte es einfach nur hinter mich bringen, aber ich zwang mich, ganz langsam zu machen. Ich schloss die Fensterläden an allen drei Fenstern, machte eine Flasche Gavi auf, füllte zwei Gläser und zündete die Kerzen an. Vertraute, wiedererkennbare und tröstliche Rituale. Er stellte seine Tasche ab, zog langsam die Jacke aus und hängte sie über eine Stuhllehne, ohne mich aus den Augen zu lassen. Wortlos hob ich mein Glas und nahm einen Schluck. Seine Augen glitten über die Bilder, während ich das Schweigen zwischen uns so lange ausdehnte, bis er [...]
Prolog
Ich wollte es einfach nur hinter mich bringen, aber ich zwang mich, ganz langsam zu machen. Ich schloss die Fensterläden an allen drei Fenstern, machte eine Flasche Gavi auf, füllte zwei Gläser und zündete die Kerzen an. Vertraute, wiedererkennbare und tröstliche Rituale. Er stellte seine Tasche ab, zog langsam die Jacke aus und hängte sie über eine Stuhllehne, ohne mich aus den Augen zu lassen. Wortlos hob ich mein Glas und nahm einen Schluck. Seine Augen glitten über die Bilder, während ich das Schweigen zwischen uns so lange ausdehnte, bis er es unterbrach.
„Ist das ein …?“
„Ein Agnes Martin“, vollendete ich seinen Satz. „Genau.“
„Sehr schön.“
„Danke.“ Ein amüsiertes Lächeln spielte auf meinen Lippen. Neuerliches Schweigen. Die wattige Stille des nächtlichen Venedig wurde nur von den Schritten unterbrochen, die unten den campo überquerten. Wir wandten beide den Kopf zum Fenster.
„Wohnst du schon lange hier?“
„Eine Weile“, erwiderte ich.
Die Keckheit, die er vorhin in der Bar an den Tag gelegt hatte, war verschwunden. Er wirkte verlegen und schrecklich, schmerzlich jung. Sah ganz so aus, als würde ich den ersten Schritt tun müssen. Wir standen zwei Schritte auseinander. Ich trat nach vorn und hielt dabei seinen Blick fest. Kapierte er, was ich ihm sagen wollte?
Lauf weg, bedeutete es. Lauf weg und schau nicht zurück.
Ich machte einen zweiten Schritt und streckte die Hand aus, um ihm über die stopplige Wange zu streicheln. Langsam, ohne meinen Blick von seinem Gesicht abzuwenden, beugte ich mich vor, berührte mit der Nase seine Wange und ließ meine Lippen seitlich über seine gleiten, bis seine Zunge endlich meine fand. Er schmeckte nicht so schlecht, wie ich erwartet hatte. Ich zog mich wieder zurück, um mir das Kleid über den Kopf zu streifen und es in einer einzigen Bewegung auf den Boden zu werfen, gefolgt von meinem BH. Dann strich ich meine Haare nach hinten und ließ die Handflächen langsam über meine Brustwarzen gleiten.
„Elisabeth“, murmelte er.
Die Badewanne stand am Ende des Bettes. Als ich die Hand ausstreckte und ihn um die Wanne herum zu meinem Frette-Bettzeug führte, spürte ich, wie eine erstickende Welle von Müdigkeit über mich hinwegging, ganz ohne das Gefühl, das mir einmal so vertraut gewesen war. Ich hatte keine Wut mehr in mir und auch keinen Funken Begehren. Ich ließ ihn machen, und als er fertig war, setzte ich mich mit einem Kichern in der Stimme auf und ließ meine Augen funkeln. Ich durfte nicht zulassen, dass er mir eindöste. Ich ließ mich auf die feuchten Laken fallen und ließ das schlaffe Kondom mit dem jämmerlich kleinen Lebendgewicht auf den Boden fallen und streckte die Hand nach dem Heißwasserhahn aus.
„Ich hab Lust auf ein Bad. Ein Bad und einen Joint. Und du?“
„Klar. Immer doch.“ Nach dem Vögeln hatte er prompt seine Manieren abgelegt. „Wollen wir jetzt die Fotos machen?“ Vorhin im Café hatte ich ihn davon abbringen können, Fotos von mir zu schießen. Jetzt fummelte er in seiner achtlos auf den Boden geworfenen Jeans schon wieder nach seinem Scheißhandy. Ein Wunder, dass er seinen Höhepunkt nicht bereits auf Instagram eingestellt hatte. Für den kurzen Augenblick, den er auf mir lag und mich stieß, hatte ich ganz vergessen, was für ein Riesentrottel er war. Auf einmal fühlte sich alles so viel leichter an.
„Das können wir machen, mein Lieber. Warte mal eben.“ Ich trabte nackt ins Ankleidezimmer und wühlte in einer Schublade nach einem Heftchen Zigarettenpapier. Dabei zog ich vorsichtshalber den Stecker meines WiFi-Scramblers. Für ihn würde es keine Updates in Echtzeit mehr geben. Ich ließ ein bisschen kaltes Wasser zulaufen, gab einen Schuss Mandelöl in die Wanne und öffnete den schweren antiken Wäscheschrank, um ein paar Handtücher herauszunehmen.
„Spring doch schon mal rein“, sagte ich über die Schulter, während ich den Tabak aus einer Zigarette herausbröselte. Er ließ sich ins Wasser gleiten.
„Ich hol nur schnell ein Feuerzeug“, murmelte ich. „Hier.“
Ich steckte ihm den Joint zwischen die Lippen, doch noch während er inhalierte, legte ich ihm meinen Hermès-Schal, den ich vor unserem Treffen an den Griff meiner Handtasche geknotet hatte, um den Hals und zog fest zu. Er verschluckte sich sofort am Rauch und drosch mit den Händen aufs Wasser ein. Ich stemmte meine Füße gegen die Badewanne, lehnte mich zurück und zog noch fester zu. Er zappelte mit den Beinen, fand aber keinen Halt am öligen Porzellan. Ich schloss die Augen und begann zu zählen. Seine Rechte, die absurderweise immer noch den Joint hielt, versuchte vergeblich, mich am Handgelenk zu packen, aber er erwischte den richtigen Winkel nicht, und seine Finger streiften mich nur kurz.
Fünfundzwanzig … sechsundzwanzig … Während wir miteinander rangen, spürte ich nur das anaerobe Prickeln in meinen Muskeln, nur meine eigenen geräuschvollen Atemzüge in den Nasenlöchern, während er wild im Wasser strampelte. Neunundzwanzig, keine große Sache, dreißig, keine große Sache. Ich spürte, wie er nachließ, aber es gelang ihm doch noch, einen Finger und dann eine ganze Faust zwischen den Schal und seinen Adamsapfel zu zwängen, und er schleuderte mich mit aller Macht nach vorne. Dabei rutschte er allerdings selbst unter die Wasseroberfläche. Ich drehte mich um hundertachtzig Grad, landete in der Wanne und legte ihm das linke Knie auf die Brust, um ihn mit meinem ganzen Gewicht nach unten zu drücken.
In meinem Auge und im dampfenden Wasser war Blut, doch ich konnte noch Blasen aufsteigen sehen, während er sich weiter wehrte. Ich ließ den Schal los und griff blindlings nach unten, zu seinem Gesicht und seinem Hals. Er schob die Kiefer vor und versuchte, nach meiner Hand zu schnappen. Dann hörten die Blasen auf. Langsam kam ich wieder zu Atem, und meine verzerrten Züge entspannten sich. Ich konnte sein Gesicht durch das milchige Hellrosa des Badewassers nicht sehen. Vorsichtig bewegte ich mein Becken vorwärts, da schlug mir das Wasser auf einmal in einer Riesenwelle entgegen, als er sich unter mir aufrichtete. Ich ließ mich rittlings auf ihn fallen, während er verzweifelt den Kopf zu heben versuchte. Es gelang mir, ihn mit dem Ellbogen wieder hinunterzudrücken, dann rutschte ich so weit hoch, bis ich jeweils ein Bein auf seinen Schultern hatte. So blieben wir eine ganze Weile, bis eine Träne aus Blut von meinem Gesicht in die Wanne fiel.
Vielleicht war es die Klarheit dieses einen winzigen Geräuschs. Vielleicht war es die Wolke von Mandelöl im kreiselnd aufsteigenden Dampf oder die abkühlenden Hautschüppchen auf der Wasseroberfläche. Jener kalte Nachmittag damals, jene endlose Stille, jenes erste tote Ding unter meinen Händen. Die Verwerfungslinie in meinem Inneren öffnete sich zu einem klaffenden Abgrund, und mit einer Kraft, die den Atem aus mir presste, wurde ich dorthin zurückkatapultiert. Auf einmal war die Zeit wie komprimiert, die Vergangenheit verdichtete sich und kam zu mir.
Es war so lange her, dass ich sie verlassen hatte. Sie war nie ein Teil meines Lebens gewesen, hatte ich mir selbst eingeredet, aber jetzt sah ich sie gerade wie zum ersten Mal. Benommen griff ich wieder ins tiefe Wasser, doch ich fand nur das Fleisch eines Fremden. Diese Sache hier war notwendig gewesen, obwohl ich mich gerade nicht mehr an den Grund erinnern konnte. Seine Hand stieg zur Wasseroberfläche empor, und ich klopfte ihm auf die Finger, in einer wässrigen kleinen Melodie. Es mochten ein paar Minuten vergangen sein, in denen ich die leisen Wellen auf dem Wasser beobachtete, vielleicht aber auch eine Stunde. Bis ich wieder zu mir kam, war das Badewasser kalt.
Als ich ihn irgendwann hochzog, waren seine Augen offen. Das Letzte, was er von dieser Erde gesehen hatte, war meine offene Möse gewesen.
Seine glitschige Haut war rosarot und aufgequollen, seine Lippen waren bereits grau. Sein Kopf fiel nach hinten, im Kerzenlicht zeigte seine Kehle keinerlei Spuren. Ich hielt mich am Wannenrand fest und kletterte mit zitternden Beinen hinaus. Als ich ihn losließ, rutschte er wieder unter Wasser, und ich musste unter seinem hin und her wabernden Haarschopf nach dem Badewannenstöpsel tasten. Während das Wasser ablief, schmiegte ich mich in ein Handtuch. Als seine Brust auftauchte, legte ich ihm eine Hand aufs Herz. Nichts. Ich richtete mich auf und streckte mich. Der Boden war pitschnass, der Badewannenrand von Blut und Tabakkrümeln verunreinigt. Mit etwas heißem Wasser säuberte ich ihn.
Ich musste ihn von der Seite in den Arm nehmen, um ihn über den Wannenrand hieven zu können. Er war ganz schlaff. Als ich ihn auf den Boden gelegt hatte, bedeckte ich ihn mit dem anderen Handtuch und setzte mich im Schneidersitz neben ihn, bis er ganz kalt war.
Dann zog ich das Handtuch von seinem Gesicht, beugte mich vor und flüsterte ihm ins Ohr:
„Ich heiße nicht Elisabeth. Ich heiße Judith.“
1. Reflexion
1. Kapitel
Acht Wochen zuvor …
Während ich mich anzog, hörte ich Cole Porters Miss Otis Regrets, in der Version von Ella Fitzpatrick. Sie brachte mich immer zum Lächeln. Ich hatte das Schlafzimmer meiner Wohnung am Campo Santa Margherita in ein Ankleidezimmer umgewandelt und Molteni-Schränke mit Glastüren hineingestellt, sodass meine Schuhe, Taschen, Schals und Kleider und Jacken immer alle schön sichtbar waren. Auch das brachte mich zum Lächeln. Die Wohnung lag im Hochparterre, und von den Fenstern blickte man auf den Platz mit seinem alten Fischmarkt und dem Pflaster aus weißen Steinen.
Im Wohnzimmer hatte ich eine Wand herausbrechen lassen, um einen einzigen großen Raum zu schaffen. Am Fuß meines Bettes stand auf einem dicken grünen Marmorsockel die Badewanne, vor einem der drei Bogenfenster. Mein Badezimmer, das mit antiken persischen Kacheln gefliest war, hatte ich hinter dem Ankleidezimmer an die Stelle bauen lassen, wo sich vorher ein Treppenhaus befunden hatte. Das war eine der vielen Freuden der Wohnung von Elisabeth Teerlinc. Der Architekt hatte so einiges in seinen Bart geknurrt, von wegen Stützbalken und Genehmigungen, aber in den neun Monaten, die ich inzwischen in Venedig war, hatte ich festgestellt, dass man mit sündiger Währung so einiges möglich machen konnte. Die Bilder, die ich in Paris erworben hatte – den Fontana, das Gemälde Susanna und die beiden Alten sowie die Cocteau-Zeichnung –, hatte ich aufgehängt und noch ein modernes Stück, ein kleines Werk ohne Titel von Agnes Martin in Weiß mit wolkengrauen Linien, das ich über Paddle8, das Online-Auktionshaus in New York, gekauft hatte. Meine anderen französischen Werke hatten mich ebenfalls hierherbegleitet, mit Ausnahme der kopflosen Leiche von Renaud Cleret, die sich in einer zugenagelten Kiste in einem Lagerraum für Kunstwerke in der Nähe des Château de Vincennes befand. Mal ganz abgesehen davon, was der Architekt dachte – ich machte mir ab und zu tatsächlich Sorgen um Lecks.
Die handgeschriebene Einladung zu meiner ersten Ausstellung steckte an einer Ecke meines Spiegels. Elisabeth Teerlinc hat die Ehre, Sie in die Gentileschi Gallery zu bitten … Ich überflog die Worte noch einmal, während ich mir die Haare hochsteckte. Ich hatte es geschafft. Ich war jetzt Elisabeth. Judith Rashleigh war für mich nicht einmal mehr ein Phantom, kaum mehr als ein Name auf dem unbenutzten Pass, der in meiner Schreibtischschublade lag.
Ich ließ die Hand über die ordentlich aufgehängten Kleider gleiten, genoss die Glätte von Jersey und das geschmeidige Gewicht guter Seide. Für die Ausstellungseröffnung hatte ich mir ein tailliertes tiefschwarzes Kleid von Figue aus Shantungseide ausgesucht. Am Rücken wurde es mit winzigen türkis-goldenen Knöpfen geschlossen und war im Stil eines traditionellen chinesischen Kleides gehalten. Die Farbe des Stoffes glühte, als ich ihn zwischen den Fingern drehte. Ich setzte auf den strengen Look der traditionellen Galeristin, aber irgendwo tief in meinem Innersten steckte ein kleines Einhorn, das ungeduldig die Mähne schüttelte. Ich schenkte meinem Spiegelbild ein leises Lächeln. Liverpool war weit, weit weg.
Einer der kurzlebigen Jobs meiner Mutter war eine Putzstelle in der Nähe von Sefton Park, in dieser selbstbewussten viktorianischen Enklave aus Bäumen und Glashäusern in Zentrumsnähe, drei Busse von unserer Wohnsiedlung entfernt. Eines Tages, als ich ungefähr zehn Jahre alt war, stellte ich bei Schulschluss fest, dass ich meinen Hausschlüssel vergessen hatte, und ich beschloss, meine Mutter an ihrer Arbeitsstelle aufzusuchen.
Die Häuser waren riesig, bestanden aus unzähligen roten Ziegeln und Erkerfenstern. Ich drückte mehrmals auf die Klingel, aber niemand machte auf, deswegen probierte ich es an der Klinke, und tatsächlich war die Tür nicht abgeschlossen. Im Flur roch es nach Möbelpolitur und ganz leicht nach Blumen, die Bodendielen waren nackt bis auf ein helles Teppichviereck, und der Raum zwischen den Türen und dem ausladenden, geschwungenen Treppenhaus war mit Regalen voll dicker, schwerer Bücher gefüllt. Es war so still. Sobald ich die Tür leise hinter mir zugemacht hatte, hörte ich kein Summen von Fernsehern, kein Stakkatogeschrei von streitenden Paaren oder spielenden Kindern, keine laufenden Motoren oder raufende Haustiere. Nur … Stille. Ich hätte gern die Hand ausgestreckt und die Buchrücken berührt, doch ich wagte es nicht. Noch einmal rief ich nach meiner Mutter, und sie erschien in dem Trainingsanzug, den sie immer anzog, wenn sie putzen ging.
„Judith! Was machst du denn hier? Ist alles in Ordnung?“
„Ja. Ich hab bloß meinen Schlüssel vergessen.“
„Du hast mich zu Tode erschreckt! Ich dachte, es wäre ein Einbrecher.“ Sie rieb sich müde übers Gesicht. „Du musst etwas warten. Ich bin noch nicht fertig.“
Am Fuß der Treppe stand ein breiter Stuhl und daneben eine große Lampe. Ich knipste die Lampe an, und der Raum verdichtete sich, schimmerte um mich herum, ganz still und privat. Ich schüttelte meinen Rucksack von den Schultern und stellte ihn ordentlich unter den Stuhl, dann ging ich wieder an die Regale. Ich glaube, ich suchte das Buch aus, weil mir die Farbe des Rückens gefiel, ein knalliges Rosa, von dem sich der Titel in Goldbuchstaben abhob. Vogue, Paris, 40 ans, stand dort. Es war ein Modebuch mit Abbildungen von Frauen, die außergewöhnliche Kleider und Schmuck trugen und deren Gesichter perfekte Make-up-Masken waren. Langsam blätterte ich um, ganz gebannt von den prächtigen, erlesenen Farben. Ein Bild zeigte eine Frau in einem hellblauen Ballkleid mit riesigem Rockteil, die durch den Straßenverkehr rannte, als würde sie ihrem Bus hinterherlaufen. Hingerissen blätterte ich weiter und schaute, blätterte weiter und schaute.
Mir war gar nicht bewusst, wie viel Zeit vergangen war, bis ich auf einmal merkte, dass ich schrecklichen Hunger hatte. Ich rappelte mich hoch und legte das Buch behutsam auf die Sitzfläche des Stuhls, als jäh die Tür aufflog. Ich fuhr zusammen und stand leicht geduckt und mit schuldbewusster Miene da.
„Was machst du hier?“ Die scharfe Stimme einer Frau, mit einem Unterton von Angst.
„Entschuldigung. Es tut mir leid. Ich bin Judith. Ich hab meinen Hausschlüssel vergessen. Ich warte hier auf meine Mum.“ Ich deutete mit einer vagen Geste zur Tür, die meine Mutter vor gefühlten Stunden geschluckt hatte.
„Ah. Verstehe. Ist sie noch nicht fertig?“
Sie bedeutete mir, ihr durch einen Gang in den rückwärtigen Teil des Hauses zu folgen, der sich zu einer großen, gemütlichen Küche öffnete.
„Hallo?“
Hinter dem Tisch stand ein Sofa, dessen bunte Kissen auf dem Boden lagen und meiner Mum Platz gemacht hatten.
„Hallo?“
Ich glaube, ich hatte die Weinflasche auf dem Boden noch vor ihr entdeckt, doch der resignierte Ton, den die Dame des Hauses angeschlagen hatte, verriet mir, dass dies nicht das erste Mal war. Meine Mutter musste den Wein aus dem Kühlschrank stibitzt haben.
„Hab mich nur mal kurz hingelegt.“
Ich erglühte in kalter Scham. Die Dame ging zum Sofa und half meiner Mutter, sich aufzusetzen, energisch, aber nicht unfreundlich.
„Wir haben schon mal darüber gesprochen, oder? Es tut mir leid, aber ich denke, Sie waren heute zum letzten Mal hier, meinen Sie nicht auch? Ihre Tochter ist hier.“ Ihrem Tonfall war anzumerken, dass ich ihr leidtat.
„Entschuldigung, ich hab mich nur …“ Mum zupfte an ihrem Trainingsanzug und versuchte, sich zu rechtfertigen.
„Schon gut.“ Jetzt schon etwas strenger. „Aber Sie sollten jetzt besser gehen. Bitte holen Sie Ihre Tasche, und ich bringe Ihnen Ihr Geld.“ Sie war überhaupt nicht gemein, das war es ja gerade. Ihr war das, was sie da tat, sichtlich unangenehm, und ihr kontrollierter, professioneller Ton sollte ihr Unbehagen kaschieren und uns auf die Straße hinausschieben, wo wir unsere Garstigkeiten untereinander ausmachen konnten.
Ich ging zurück und stellte mich mit der Schultasche neben die Tür. Ich wollte gar nicht mehr zuhören. Als die Dame meiner Mutter zwei Zwanzig-Pfund-Scheine gab, muss sie gesehen haben, dass meine Augen wieder zu dem Buch wanderten.
„Möchtest du das vielleicht mitnehmen? Als kleines Geschenk?“ Sie drückte es mir in die Hand, ohne mich anzuschauen. Sie gab es mir, als wäre es nichts.
„Blöde Kuh“, murmelte meine Mutter, während sie mich zur Bushaltestelle schleifte.
Als wir irgendwann zu Hause waren, gab sie mir ihren Schlüssel und stieg vor mir aus, an der Haltestelle neben der Kneipe. Ich dachte mit Nervosität an die vierzig Pfund. Von denen würden wir so schnell nichts mehr sehen. Ich machte mir Bohnen auf Toast und zog dann das Buch aus der Tasche. Innen stand der Preis – sechzig Pfund. Sechzig Pfund für ein Buch. Und die Dame hatte es einfach so verschenkt. Ich verstaute das Buch sorgfältig unter meinem Bett, und im Laufe der nächsten Zeit schaute ich es mir so oft an, dass ich die Namen der Fotografen und Modedesigner bald auswendig kannte. Der Haken war nicht der, dass ich die Kleider unbedingt hätte haben wollen. Ich dachte mir nur, wenn man zu den Leuten gehörte, die solche Kleider hatten, würde man sich anders fühlen. Wenn man solche Sachen besaß, konnte man sich aussuchen, wer man sein wollte, jeden Tag aufs Neue. Man konnte sein Inneres durch sein Äußeres bestimmen.
Ich rieb meine High Heels kurz mit dem Schuhbeutel ab, bevor ich hineinschlüpfte. Vielleicht hatte Elisabeth Teerlinc nur eines mit Judith Rashleigh gemeinsam: Sie beschäftigte kein Hausmädchen. Elisabeth zu werden, hatte letztlich viel mehr gekostet als nur eine teure Garderobe. Eine Rüstung kann einen nur dann schützen, wenn sie unsichtbar ist, und das hatte am meisten Mühe gekostet. Ich musste nicht nur lernen und Prüfungen bestehen, sondern mir diese Überzeugung bewahren, dass ich gewinnen konnte. Es galt, aus dieser jämmerlichen Wohnsiedlung zu entkommen, in der ich groß geworden war. Ich durfte mir auf keinen Fall gestatten, mich in das elende Leben meiner Mutter hineinziehen zu lassen.
Dafür musste ich viel Spott ertragen, Schimpfwörter wie „Schlampe“ und „Zicke“, die man mir auf den Schulfluren zuzischte, nur weil ich mehr wollte. Ich hatte mir selbst beigebracht, die Mädchen in der Schule zu hassen und sie dann zu ignorieren, denn was würden sie in ein paar Jahren schon sein? Schwabbelige Mütter in der Schlange an der Bushaltestelle, weiter nichts. Am schwierigsten war es jedoch, auch die letzte Spur des überwältigten Proletenmädels zu tilgen, als das ich mich fühlte, nachdem ich schließlich einen Platz an der Uni ergattert hatte. So was sehen die Leute nämlich. Sie sehen nicht nur das traurige Kind, das unter der Bettdecke über seinem kostbaren Modebuch und seiner kleinen Sammlung von Kunstpostkarten geträumt hat, sondern das ehrgeizige, aber klägliche Herz, das in ihm schlägt. Sobald ich den Zug südlich der Lime Street bestiegen hatte, sollte niemand dieses kleine Mädchen jemals wiedersehen. Langsam, aber sicher hatte ich meinen Akzent ausgerottet, mein Benehmen geändert, meine Sprachen gelernt, meine Verteidigungsstrategien geformt und verfeinert wie ein Bildhauer seinen Marmor.
Aber auch das war nur der Anfang der Anforderungen, die Elisabeths Existenz an mich stellte. Eine Weile, als ich einen Job in einem renommierten Auktionshaus hatte, hatte ich mich in dem Glauben gewiegt, ich hätte es schon geschafft, aber ich hatte weder Geld noch Verbindungen, und das hieß, dass ich niemals mehr werden würde als der Wasserträger der Abteilung. Also nahm ich nachts einen Hostessenjob in einer Bar an, dem Gstaad Club, denn bestimmt würden ein schöneres Kostüm und ein besserer Haarschnitt etwas verändern. Von diesem rührenden Irrglauben wurde ich kuriert, als ich entdeckte, dass Rupert, mein Chef, in einen Fall von Kunstfälscherei verwickelt war. Er hatte keine fünf Minuten gebraucht, um mir die Tür zu weisen.
Da hatte mir einer der Gäste meines Clubs, James, ein Wochenende an der Riviera angeboten, und ab diesem Moment waren die Dinge vorübergehend ein wenig … unsauber gelaufen. Wenn auch unterm Strich sehr profitabel, denn ich hatte die Fälschung, derentwegen ich meinen Job verloren hatte, ausfindig gemacht und verkauft und mich mit diesem Geld als Kunsthändlerin in Paris niedergelassen. Zugegeben, es hatte da den einen oder anderen Todesfall gegeben. James hatte es nicht zurück nach London geschafft, obwohl das nicht ganz meine Schuld gewesen war. Dasselbe galt für den Händler Cameron Fitzpatrick, dem ich die Fälschung gestohlen hatte, meine alte Schulkameradin Leanne, den Undercover-Ermittler Renaud Cleret und Julien, den Besitzer eines Pariser Sexclubs. Es war aus praktischen Gründen erforderlich gewesen, als Elisabeth Teerlinc nach Venedig zu gehen. Nicht zuletzt, weil ich die Aufmerksamkeit eines gewissen Polizisten namens Romero da Silva vermeiden wollte.
Es war ganz schön mühsam gewesen, das alles zu vertuschen. Doch Elisabeths Fassade war inzwischen wirklich gut, ihre glänzende Oberfläche reflektierte nur das, was die Menschen in ihr sehen wollten. Es stimmt schon, was die Leute sagen – am Ende kommt es immer auf die inneren Werte an.
Frau Hilton, einige Zeitungen vergleichen Ihre Romane mit „Fifty Shades of Grey“. Was halten Sie davon?
Ich kann nur vermuten, dass diejenigen, die das glauben, keines der Bücher gelesen haben. „Fifty Shades of Grey“ ist eine klassische Liebesgeschichte über eine leidenschaftliche Jungfrau, der es gelingt, einen mächtigen, dominanten Mann durch ihre Liebe zu zähmen. Es ist ein modernes Märchen. „Maestra“ ist ein Thriller – und der große böse Wolf ist nicht männlich.
Sex and Crime – funktioniert das noch?
Offensichtlich – also, wenn Sie mich fragen.
Die Frauen in Ihrem Buch sind sehr taff, unabhängig und mächtig. Würden Sie die „Frau von heute“ auf die gleiche Weise charakterisieren?
Ich habe mit meinem Buch nicht die Absicht gehabt, eine Abhandlung über die Frau von heute zu schreiben – es ist nur eine Geschichte. Aber ich bin froh, dass Sie sie unabhängig und mächtig finden, da andere Leser sich darüber beklagt haben, dass sie zu unterwürfig und schwach sind und nichts können, außer ihre Sexualität gezielt einzusetzen. Vielleicht ist der Punkt ja, dass Sex, Gender und Macht weiterhin starke, komplexe Themen sind, die die Literatur untersuchen, nicht beurteilen soll.
Die „Maestra“-Reihe – nur für Frauen?
Keineswegs! Es ist zu 100 Prozent auch ein Männerbuch. Es ist wirklich schade, dass Leser nach Geschlecht charakterisiert werden müssen, aber wenn ich einen Verkaufs-Pitch schreiben müsste, würde ich sagen, dass es ein spannendes, dramatisches, sexy, glamouröses und mit dunklem Humor durchdrungenes Buch ist – das erscheint mir alles recht geschlechtsneutral.
Schriftsteller werden oft nach ihrer Botschaft gefragt. Was ist Ihre Botschaft?
Vielleicht ist das, was ich am meisten mag, dass die Bücher sich selbst nicht zu ernst nimmt.
Die wichtigsten Themen in Ihrer Reihe?
Sex. Mord. Schuhe.
Sie sagten einmal: „Mein natürlicher Lebensraum ist die Bibliothek.“ Haben Sie sich wirklich in einer Bibliothek oder eher in einem Museum inspirieren lassen? Welche Verbindung haben Sie zu Kunst und Kultur?
Ich habe englische Literatur und anschließend Kunstgeschichte studiert, daher schreibe ich seit vielen Jahren in der ein oder anderen Form über Geisteswissenschaftliches. Die Inspiration gab mir das Schwert im Gemälde der Künstlerin Artemisia, ein häufiges Motiv, es gibt hunderte Versionen von Judith und Holofernes, aber in nahezu allen erfüllt das Schwert eher dekorative als funktionale Zwecke. Es hat mich an Frauen und Gewalt denken lassen und deren eher pragmatischen Zugang dazu. Also ja – ich nehme an, die Inspiration für meine Reihe hängt im Museum!

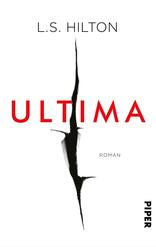



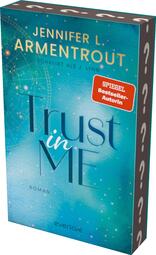
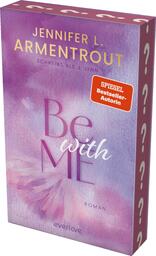






DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.