
Dunkelblau - eBook-Ausgabe
Wie ich meinen Vater an den Alkohol verlor
„Erschütternd offen.“ - Wochenspiegel Idar-Oberstein
Dunkelblau — Inhalt
Ein paar Gläser Wein, eine Flasche Bier mehr, na und? Alkohol ist das Schmiermittel unserer Gesellschaft. Was Dominik Schottner nüchtern feststellt, betrifft ihn selbst unmittelbar: Sein eigener Vater war Alkoholiker. Über viele Jahre hat die Familie weggeschaut, hat hilflos miterleben müssen, wie sich ein Mensch immer tiefer ins Verderben säuft. Jetzt spürt der Sohn dem Verhängnis nach und fragt: Wie hätten wir meinem Vater helfen können? Erschütternd offen erzählt er die Geschichte seines alkoholkranken Vaters und sein eigenes Erwachsenwerden im Schatten der Sucht. Ein bewegendes Dokument über die zerstörerische Droge Alkohol – und die Kraft, die man braucht, um gegen sie zu bestehen.
Leseprobe zu „Dunkelblau“
Mein Vater war Volkswirt und 16 Jahre lang arbeitslos. Er hatte zwei Kinder aus je einer Ehe, trug gerne Jeans und Polohemden. Er rauchte Pfeife und Zigarillos, aß gerne Fränkischen Sauerbraten und Presssack, trank Weißbier und Edelvernatsch. Sein Verein war der 1. FC Nürnberg, sein Lieblingsland Neuseeland. In einem Glaskasten in seinem Flur sammelte er Spielzeuglastwagen, in einem Regal im Wohnzimmer Teddybären. Rolling Stones, Skifahren, seinen VW Sharan, seinen Enkel, das alles liebte er. Politisch stand er eher links als rechts von der Mitte, aber [...]
Mein Vater war Volkswirt und 16 Jahre lang arbeitslos. Er hatte zwei Kinder aus je einer Ehe, trug gerne Jeans und Polohemden. Er rauchte Pfeife und Zigarillos, aß gerne Fränkischen Sauerbraten und Presssack, trank Weißbier und Edelvernatsch. Sein Verein war der 1. FC Nürnberg, sein Lieblingsland Neuseeland. In einem Glaskasten in seinem Flur sammelte er Spielzeuglastwagen, in einem Regal im Wohnzimmer Teddybären. Rolling Stones, Skifahren, seinen VW Sharan, seinen Enkel, das alles liebte er. Politisch stand er eher links als rechts von der Mitte, aber wenn einer bei der CSU war, sprach er trotzdem mit ihm.
In 33 Jahren habe ich meinen Vater nie ohne Bart gesehen oder ohne Eau de Toilette gerochen, nie seinen Händedruck als schwach empfunden oder sein Herz als kalt. Er konnte aufbrausen und charmieren, einschüchternd poltern und im nächsten Moment wieder sensibel sein. Er hatte einen Schlag bei Frauen, und einmal schlug er auch fast zu. Er konnte elendig gut angeben, aber kaum leisetreten.
Er konnte saufen wie ein Loch und fiel am Ende selbst in eines.
Mein Vater starb an einem Montag. Zwei Tage nach Nikolaus, 16 vor Heiligabend, 62 Jahre und 223 Tage nach seiner Geburt in seiner Heimat Rothenburg ob der Tauber. Laut Sterbeurkunde hörte sein Herz gegen 18:24 Uhr auf zu schlagen. Ein natürlicher Tod, der keine Obduktion nach sich zog, außer die Angehörigen hätten es gewünscht und bezahlt. Ein Alkoholtod kommt jeden Tag in Deutschland gut 200 Mal vor.
Ist das schlimm?
Für meine Familie, seine Freunde und mich schon, für den Rest des Landes – eher nicht. Aber man kann solche Tode vermeiden. Wie? Das weiß ich nicht. Es ist mir nicht gelungen. Meiner Familie ist es nicht gelungen. Darum geht es in diesem Buch.
Der Tag, an dem mein Vater stirbt, beginnt für mich wie jeder andere Tag. Gegen 8:50 Uhr bringe ich meinen Sohn Lukas in die Kita. Er auf dem Laufrad, ich zu Fuß. Tage vorher hat mich jemand um mein Fahrrad erleichtert. Seither gehe ich zu Fuß.
Zu Fuß zu gehen hat in Berlin-Neukölln, wo ich wohne, den Vorteil, dass ich Lukas, ohne vom Rad zu fallen und ohne zu schreien, aufhalten kann, wenn er zu schnell Richtung Straße rollt, wo ihm der Tod durch einen heranbrausenden Transporter oder einen klapprigen Passat mit einem müden Vater am Steuer sicher wäre.
Zu Fuß zu gehen hat aber auch den Nachteil, dass ich für viele Wege viermal so lange brauche wie mit dem Fahrrad. Immerhin, Fußgänger leben länger, glaube ich.
Um kurz vor neun sitzen wir in der Umkleide der Kita, schälen das Kind aus den Klamottenlagen und studieren den Essensplan. Rosenkohleintopf, zum Nachtisch Bananen. Um fünf nach neun betreten wir den Gruppenraum, um zehn nach verabschiede ich mich von Lukas, um elf nach verlasse ich schnell die Kita, halte mir dabei die Ohren zu, und ab ungefähr zwölf nach spaziere ich zu einem Café am Ende meiner Straße.
Ich bin dort mit meinem Freund Christopher verabredet. Wir kennen uns seit dem Studium. Lange Zeit waren wir uns sehr nahe. Tranken Bier für zwei Euro das Glas im Prenzlauer Berg, aßen Schawarma für drei bei einem arabischen Imbiss an der Danziger Straße oder Grünes Curry für fünf auf der Prenzlauer Allee. Feierten mit jungen Ungarn in Budapest die Aufnahme ihres Landes in die EU, gewannen zweimal die Deutsche Journalistenschulmeisterschaft im Fußball und hingen so lange pleite in einer versifften Wohnung in New York rum, bis uns Christophers Mutter Geld überwies, mit dem wir die Bude schließlich bezahlen konnten. Unsere Väter um Geld anzupumpen kam uns damals nicht in den Sinn.
Als ich das Café erreiche, ist es schon halb zehn. Ein Berlin-Café: cool, ungemütlich, mit großer Panoramaglasfront, die von einer Eisen-Glas-Tür unterbrochen wird, die wiederum Probleme mit ihrem Schließmechanismus hat. In der Auslage drängeln sich üppig belegte Aufbackwaren mit Sprossen auf Käse und Cervelatwurst, darunter Remoulade. Daneben Muffins, Tartes, Croissants. Aus den Boxen rieselt Musik.
Ich bin der einzige Gast. Die Freiheit der Platzwahl nehme ich freudig zur Kenntnis und setze mich in die hinterste Ecke, in der Hoffnung, dass es dort am wenigsten zieht. Das stimmt auch, aber Kissen auf den braun lackierten Pressspanbänken wären trotzdem toll. Und eine Bedienung auch. Ich ziehe mein Handy aus der Tasche und warte auf Christopher, während ich eigentlich nur den Anruf meines Vaters herbeisehne.
Zum letzten Mal habe ich mit ihm vor gut einer Woche gesprochen, am Sonntag. Er hatte angerufen, zuerst auf dem Festnetz. Dann auf dem Handy. Dann wieder Festnetz. Normalerweise hätte er dann eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen.
Mit Schwung am Anfang.
Ja, hallo, hier ist der Opa!
(Immer Opa, nie Papa.)
Dann mit dem immer gleichen, halb gespielten Vorwurf.
Euch erreicht man ja gar nicht mehr!
Der direkt in eine stolze Nachfrage übergeht.
Ich wollte nur mal hören, wie es meinem Enkel so geht!
Schließlich die Ermahnung, übervoll mit Resignation und Hoffnung.
Vielleicht könnt ihr ja irgendwann mal zurückrufen, dass ich ihn sprechen kann!
Und dann die Verabschiedung, die er immer draufsprach, seine Signatur.
Danke. Ciao!
Nach dieser Nachricht hätte er dann eine E-Mail geschrieben, fünf Zeilen, fast identischer Wortlaut, meist ohne Betreff. Alles innerhalb weniger Minuten, obwohl es ihm an Zeit nicht mangelte.
Vielleicht könnt ihr ja irgendwann mal zurückrufen, dass ich ihn sprechen kann!
Weil es an diesem Sonntag keinen guten Grund gibt, nicht abzuheben, hebe ich ab.
Endlich erreicht man dich mal!
Seit Ende Oktober sah mein Vater sehr schlecht. Umrisse, hell, dunkel konnte er noch erkennen. Aber Zeitung lesen, im Internet surfen, Fernseh schauen, sich den Bart stutzen, seine Pfeife ordentlich stopfen, das ging alles nicht mehr, ganz plötzlich und ohne Vorankündigung. Sein Hausarzt, das hat zumindest mein Vater mir gesagt, vermutete einen kleinen Schlaganfall und lotste den Patienten zum Abklären noch mal zum Augenarzt und Neurologen. Die schickten ihn weiter nach Würzburg an die Uniklinik. Auf der Überweisung steht mit rotem Filzstift geschrieben: „NOTFALL. Rechts/links unklare Sehminderung, vor allem: übergeordnetes Sehzentrum. ODER psychische Krise.“
Den Zettel finde ich nach dem Tod meines Vaters in seinen Unterlagen. Er selbst hat mir zu Lebzeiten nichts davon erzählt. Er stockte beim Reden, das schon, suchte nach Wörtern, schnaufte schwer und legte Denkpausen ein, wo man normalerweise keine vermuten würde, so, als wären nicht nur seine Augen betroffen, sondern auch sein Sprachzentrum und andere Teile seines Gehirns. Alles passierte langsamer als sonst, viel zäher. Doch er sagte immer nur: „Es wird jeden Tag ein bisschen besser.“
Seine E-Mails checkte in diesen Wochen ein Freund für ihn, druckte die wichtigen aus und las sie ihm vor. Die wichtigsten Telefonnummern notierte mein Vater seltsamerweise selbst, handschriftlich, je eine auf einem A4-Blatt: die meiner Schwester, meine, die seines Onkels, die seines besten Freundes, die vom Hausarzt. Gekrakel zum Überleben. Als ich am Tag nach dem Tod meines Vaters seine Wohnung betrete, liegen die Papiere auf dem Wohnzimmertisch, der roten Stoffcouch und dem Korkboden dazwischen. Daneben so viele Flaschen, dass man damit ein Supermarktregal füllen könnte. Wodka, Bier, Rotwein, Grappa. Manche der Pullen sehen aus wie ein Notnagel. Vielleicht Geschenke? Klare mit komischen Namen. Geöffnet, weil nichts anderes mehr da ist. Am Ende tragen wir fünf große Umzugskisten voll mit leeren Flaschen aus der Wohnung.
Derselbe Freund, der für meinen Vater die Mails checkte und ausdruckte, fuhr ihn Mitte November mit dem Auto in die Klinik nach Würzburg. Mein Vater sollte dort ein paar Tage stationär untersucht werden, drei, vier vielleicht, dann hätte er wieder nach Hause gekonnt. Mit einer Diagnose und einer Therapieempfehlung in der Tasche, vielleicht auch ein wenig Zuversicht. Denn das war, was ihm in diesen Tagen am meisten fehlte: die Aussicht, dass sein Leben wieder lebenswert sein kann. Mit einem Job, einer schönen Wohnung, vielleicht auch mit einer lieben Frau, die ihn die Scheidung, die ihn gerade fertigmacht, vergessen lässt. Mit Enkelkindern, denen er vorlesen und sie beim Schaukeln anschubsen kann.
Kurz nachdem er in Würzburg eingecheckt hatte, stach meinen Vater aber wohl der Hafer. Drei, vier Tage im Krankenhaus würden drei, vier Tage ohne Alkohol sein. Unmöglich. Er entließ sich gegen den Rat der Ärzte selbst und wurde von seinem Freund nach Rothenburg ob der Tauber zurückgefahren.
Was sollte ich denn da in der Klinik? Ich glaub eh, es ist schon wieder ein bissl besser geworden.
Gegen 9:40 Uhr betritt Christopher das Café. Er war mal ein sehr guter Freund, jetzt kennen wir uns nur noch gut. Vor ein paar Wochen hätten wir uns in einer Bar fast geprügelt, weil ich es dort für einen guten Ort und eine gute Gelegenheit hielt, um Christopher für einen seiner Texte zu kritisieren. Worüber er nicht wirklich erfreut war, und so gab ein Wort das andere, und uns trennten nur Zentimeter von einem peinlichen Barfight.
Darüber wollen wir heute reden. Und vielleicht sogar damit anfangen, wieder Freunde wie früher zu werden.
Aber meine Gedanken gehorchen mir nicht. Sie drehen sich weg von Christophers Worten und machen es mir schwer, mich auf das Gespräch zu konzentrieren. Trotzdem schieben wir ein, zwei Stunden Wörter zwischen uns hin und her. Nur eben nicht über das, was mich eigentlich gerade beschäftigt: Dass sich mein Vater in den Minuten, die wir hier in diesem Café verbringen und versuchen, eine Freundschaft zu kitten, in seiner Wohnung einigelt und niemanden an sich heranlässt, nicht mich, nicht meine Schwester, nicht seinen besten Freund, nicht die Nachbarn, niemanden. Dass er dort alleine ist und Schmerzen hat. Dass er vielleicht am Boden liegt und nicht aufstehen kann. Dass er Hilfe braucht. Dass er Hilfe angeboten bekommt und sie nicht annimmt. Dass er eingeschnappt ist, warum auch immer. Dass er übertreibt. Dass er vielleicht bald stirbt?
Ich muss es Christopher sagen. Mein Vater, sage ich also irgendwann, um mich aus der Umklammerung meiner Gedanken zu lösen, mein Vater hat sich seit gut einer Woche nicht bei mir gemeldet. Was sehr komisch sei, denn sonst ballere er mich ja mit Anrufen und Nachrichten und E-Mails zu. Aber jetzt: nichts. Am Freitag hat mich sein bester Freund Volker angerufen, ganz aufgeregt war er, weil mein Vater nicht zu seinem Stammtisch erschienen ist, ohne abzusagen. Ich dachte erst, na und, einmal nicht zum Stammtisch, vielleicht ist er einfach nur krank? Aber weil er sich bei mir ja auch seit Tagen nicht gemeldet oder auf meine Anrufe reagiert hatte, war ich plötzlich auch sehr aufgeregt. Und weil mir nichts anderes einfiel, habe ich wieder angerufen und wieder und eine E-Mail geschrieben und eine SMS, und dann habe ich wieder angerufen, und nie habe ich eine Antwort bekommen. „Ich hab’s gar nicht gezählt“, sage ich zu Christopher, „aber weißt du eigentlich, wie scheiße das ist, einem erwachsenen Mann hinterherzutelefonieren, den man sonst für genau das belächelt?“
Ich erzähle, wie die Ohnmacht mit jedem Telefonat wächst. Und dass mein Vater seinem Freund Volker, der nur fünf Minuten entfernt wohnt, die Tür nicht aufgemacht hat, und wie seltsam ich das gefunden habe. Dass ich daher später die Nachbarn angerufen habe, die ich überhaupt nicht kannte, die aber sehr nett waren, und sie gebeten habe, ob sie mal gucken könnten, ob bei ihm Licht brennen würde. Da es an war und sie gesagt haben, dass sie auch Pfeifenrauch riechen könnten, habe ich mir gedacht, okay, zu Hause ist er wohl, vielleicht hat er ja nur irgendeinen Furz quersitzen, er wird sich dann schon melden. Die Nachbarin hat ihm dann sogar noch zwei Butterbrezen vor die Tür gestellt, weil sie sich auch schon Sorgen gemacht hat, und erzählt, dass die nach einer Weile weg waren. Aber wieder ohne Nachricht oder Dank oder irgendetwas.
Das mit dem Nichtmelden ging weiter bis Samstagnachmittag. Es war ja auch noch Nikolaus, und Volker und ich haben am Ende beschlossen, die Polizei zu rufen, damit sie die Wohnung aufmacht. Einen Schlüssel hatte komischerweise keiner von uns. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt jemand einen Ersatzschlüssel für die Wohnung hatte. Wir jedenfalls nicht. Die Polizei darf, wie ich erfahren habe, selber keine Türen aufbrechen, außer natürlich es geht um Terroristen oder so, also musste auch noch ein Schlüsseldienst kommen und aufschließen. Dann ging es schnell, und die Polizei ist rein in die Wohnung. Alles ruhig, nur einer schnarcht: mein Vater. Den haben sie dann aufgeweckt und gefragt, ob es ihm gut gehe und ob er Hilfe brauche. Und er hat geantwortet, dass alles gut sei, sich bedankt und gesagt, dass sie wieder gehen sollten und er keine Hilfe brauche. Ja, und dann sind die wieder gegangen, ohne dass irgendwas passiert wäre. „Aber ich meine, wenn die merken, dass mit dem was nicht stimmt, dann müssten die doch den Krankenwagen rufen, oder?“
Christopher schweigt.
Zwischen dem Wohnort meines Vaters und meinem lagen in den ersten zehn Jahren meines Lebens null Meter. Wir lebten im selben Haushalt. Nach der Trennung meiner Eltern wuchs die Distanz: erst auf knapp einen Kilometer zur neuen Wohnung meines Vaters. Nach der Scheidung auf fünf, weil meine Mutter und ich in den Nachbarort gezogen sind. Dann auf 400, weil mein Vater einen Job in Frankfurt angenommen hat. Mit 16 ging ich für ein Jahr auf eine Highschool in den USA: 8000 Kilometer. Danach lag für ein paar Jahre eine Dreiviertelstunde S-Bahnfahrt zwischen uns, was zwar deutlich weniger war als die gut 550 Kilometer, auf die wir uns zuletzt eingependelt haben, aber das Problem war immer dasselbe: Besonders nah waren wir uns nur selten.
Seit ein paar Jahren wird behauptet, dass Technik die Distanzen schrumpfen oder sie sogar auflösen lassen könne. Ich kann das nicht bestätigen. Natürlich, aus teuren Ferngesprächen in die USA wurden kostenlose Skype-Gespräche, aus Urlaubspostkarten E-Mails mit Fotos im Anhang und aus Faxen … nichts, die fielen einfach ganz weg. Alles ist angeblich günstiger, schneller und weniger umständlich geworden. Mein Vater und ich schafften es trotzdem, uns fast aus den Augen zu verlieren. Unsere Kommunikation wurde zum leeren Ritual. Überraschungen waren ausgeschlossen. Die Geburtstagsmails, die ich eine Zeit lang von ihm bekommen habe, schickte mein Vater immer schon am Tag vorher los. Als ich ihn einmal sehr bestimmt auf den richtigen Tag hinwies, reagierte er wie so oft: mit Empörung und verletztem Stolz. Erklären konnte er mir das Ganze aber trotzdem nicht, und ich wurde erst recht sauer: Der Vater, der sich den Geburtstag seines Sohnes nicht merken kann. Das war das, was bei mir hängen blieb.
Dass er sich jetzt tagelang nicht meldete, wirkte am Anfang auf mich ein wenig wie ein zu spät zugestellter Gruß aus diesen Zeiten. Unerklärlich und blöd und unnötig. Und vor allem: Unpassend, weil wir, dachte ich, doch schon so viel weiter gewesen sind. Wenige Wochen zuvor hatte er sich mir noch anvertraut.
„Ich würde so gerne eine Kur machen.“
„Eine Kur?“
„Ja, ich bin körperlich nicht gut drauf. Ins Allgäu würde ich gerne. In die Berge.“
„Ich fahre dich, Papa! Sag wohin, und ich fahre dich!“
„Ja.“
„Ja?“
„Ich frag mal.“
Ich weiß es bis heute nicht: Hat er jemals gefragt? Wenn ja, wen? Den Hausarzt? Der sagte mir, dass er etwas wie bei meinem Vater noch nie gesehen habe, einen so schnellen Abstieg, eine so rasche Verschlechterung. Fulminant, nennt er das.
Der Hausarzt ist ein alter Schulfreund meines Vaters. Als der wegen seiner Sehprobleme zum ersten Mal in die Praxis ging, gab er einen seltsamen Grund für seinen Besuch an: Er würde den Ball beim Tischtennis nicht mehr sehen. Es ist nicht ganz klar, welchen Ball er meinte: Einen im Fernsehen? Oder spielte er selber irgendwo?
Es war vor allem auch das erste Mal, dass ich das Wort Tischtennis im Zusammenhang mit meinem Vater hörte. Und auch seine Freunde, besonders Volker, wissen nicht, welchen Tischtennisball er nicht mehr gesehen haben könnte.
Judo, das war immer der Sport meines Vaters gewesen. Brauner Gürtel, mittelfränkischer Vizemeister. In der Zeitung stand damals, dass er mit etwas mehr Härte und weiterem eifrigen Training noch manchen Erfolg würde verbuchen dürfen. Und jetzt also Tischtennis? Der Arzt kann es sich auch nicht erklären, und in einem späteren Gespräch erlauben wir uns, über diese Story meines Vaters gemeinsam ein wenig zu schmunzeln.
Letztlich ist es auch egal, ob mein Vater den Ball in echt nicht gesehen hat oder im Fernsehen oder ob er ihn sich einfach nur eingebildet hat: Er sah einfach fast nichts mehr. Und um herauszufinden warum, warf der Hausarzt schnell die Untersuchungsmaschinerie an. Ein CT, um das Gehirn zu überprüfen. Ein Ultraschall der Leber. Eine Blutuntersuchung. Der Abgleich mit den augenärztlichen Befunden. Das ganze Programm.
Aber mein Vater sagte, nöö, nix, kein eindeutiges Ergebnis. Ich hätte erwartet, dass ihn das schockiert oder verwirrt oder vielleicht sogar zur Räson ruft. Aber das entsprach ihm nicht. Es hätte ihm Einsicht abverlangt und auch Mut, Schwäche zu zeigen.
Stattdessen entschied sich mein Vater dafür, gleichzeitig ehrlich erschrocken und trotzig zu sein. Erschrocken auf so einer Huch-Ebene: Huch, was ist das denn jetzt für ein Streich, den mir mein Körper spielt? Und trotzig, weil so ein Streich ja irgendwann zu Ende sein muss und es bislang ja auch schon 62 Jahre gut gegangen ist. Warum sollte sich das jetzt ändern, und schließlich sind die Ärzte gut, sogar hier in Rothenburg. Und die in Würzburg an der Uniklinik erst, die würden schon rausfinden, was Sache ist, und dann würde alles wieder gut werden!
Danke. Ciao!
Ich wollte ihm so gern glauben. Wollte, dass er recht behält und bald schon wieder selbst durch sein geliebtes Internet surfen konnte. Dass alles umkehrbar sei. Aber wie realistisch war das bei den Symptomen? Ich googelte und stellte wie immer schnell fest, was ich immer feststelle, wenn ich Symptome google: Man ist immer sterbenskrank, und eigentlich ist es ein Wunder, dass man noch lebt. Also rief ich beim Arzt an, aber der durfte mir nichts sagen, schließlich war mein Vater immer noch Herr seiner Sinne.
Heute weiß ich, was er mir damals nicht sagen durfte: Die Ergebnisse der Untersuchungen waren vernichtend. Die Blutwerte meines Vaters deuteten stark Richtung Leberzirrhose, dem Klassiker unter den Folgen der Alkoholsucht. Gicht war ohnehin schon länger bekannt gewesen und wurde auch jetzt wieder bestätigt, ebenso der Bluthochdruck. Und im CT zeigte sich auch noch eine kortikale Hirnatrophie, ein Schwund der Hirnsubstanz, meist der grauen, was einhergeht mit einer Minderung der intellektuellen Leistungen, der Merkfähigkeit. Es sei das, was man landläufig als Verkalkung bezeichne, erklärte mir der Doktor.
Nur: Mein Vater war nicht verkalkt, weil das Leben das nun mal so mit sich bringt ab einem bestimmten Alter. Er war verkalkt, weil er trank. Und vielleicht lag es auch genau an dieser Verkalkung, dass er, obwohl er in einigen wenigen starken Momenten artikuliert hat, dass sein Körper ein Wrack sei, einfach weitersoff, als wäre nichts gewesen. Als wäre es das Leben nicht wert, mit einem beherzten Tritt auf die Bremse alles anzuhalten und was zu ändern. Aber das konnte mein Vater nicht. Er liebte sein Leben schon länger nicht mehr, fürchte ich. Vielleicht hasste er es nicht mal. Vielleicht war es ihm einfach egal geworden. Krankhaft egal.
Christopher und ich müssen wieder los, unser Treffen ist zu Ende. Aber es fühlt sich gut an, einem alten Freund von meinem Vater erzählt zu haben, sich ihm geöffnet zu haben. Er weiß jetzt ein bisschen Bescheid, was bei mir los ist. Zum Abschied umarmen wir uns und gehen getrennte Wege, Christopher nach rechts in die Redaktion, ich nach links in mein Büro.
Der Himmel trägt Berlin-Grau, fünf, sechs Grad hat es vielleicht, kein Regen. Ich ziehe mein Telefon aus der Tasche und wähle die Nummer meines Vaters. Es klingelt lange, schließlich geht der Anrufbeantworter dran, und ich rattere mein Sprüchlein runter. Dann lege ich auf und laufe ein wenig schneller.
Auf der Straße ist noch etwas Feuchtigkeit vom Regen der vergangenen Nacht übrig. Die Autos pflügen durch die kleinen Bäche in den Spurrinnen, Schfffftschfffft, einige ein wenig schneller als andere. Ich frage mich, wieso ich mich nicht einfach ins Auto setze und zu meinem Vater fahre. Was hält mich ab? Die Arbeit? Ja, ist doch wichtig, versichere ich mir, Geld verdienen, Anschluss nicht verlieren, wichtige Geschichten schreiben. Außerdem ist er erwachsen und hat der Polizei am Samstag gesagt, es gehe ihm gut. Also nicht fahren?
Schfffftschfffft.
Schfffftschfffft.
Schfffftschfffft.
20 Minuten später sitze ich an meinem Schreibtisch und stelle fest, dass ich eigentlich gar nicht weiß, was ich hier heute machen soll. Ich habe kein Skript abzugeben, kein Thema, das ich Redaktionen anbieten kann oder sollte. Ich könnte eines suchen und ein Angebot schreiben. Aber will ich das? Jetzt? Wäre es nicht besser zu fahren? Ich verschiebe das Beantworten auf später und mache mir einen Espresso.
Die Sache mit den Augen meines Vaters, so nenne ich das, was gerade passiert, wenn ich mit meiner Freundin darüber spreche. Die Sache mit den Augen ist ein wenig so, als würde sich ein Computer aufhängen. Erst bemerkt man es gar nicht, weil Teile des Systems noch laufen. Weil man noch Rückmeldung bekommt, wenn man die Tasten drückt. Weil er noch rattert und rechnet und irgendein Lämpchen noch blinkt. Das ist doch ein gutes Zeichen, oder? Aber dann kollabiert auch das Programm, das man gerade benutzt. Und nur wenn man Glück hat, erscheint eine Fehlermeldung, wenn nicht, ist es vorbei. Dann erstarrt der Bildschirm, und jeder Tastendruck geht ins Leere. So lange, bis das Rattern des Rechners schließlich zu einem zusammenhängenden Surren wird, durchbrochen von gelegentlichem Schluckauf, der einen noch mal Hoffnung schöpfen lässt, aber eigentlich weiß man schon: Die einzige Lösung ist, dem Ding den Strom abzudrehen und neu zu starten. Aber wie macht man das bei einem Menschen?
Ohne eine Antwort auf diese Frage zu finden geht mein Tag im Büro fast ereignislos zu Ende. Um kurz nach fünf gehe ich nach Hause. Für den Abend haben sich ein paar Freunde angekündigt, wir wollen über ein Projekt mit und für Flüchtlinge sprechen, dazu ein bisschen was essen und trinken. Also springe ich unterwegs noch schnell in den Supermarkt, kaufe ein paar Kartoffeln und Ingwer für eine Suppe. Als ich an der Kasse stehe, klingelt mein Telefon. Es ist Volker, der beste Freund meines Vaters.
„Ich habe ihn heute wieder nicht erreicht. Und eben war ich dort und habe geklingelt, aber wieder nichts. Keine Antwort.“
„Was sollen wir tun“, frage ich ihn, „Polizei?“ Ja, anders geht es wohl nicht. Ich wähle die Nummer der Rothenburger Polizeidienststelle. Wie oft habe ich das eigentlich in meinem Leben schon gemacht: die Polizei angerufen? Was? Wo? Wer? Wie? Wann? Sind das die fünf W-Fragen?
Ein Beamter hebt ab, und ich rede los, ziehe eine Verbindung zum Samstag, dem ersten Einsatz. Da hätten wir doch schon einmal telefoniert, ja, und jetzt sei es wieder so, dass er nicht aufmacht: „Wir machen uns wirklich große Sorgen! Ich weiß, es ist erst zwei Tage her, aber vielleicht könnten Sie noch mal zu ihm fahren?“
Der Beamte atmet tief ein. Dann laut und langsam aus.
„Also, ich sag Ihnen jetzt mal was.“ Er spricht sehr breites Fränkisch.
„Wir können ja nicht jedes Mal ausrücken, wenn hier einer anruft, nur weil jemand vielleicht besoffen in seiner Wohnung liegt“, sagt er. Das sei hier ja immer noch – noch! – ein freies Land. Und sie hätten auch eigentlich wirklich anderes zu tun. „Aber wir fahren da jetzt mal hin und melden uns dann bei Ihnen. Wird schon alles gut sein. Auf Wiederhören!“
Hat der Polizist das eben wirklich gesagt? Obwohl er die Vorgeschichte mit dem Einsatz zwei Tage vorher kennt? Kurz erwäge ich, ihn noch mal anzurufen, um ihm meine Meinung zu sagen. Aber was bringt das schon? Außerdem brauche ich gerade alle meine Sinne, um sicher nach Hause zu kommen, hier auf einer der anstrengendsten Straßen in Berlin, der Sonnenallee.
Um kurz vor sechs betrete ich meine Wohnung. Mein Sohn rennt mir entgegen und begrüßt mich stürmisch. Meine Freundin rennt nicht, ist weniger stürmisch und guckt betreten. Den ganzen Tag über haben wir immer wieder telefoniert und SMS geschickt. Sie weiß, dass die Polizei jetzt gerade entweder auf dem Weg oder schon bei meinem Vater ist. Und sie weiß, wie es ist, wenn jemand trotz Leberzirrhose weitersäuft, bis das Herz vor dem ganzen Gift im Körper kapituliert: Genau das hat ihr Vater gut ein Jahr vorher, im Sommer 2013, gemacht. Auch er mit Anfang 60, auch er war lange arbeitslos, auch er hatte eine Ehe an die Wand gefahren.
Ich lege die Einkäufe auf die Arbeitsplatte in der Küche. Kartoffeln, Ingwer und noch Orangensaft habe ich mitgenommen, das gibt der Kartoffelsuppe eine ganz interessante Note. Würde meinem Vater das schmecken, so ohne Worscht? Die Zeit drängt. Um acht wollen meine Freunde da sein, und die Suppe soll noch ein bisschen ziehen.
Eine Dreiviertelstunde später dampft im Topf eine orange-braune Pampe mit roten Chili-Sprenkeln. Meine Freundin rümpft die Nase.
„Aber riecht lecker.“
Als ich gerade noch einmal abschmecke, klingelt das Telefon. Es ist eine Rothenburger Nummer, die Polizei. Ich lege den Löffel zur Seite und hebe ab. Der Beamte von vorhin ist dran, ich habe seinen Namen vergessen, aber erkenne die Stimme und das Fränkisch wieder. Er atmet ein bisschen schwer und druckst herum. Mit einem Mal fühle ich mich wie in einem Film, in dem ich nie sein wollte. Wie einer von diesen Tatort-Angehörigen, dem die Kommissare ganz bedröppelt eine schlechte Nachricht überbringen müssen. Wie reagieren die da gleich noch mal immer? Jetzt schon losheulen? Oder wird es gar nicht so schlimm?
Ich stütze mich mit einer Hand auf die Arbeitsplatte, mit der anderen umklammere ich das Telefon. Die Suppe blubbert, der Dunstabzug rattert. Die Stimme des Polizisten ist weit weg. Und ein bisschen kleinlaut.
„Herr Schottner, es tut mir sehr leid, Ihnen das mitteilen zu müssen. Aber es ist das eingetreten, was wir nicht gehofft hatten: Ihr Vater ist leider verstorben.“
„Schottner prangert nicht an. Das ist nicht das Ziel seines Buches ›Dunkelblau‹. Vielmehr zeichnet der Journalist seine Lebensgeschichte auf, um zu verstehen. Nicht belehrend, sondern erschreckend authentisch beschreibt er den Zerfall eines Menschen und die Unfähigkeit des unmittelbaren Umfelds, darauf zu agieren.“
„Absolut lohnenswert.“
„Dominik Schottner erzählt in großer Offenheit die Geschichte seines alkoholkranken Vaters.“
„Erschütternd offen.“
„Schottners Buch ist alles andere als eine Abrechnung mit dem Vater; es ist im Gegenteil der Versuch, ihn zu verstehen und ihm im Moment des Verstehens auch nahe zu sein.“
„Er schreibt über Hilflosigkeit, übers Wegschauen. Und über die Kraft, die er sich antrainieren musste, um dieses Thema zu verarbeiten. Kein Ratgeber. Ein Stück Seele. Und Herz.“
„ein bewegendes Buch“
„›Dunkelblau‹ erzählt eine Familiengeschichte, die auch unsere sein könnte.“
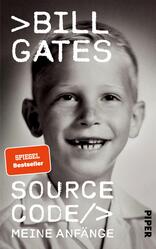
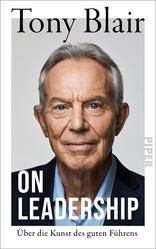

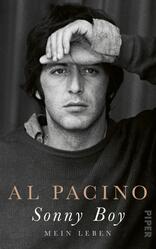


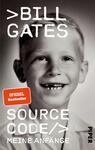


DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.