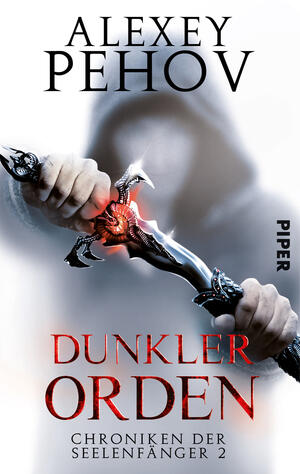
Dunkler Orden (Chroniken der Seelenfänger 2) - eBook-Ausgabe
Chroniken der Seelenfänger 2
„›Dunkler Orden‹ ist in einem lockeren Stil erzählt, der das Abenteuerliche und Exotische der Geschichte betont.“ - Fantasia 757e
Dunkler Orden (Chroniken der Seelenfänger 2) — Inhalt
In Fürstentümern, in verlassenen Dörfern, im Dunkelwald und am Ufer des Meeres treiben düstere Seelen ihr Unwesen. Gerüchte über eine schicksalhafte Urteilsverkündung geraten in Umlauf. Ludwig van Normayenn und die Bruderschaft der Seelenfänger sind die letzte Hoffnung der Menschen – nur sie können das Land noch vor der Dunkelheit bewahren. Doch Ludwig ist lebensgefährlich verwundet worden. Wird die Bruderschaft scheitern und die Welt zugrunde gehen? Alexey Pehov gehört zu den erfolgreichsten russischen Autoren unserer Zeit. Seine epischen Chroniken von „Siala“ und „Hara“ wurden zu internationalen Bestsellern, und die neue Serie des Autors, „Die Chroniken der Seelenfänger“, steht ihren Vorgängern auch in Band 2 in nichts nach.
Leseprobe zu „Dunkler Orden (Chroniken der Seelenfänger 2)“
1 Der Dunkelwald
An meine Eltern hatte ich kaum Erinnerungen. Nicht daran, wie sie aussahen, nicht daran, wie ihre Stimmen klangen. Worüber sie lachten, wovon sie träumten – ich weiß es nicht.
Das Einzige, woran ich mich erinnerte, war das Wiegenlied, das meine Mutter mir vorsang, damals, bevor ich ins Waisenhaus kam. Auf einem Tisch mit einer weißen Spitzendecke darüber stand eine Wachskerze, die ein sanftes Licht spendete. Die Flamme spiegelte sich in dem kleinen Fenster, durch das die verschneite Straße zu sehen war. Im Ofen prasselte Feuer, das für [...]
1 Der Dunkelwald
An meine Eltern hatte ich kaum Erinnerungen. Nicht daran, wie sie aussahen, nicht daran, wie ihre Stimmen klangen. Worüber sie lachten, wovon sie träumten – ich weiß es nicht.
Das Einzige, woran ich mich erinnerte, war das Wiegenlied, das meine Mutter mir vorsang, damals, bevor ich ins Waisenhaus kam. Auf einem Tisch mit einer weißen Spitzendecke darüber stand eine Wachskerze, die ein sanftes Licht spendete. Die Flamme spiegelte sich in dem kleinen Fenster, durch das die verschneite Straße zu sehen war. Im Ofen prasselte Feuer, das für wohlige Wärme sorgte. Bereits einschlummernd, lauschte ich dem Lied meiner Mutter.
Seitdem waren wer weiß wie viele Jahre vergangen. Trotzdem träumte ich häufig von diesem Lied, wachte jedoch jedes Mal auf, bevor meine Mutter es zu Ende gesungen hatte. Danach lag ich stets wach, starrte an die Decke irgendeines Zimmers in irgendeiner Schenke oder auf die niedrig hängenden Äste von Ahornbäumen samt den Sternen am Himmel und versuchte, mich an das ganze Lied zu erinnern. Doch mein Gedächtnis kannte kein Erbarmen, stellte mir den Rest des Textes nie zur Verfügung, geschweige denn die Stimme meiner Mutter.
Als ich Apostel einmal gestand, wie sehr ich mich an den Schluss des Liedes und die Stimme meiner Mutter zu erinnern wünschte, hatte er bloß die Schultern gezuckt und gemurmelt, alle Menschen würden ihre Kindheit irgendwann vergessen.
Aber warum erinnerte ich mich dann an die verschneite Straße und die Kerze auf dem Tisch? Warum erinnerte ich mich an das von Grauen gezeichnete Gesicht unserer Nachbarin, als die ersten Menschen in Ardenau vom Justirfieber erfasst wurden. An die unter Schnee begrabenen Leichen, den Aufstand, Schießereien und gehenkte Menschen. Nur an den vollständigen Text des Wiegenliedes und die Art, wie meine Mutter gestorben war, erinnerte ich mich eben nicht.
Zu der Zeit, als ich die Beichte noch für recht bedeutsam hielt und sie folglich regelmäßig ablegte, hatte mir ein Kirchenmann einmal gesagt, Gott würde mich auf diese Weise auf die Probe stellen. Meine Demut solle dann im Paradiese vergolten werden, wo mir Engel besagtes Wiegenlied vorsingen würden. Aber in dem Punkt waren sich die Herren der Kirche ja durch die Bank einig: Im Jenseits würde sich alles glücklich fügen, weshalb man hienieden jedes Leid ertragen müsse – und bloß nicht vergessen dürfe, den Ablass zu entrichten.
Doch als Scheuch mich damals im Frühjahr auf der schmutzigen Landstraße geschultert hatte, mein Blut zu Boden getropft und ich fest davon überzeugt gewesen war zu sterben, da hatte ich keine Lieder gehört. Überhaupt nichts hatte ich da gehört. Keine Stimmen, keine Harfen. Mir war auch weder der Duft von Feldblumen oder Obstbäumen noch Schwefelgestank aufgefallen. Ich hatte irgendwo zwischen Himmel und Hölle gebaumelt, gefangen im Dunkel des Vergessens, und nicht einmal mehr gewusst, wer ich war, geschweige denn, wie das Wiegenlied in meiner Kindheit endete.
Irgendwann hatte mich Schlaf überwältigt, unendlich süßer Schlaf. Am liebsten hätte ich, gebettet in warme Schwanenfedern, ewig weitergeschlafen. Damit ich an nichts mehr denken musste. In diesem Zustand, weder tot noch lebendig, hatte ich mir eine Schwäche erlaubt, die ich mir seit Jahren versagt hatte: Ich hatte mein Schicksal in fremde Hände gelegt.
Hatte mich aufgegeben, auch nicht mehr an all diejenigen gedacht, denen ich etwas bedeutete. Sämtliche Entscheidungen über mein Leben hatte jemand anders getroffen …
Es war tief in der Nacht, bis zur Morgendämmerung schien es noch eine Ewigkeit hin zu sein. Allein der Gedanke, je wieder hinauf in die strahlende Sonne zu blicken, nahm sich absurd aus. Ich lag auf dem Rücken, unmittelbar auf dem erstaunlich warmen, wenn auch etwas rauen Boden, der gleichmäßig unter mir atmete. Dicht über mir zogen Sterne dahin. Kalte Sterne, die an die unablässig schlagenden Herzen von Menschen erinnerten. Und die sich allem gegenüber gleichgültig zeigten.
Völlig ungerührt.
Ich starrte wie gebannt auf sie, bis mir irgendwann die Augen tränten, bis mir ein messerscharfer Schmerz in die Hand fuhr und in meiner Brust eine Flamme explodierte, die sich im Nu zu einem wahren Feuersturm auswuchs. Meine Eingeweide verwandelten sich in Kohle, mein Blut in flüssiges Feuer, das durch die Adern brauste. Die Sterne drehten sich wie irr und büßten ihre klaren Linien ein. In meiner unmittelbaren Nähe fauchte es. Als ich mich abstützen und aufstehen wollte, spürte ich die kalte Haut eines Drachen unter mir. Außerdem verhinderten Stricke, mit denen ich gefesselt war, dass ich meinen Plan in die Tat umsetzte. Immerhin gewannen die Sterne ihre alte Gestalt zurück, wurden wieder zu den kalten Gebilden, als die ich sie kannte. Und auch der Drache gab Ruhe.
Eine Frau mit silbrigen Augen beugte sich über mich, legte mir ihre eisige Hand auf die Stirn und sah mich eindringlich an.
„Alles wird gut“, versicherte sie lächelnd.
„Bin ich denn nicht tot?“, stellte ich mit letzter Kraft die dümmste aller denkbaren Frage.
„Nein, Ludwig, das bist du nicht. Aber schlaf lieber weiter, denn die Zeit aufzuwachen ist noch nicht gekommen. Noch bist du zu schwach“, flüsterte die Frau. „Vertraue Brandbart, er bringt uns nach Hause. Dort kommst du wieder zu Kräften.“
„In mir drin …“, hauchte ich, „da brennt alles.“
„Schlafe nur! Es wird alles gut.“
Sie presste mir ihre schlanken Finger gegen die Schläfen. Die silbrigen Augen entfernten sich, die pumpenden Herzen der Sterne erloschen.
„Bei allen heiligen Duckmäusern! Dieser Teufelsspuk jagt mir einfach eine Heidenangst ein! Was also haben wir hier verloren?!“ Apostel hockte auf dem Rand des mit Heilwasser gefüllten Beckens und hatte, wie ich im Licht der durch die Luft schwebenden Waldglüher bestens erkennen konnte, so ziemlich das miesepetrigste Gesicht aufgesetzt, zu dem er imstande war. Und das wollte einiges heißen.
„Du machst dir doch bloß Sorgen um Scheuch“, erwiderte ich gelassen, während mich, obwohl ich ausgestreckt im Becken lag, ein stechender Schmerz in der Seite plagte.
„So weit kommt’s noch, dass ich mir um den Herrn Vogelschreck Sorgen mache. Aber das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, da war er von Kopf bis Fuß mit deinem Blut beschmiert und hatte ein wahnsinniges Funkeln in den Augen. Ich muss dir nicht sagen, welche Rolle Blut bei allen möglichen Ritualen in der dunklen Magie spielt. Um es einmal drastisch auszudrücken: Unser Animatus dürfte da in jeder Hinsicht Blut geleckt haben.“
„Nur hat er mir damals nicht ein Härchen gekrümmt“, hielt ich dagegen.
„Als ob du der Einzige wärst, den er aufschlitzen kann“, knurrte Apostel. „Außerdem hast du ohnehin schon genug Löcher im Körper gehabt. Weshalb hätte er also noch seine Sichel zücken sollen? Wenn ich an all die Wunden denke, ist mir schleierhaft, wieso du damals nicht deinen letzten Atemzug getan hast. Im Übrigen warte ich immer noch auf ein Dankeschön dafür, dass wir dir das Leben gerettet haben!“
„Danke schön“, sagte ich brav. „Und nun hör auf, dir Sorgen zu machen.“
„Wie stellst du dir das denn bitte vor?! Jetzt ist Ende April. Im März haben wir dich gefunden. Damit haben wir fast einen Monat nichts mehr von Scheuch gehört. Sobald damals Hilfe gekommen ist, hat er sich verdrückt. Dabei hatte ich ihn doch inständig gebeten, bei uns zu bleiben!“
„Ehrlich gesagt, hätte ich beim Anblick eines schwarzen Drachen wohl auch Fersengeld gegeben.“
„Aber Scheuch streift jetzt völlig unbeaufsichtigt auf dem Festland umher, während wir hier auf dieser Insel festsitzen.“
„Im Unterschied zu mir kannst du jederzeit von hier verschwinden“, rief ich ihm in Erinnerung. „Wenn du willst, besteige das nächste Schiff und mach dich auf die Suche nach Scheuch.“
Er wischte sich bedächtig das Blut ab, das unablässig aus seiner eingeschlagenen Schläfe strömte.
„Ich soll dich hier auf dieser Teufelsinsel allein lassen?! Wo es mehr böse Geister gibt als bei jedem Hexensabbat in der Christenwelt? Glaub mir, Ludwig, an manchen Tagen würde ich nichts lieber tun als das. Aber Scheuch würde ja eh nicht auf mich hören. Bekanntlich hält er es doch für unter seiner Würde, mit mir auch nur ein Wort zu wechseln. Deshalb werde ich ihn kaum davon überzeugen können, mich zu dir zurückzubegleiten.“
„Er wird schon von selbst kommen, sobald er sein Roggenfeld satthat. So, wie ich ihn mit Blut getränkt habe, muss er in den nächsten Monaten wohl auch nicht auf Nahrungssuche gehen. Seinetwegen brauchst du dir also keine Gedanken zu machen.“
„Dein Wort in Gottes Ohr, Ludwig! Bleibt jedoch die Tatsache, dass auf dieser vermaledeiten Insel in jedem Baum und jedem Strauch irgendein Teufelsspross haust! Wie dir nicht entgangen sein dürfte, haben diese Kreaturen wenig mit guten Christen gemein.“
„Gute Christen triffst du ausschließlich im Paradies oder bei den Predigten von Dorfpriestern. Mitunter frage ich mich sogar, ob es in unserer Welt überhaupt noch gute Menschen gibt, mögen sie nun Christen sein oder nicht.“
„Der Markgraf muss dir ja tüchtig eins über den Schädel gezogen haben, als er dich gefangen gehalten hat“, ätzte meine gute alte, ruhelose Seele. „Anders kann ich mir den Unsinn, den du von dir gibst, nämlich nicht erklären. Gute Menschen trifft man an jeder Ecke. Wenn du mir nicht glaubst, sieh halt in den Spiegel!“
Ich brach in schallendes Gelächter aus.
„Spar dir deine Ironie, mein Freund“, rief ich Apostel dann zur Ordnung.
„Ich werde dir deine düstere Sicht großherzig verzeihen, schließlich kannst du bereits im nächsten Augenblick zu deinen Vorvätern abberufen werden.“
„Du verstehst es, einem Mann Hoffnung einzuflößen“, knurrte ich, denn ich verspürte nicht den geringsten Wunsch, ein so heikles Thema wie meine körperliche Verfassung zu erörtern.
„Nichts leichter und lieber als das“, parierte Apostel. „Ich werde beim Herrn ein gutes Wort für dich einlegen, damit er dich nicht vor der Zeit in seine paradiesischen Gefilde ruft. Unserem Scheuch wollen wir einstweilen sein Vergnügen gönnen. Soll er ruhig ein paar Angehörige des Ordens der Gerechtigkeit aufschlitzen. Diesen Dreckskerl – mag der Herr mir verzeihen, dass ich seine Schöpfung einmal nicht preise –, dem du deinen Aufenthalt in Burg Fleckenstein zu verdanken hast, hat Scheuch jedenfalls aufs Schönste zerhäckselt.“
„Mir ist schon seit geraumer Zeit aufgefallen, dass Scheuch eine besondere Vorliebe für die Ordensmitglieder hegt, wenn er seine Sichel zum Einsatz bringt“, gestand ich. „Allerdings habe ich nicht die geringste Ahnung, worauf sie zurückgeht.“
„Wenn du mich fragst, sitzt ihm die Sichel ja grundsätzlich recht locker. Aber lassen wir das“, sagte er, um dann anzukündigen: „Ich schlendere mal ein wenig runter zum Strand.“
Apostel konnte sich wie ein Kind über das kalte stählerne Meer, das Krachen der Wellen und die Brandung freuen, weshalb er mitunter tagelang am Strand entlangstreifte. Sobald er mich verlassen hatte, schaute ich nachdenklich zu den Waldglühern hoch, die über dem blauen nach Tannen duftendem Wasser schwebten.
Nach einer Weile verwandelten sie sich von gelben Lichtpunkten in hellgrüne und erloschen, worauf die ohnehin dunkle Nacht noch undurchdringlicher anmutete, während die Sterne ungleich heller zu strahlen schienen.
Als ich eine Bewegung in meinem Rücken wahrnahm, sah ich über die Schulter zu den kohlschwarzen Silhouetten der Bäume zurück. Das Blut rauschte mir in den Ohren, in meinen Adern loderte ein Feuer auf, das mein Fleisch schmolz. Kurz entschlossen tauchte ich unter Wasser, um diesen Brand zu löschen.
Als ich wieder auftauchte, kroch aus dem Wald eine riesige silbrige Schlange heran. Kurz vor dem Becken hielt sie inne, damit sich unsere Blicke kreuzen konnten, danach glitt sie geschmeidig ins Wasser. Es war ein gigantisches Reptil, weshalb der geschuppte Körper sich noch immer nicht vollständig aus dem Wald herausgeschlängelt hatte, obwohl der dreieckige Schlangenkopf längst vor meiner Nase aufragte. Das Tier zischte, ließ die gespaltene Zunge hervorschnellen, riss das Maul auf und rammte mir die Zähne in die Schulter.
Stünde dieser Schlange der Sinn danach, könnte sie mir mit einem einzigen Biss den Arm abtrennen. Ach was, sie könnte jedem Ochsen die Knochen zermalmen. Insofern musste ich mich glücklich schätzen, dass sie in mir keine Beute sah.
Ihr Gift drang wie geschmolzenes Metall in mein ohnehin verseuchtes Blut und brachte es noch stärker zum Brodeln. In meiner Brust brach ein Feuersturm los, der mich bei lebendigem Leibe zu verbrennen drohte.
Der Schmerz ließ mich stöhnen. Wahrscheinlich wäre ich untergegangen, hätte ich mich nicht an dem kräftigen Schlangenkörper festklammern können. Meine Arme um den Leib des Tieres geschlungen, schnappte ich nach Luft. Behutsam, ja, geradezu zärtlich wand sich das Reptil um mich.
„Es geht schon wieder“, versicherte ich, sobald der Anfall überstanden war.
Sofort gab Sophia mich frei, hielt sich aber bereit, mich jederzeit zu packen, sollte ich doch untergehen.
„Wirklich?“, fragte sie nach und sah mir fest in die Augen.
„Bestimmt.“ Es kostete mich gewaltige Anstrengung, meine Stimme fest klingen zu lassen. „Ich bin wohlauf.“
Ich lehnte mich gegen den Beckenrand und wartete darauf, dass das Gift in meine Muskeln eindrang.
„Deine Genesung nimmt längst nicht den Verlauf, den sie nehmen sollte“, stellte Sophia mit einem schweren Seufzer fest. „Das Gift der Oculla und meine … meine Medizin liefern sich in deinem Körper einen unerbittlichen Kampf. Das nächste Mal sollte ich dir deswegen wohl eine geringere Dosis zukommen lassen.“
„Besser nicht, sonst hocke ich noch bis zum Jüngsten Gericht hier“, widersprach ich. „Das kann ich mir aber nicht leisten, denn auf mich wartet ein Haufen Arbeit.“
Das klang weitaus gröber als beabsichtigt.
„Tut mir leid, Sophia“, entschuldigte ich mich deshalb sofort. „Deine … deine Medizin hilft natürlich. Trotzdem lässt sich wohl niemand gern Schlangenzähne in den Körper rammen.“
Die Worte entlockten ihr ein glockenhelles Lachen. Abermals schwebten die Waldglüher heran und kreisten über unseren Köpfen.
„Glaub mir, Ludwig, diese Art der Behandlung gefällt niemandem.“
Über ihre nackte Haut rannen Wassertropfen. Ich achtete strikt darauf, ihr ausschließlich ins Gesicht zu sehen. Sie lächelte, als hätte sie meine Gedanken gelesen, und wrang die nassen, glitzernden Haare aus.
„Wann werde ich wieder ganz der Alte sein?“, fragte ich leise.
„Ich weiß, dass die Behandlung schmerzhaft ist, aber wie ich bereits gesagt habe, ist dein Zustand weit schlimmer, als ich angenommen habe. Noch mindestens zwei Wochen, würde ich daher meinen.“
Ich stieß einen Fluch aus. Wunderbar. Damit würde ich diese Insel erst Mitte Mai wieder verlassen.
„Ich will ganz gewiss nicht behaupten, dass ich deiner Gesellschaft überdrüssig wäre, schon gar nicht, wenn du nicht gerade meine Krankenschwester spielst“, versicherte ich und erntete die Andeutung eines Lächelns. „Aber ich bin ein Seelenfänger, ich habe mich um …“
„Deine dunklen Seelen müssen halt noch etwas auf dich warten.“
„Das kannst du doch nicht ernst meinen!“
„Jetzt hör mir mal zu!“ Zum ersten Mal, seit wir uns kannten, erhob sie in meiner Gegenwart die Stimme. „Die Bruderschaft wird schon noch ein Weilchen ohne dich auskommen. Das hat sie vor deiner Zeit ganz gut geschafft, das wird sie auch jetzt hinkriegen. Du wirst exakt so lange in den Genuss meiner Gastfreundschaft kommen, wie ich es sage, und mich erst verlassen, wenn ich – und nur ich! – es dir erlaube. Falls du dich nicht daran hältst, kommst du vielleicht von unserer Insel weg – dann aber auch sehr schnell ums Leben! Habe ich mich klar genug ausgedrückt?“
„Ja, hast du.“
„Sehr schön“, erwiderte sie nun wieder in dem sanften Ton, den ich von ihr kannte. „Denn wir müssen dein Blut reinigen. Früher oder später wird mein Gift das der Oculla zersetzen. Du wirst selbst als Erster merken, wenn es so weit ist.“
„Tut mir leid, dass ich immer wieder vergesse, dass mit dieser Sache nicht zu spaßen ist. Wir Seelenfänger sind halt einfach nicht daran gewöhnt, krank zu sein.“
„Du bist auch nicht krank, sondern von einer Oculla verletzt worden. Wenn du nur die üblichen Wunden davongetragen hättest, dann würde das Waldwasser sie in wenigen Stunden heilen. Aber deine Wunden sind noch immer besorgniserregend.“
In diesem Moment stieß irgendwo im Wald ein Uhu einen lauten und durchdringenden Schrei aus.
„Für mich wird es Zeit“, sagte Sophia. „Bis nachher, Ludwig!“
„Bis nachher, Sophia!“
„Ach ja, ich habe gehört, dass Zif frech zu dir war. Wenn er es zu doll treibt, darfst du ihm gern eins hinter die Löffel geben.“
Zif hatte mir gestern irgendein Mistzeug in den Tee gegeben, das mich eine geschlagene Stunde hatte sabbern lassen. Zum unsagbaren Vergnügen dieses Burschen, versteht sich, der aus sicherem Abstand schallend über mich gelacht hatte.
„Das werd ich machen“, versicherte ich.
Sophia schwamm zum Beckenrand, stützte sich mit beiden Händen daran ab und zog sich hoch. Obwohl sie nackt war, zeigte sie keinerlei Befangenheit, als sie ihr Gewand aus dem Gras hob.
„Guervo hat noch ein Anliegen an dich“, teilte sie mir mit.
„Mhm.“
Sophia lächelte mir noch einmal zu, dann wurde sie vom Dunkel der Nacht geschluckt.
Trotzdem sah ich ihr noch lange nach.
„Glaubst du eigentlich“, wandte ich mich dann an Apostel, „sie merkt nicht, wie du sie begaffst, du alter Lustmolch?“
Meine gute alte, ruhelose Seele knurrte etwas in ihrem Versteck, dann verschwand auch sie.
Nach dem Biss schmerzte mein Arm furchtbar. Die Oculla, die mir in Burg Fleckenstein so zugesetzt hatte, war nicht gerade knickrig gewesen, als es darum ging, meinen Körper mit Gift vollzupumpen. Vielleicht hätten Reliquien uns im Kampf gegen das Gift dieser dunklen Seele gute Dienste geleistet, doch die waren auf der Insel ebenso wenig aufzutreiben wie ein Drache im Rathaus von Ardenau.
Allerdings barg der Dunkelwald auf diesem Eiland am westlichen Ende der Welt ein noch stärkeres Gegengift. Dafür musste ich Sophia und ihrer Magie dankbar sein. Im Grunde machte meine Genesung auch ganz gute Fortschritte, schließlich brauchte ich das Bett schon lange nicht mehr zu hüten.
Da der eisige Nachtwind mich frösteln ließ, zog ich mich rasch an. Die Waldglüher waren fast alle wieder davongeflogen, nur einer war geblieben und sorgte dafür, dass ich nicht völlig im Dunkeln dastand.
Nachdem ich auch noch den Gürtel mit meinem schwarzen Dolch angelegt hatte, schlenderte ich einen mit perlmuttfarbenen Muscheln gesäumten Weg zu Guervos Haus entlang. Der Waldglüher schwebte unmittelbar hinter mir, eine Fürsorge, für die ich ihm äußerst dankbar war, wäre es doch kein Vergnügen, durch die Finsternis zu tapsen. Grob gesprochen hätte es dabei zu gewissen Missverständnissen zwischen mir und der hiesigen Bevölkerung kommen können. Einmal war mir das schon passiert, da hatten mich ein paar Rugarus mit ihrer Nachtmahlzeit verwechselt und beinahe in Hacksteaks verwandelt. Diese Anderswesen waren nämlich völlig nachtblind.
Deshalb achtete ich inzwischen darauf, nie allein unterwegs zu sein. Nachts begleitete mich ein Waldglüher, tagsüber Zif, ein echter Kauz, der sich bei Guervo durchschmarotzte. Ob er irgendeine Aufgabe hatte, war mir nach wie vor ein Rätsel. Er schlief unterm Dach, futterte wie ein Scheunendrescher und fing wegen jeder Kleinigkeit Streit an. Ich an Guervos Stelle hätte diesen nichtsnutzigen Spitzbuben längst achtkantig rausgeworfen.
Erst vor ein paar Tagen war mir mal wieder die Hutschnur geplatzt, als Zif darüber gejammert hatte, dass am Fleisch Salz fehle. Da hatte ich ihm in aller Deutlichkeit ausgemalt, was ein Kirchenmann auf dem Festland mit einem wie ihm anstellen würde: Mit Weihwasser übergießen würde er ihn, auf den Scheiterhaufen werfen oder den Schlägermönchen vom Caliquerorden überlassen.
„Dann kann ich ja nur von Glück sagen, dass ich bei Guervo gelandet bin“, hatte er daraufhin völlig unbekümmert erwidert. „Das Fleisch ist zwar echt zähe Kost, aber solltest du es nicht wollen, würde ich mich deiner Portion erbarmen.“
Auf dieser weitläufigen Insel, die so groß war wie das Fürstentum Vierwalden oder das Königreich Broberger, konnte sich der alte Zif in der Tat sicher fühlen, denn im Dunkelwald richtete die Magie der Kirchenleute nichts aus. Selbst wenn der Heilige Vater samt seiner ganzen heiligen Gefolgschaft oder die Apostel des Herrn persönlich einmal im Dunkelwald auftauchen würden, wären sie außerstande, auch nur den harmlosesten Zauber zu wirken. Ob es ihnen schmeckte oder nicht – sie würden sich durch nichts mehr von gewöhnlichen Menschen unterscheiden.
Dennoch hatte die Kirche wiederholt versucht, auch im Dunkelwald Fuß zu fassen, war aber mit diesen grandiosen Plänen jedes Mal fulminant gescheitert. Dem Heiligen Stuhl wurde derart eingeheizt, dass er fürderhin darauf verzichtete, auf dieser Insel zu landen. Die Zauberer, Hexen und Anderswesen, die in diesen düsteren Wäldern hausten, hatten nämlich einen ganz unbestreitbaren Vorteil auf ihrer Seite: Ihre Magie klappte hier noch. Ganz hervorragend sogar.
Die Kirche erklärte den Dunkelwald daraufhin zu einem verfluchten Gebiet und verbot es allen Menschen der aufgeklärten Welt unter Androhung der Exkommunikation, diese Insel zu besuchen. Der Dunkelwald, dieses letzte Bollwerk alter Magie, hatte damit fast achthundert Jahre lang seine Ruhe. Hier überdauerte eine ursprüngliche Kraft, die von der Kirche nicht gebilligt wurde, hier tummelten sich die letzten Anderswesen, die früher auch auf dem Festland anzutreffen gewesen waren und dort Seite an Seite mit den Menschen gelebt hatten.
Es hatten angeblich auch immer wieder Menschen versucht, auf die Insel zu fliehen, bedauernswerte Zeitgenossen, die hier vor der Inquisition Schutz suchen wollten, ehe ihnen der Prozess wegen Zauberei, dem Besitz verbotener Bücher, Leichenöffnung zum Zwecke anatomischer Studien, Verbreitung alter heidnischer Lehren oder der Vivisektion von Fröschen auf Grundlage chagzhidischer Lehrwerke gemacht wurde. Sie wurden jedoch nur selten mit offenen Armen empfangen, meist wies man sie trotz inständiger Bitten, doch bleiben zu dürfen, ab.
Ich hatte Sophia einmal danach gefragt, wer eigentlich entscheide, ob man auf der Insel bleiben dürfe oder sie wieder verlassen müsse.
„Der Dunkelwald selbst“, hatte sie geantwortet. „Sein Herz. Wir halten uns stets an seine Entscheidung.“
„Was ist mit mir? Hat über mich auch der Dunkelwald entschieden?“
„Einigen wir uns darauf, dass du mein persönlicher Gast bist“, hatte sie erwidert. „Weil mir so gut gefallen hat, wie du auf dem Ball beim Hexensabbat das Tanzbein geschwungen hast.“
Deutlicher hätte sie mir nicht zu verstehen geben können, dass sie über das Thema eigentlich nicht reden wollte …
„›Dunkler Orden‹ ist in einem lockeren Stil erzählt, der das Abenteuerliche und Exotische der Geschichte betont.“
„Die Qualität der Erzählungen hat seit dem ersten Band nicht abgenommen. Sie brauchen zwar manchmal etwas, um in Fahrt zu kommen, fesseln den Leser dann aber bis zum Ende.“



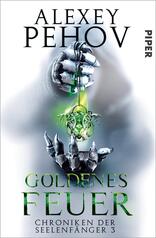




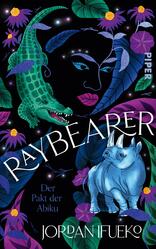


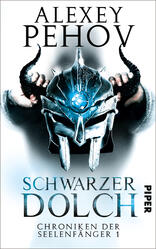




Kőnnen Sie mir bitte erteilen wann die Teile 3 und 4 erscheinen. Ich habe angefangen mit Teil 2 und mőchte gern erfahren wie alles am ende ablauft. Ich lese kein Russisch deshalb bin ich angewiesen auf Piper. Hochachtungsvoll, Diana
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.