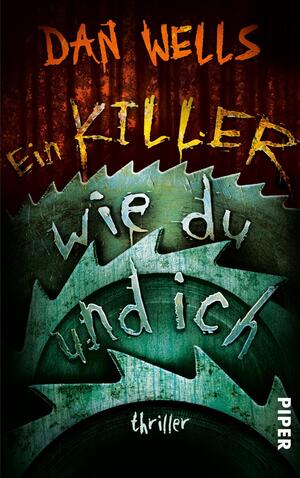
Ein Killer wie du und ich (Serienkiller 6) - eBook-Ausgabe
Thriller
„›Ein Killer wie du und ich‹ liefert als äußerst gelungener Abschlussband gleichzeitig ein authentisches Gesamtbild aller sechs Romane.“ - legimus.blogspot.de
Ein Killer wie du und ich (Serienkiller 6) — Inhalt
John Cleaver ist nicht irgendein junger Mann. Er ist ein Serienkiller. Er kann Dämonen sehen. Doch er kämpft für das Gute. Und er ist unsere einzige Hoffnung auf Rettung ... Im lang erwarteten sechsten Roman führt Bestsellerautor Dan Wells seinen gebrochenen Helden John Cleaver in den finalen Kampf gegen die Mächte des Schreckens, die unsere Welt an sich reißen wollen. Der Abschluss der ebenso erfolgreichen wie kontroversen Reihe ist ein Muss für alle Dan-Wells-Fans!
Leseprobe zu „Ein Killer wie du und ich (Serienkiller 6)“
Kapitel 1
Es gibt nicht viele Möglichkeiten, sich eine Leiche genau anzusehen.
Natürlich kann man selbst jemanden töten. So halten es die meisten. Das geht schnell, ist billig, und man kann es mit den Hilfsmitteln bewerkstelligen, die man zu Hause gerade zur Hand hat, etwa mit einem Hammer oder einem Küchenmesser. Man sucht sich einen Verwandten, der keine Ruhe geben will – und peng! So bekommt man eine Privatleiche. Wenn man schon über Heimwerkerarbeiten spricht, dann ist ein Mord viel einfacher zu begehen und kommt viel häufiger vor als ein Anstrich [...]
Kapitel 1
Es gibt nicht viele Möglichkeiten, sich eine Leiche genau anzusehen.
Natürlich kann man selbst jemanden töten. So halten es die meisten. Das geht schnell, ist billig, und man kann es mit den Hilfsmitteln bewerkstelligen, die man zu Hause gerade zur Hand hat, etwa mit einem Hammer oder einem Küchenmesser. Man sucht sich einen Verwandten, der keine Ruhe geben will – und peng! So bekommt man eine Privatleiche. Wenn man schon über Heimwerkerarbeiten spricht, dann ist ein Mord viel einfacher zu begehen und kommt viel häufiger vor als ein Anstrich des Wohnzimmers, aber – um ehrlich zu sein – man kann die Sache viel schwerer vertuschen. Obendrein gibt es noch andere Hemmnisse. Zuerst einmal ist es ein Mord, und so etwas tut man nicht. Zweitens, und für meine eigene Situation noch bedeutsamer, ist es erforderlich, dass der Tote, den man sich ansehen will, zu Lebzeiten leicht erreichbar gewesen sein muss. Bei den wirklich interessanten Leichen trifft das leider nur selten zu. Nehmen wir an, Sie wollen einen ganz bestimmten Leichnam untersuchen. Um einfach mal ein Beispiel aus dem Ärmel zu schütteln, stellen wir uns eine alte Dame vor, die unter mysteriösen Umständen in einer Kleinstadt in Arizona ums Leben gekommen ist. In einem solchen Fall wird es erheblich schwieriger.
Falls Sie sich eine ganz bestimmte Leiche ansehen möchten, hilft es sehr, wenn Sie ein Cop sind. Oder, noch besser, ein FBI-Agent. Dann können Sie sich mühelos einen Vorwand einfallen lassen, warum gerade diese Leiche ein wichtiger Bestandteil Ihrer Ermittlungen sei, und daraufhin gehen Sie einfach rein, zücken die Dienstmarke, und die Sache ist geritzt. Möglicherweise entspricht es sogar der Wahrheit. Das wäre eine nette Dreingabe, ist allerdings nicht unbedingt nötig. Wenn Sie kein richtiger Ordnungshüter sind, aber das Geschäft gut genug kennen, können Sie mit einem falschen Abzeichen hineinmarschieren und versuchen, das Gleiche zu erreichen. Falls Sie aber beispielsweise erst achtzehn sind, haben Sie wahrscheinlich große Schwierigkeiten, die Ortspolizei zu überzeugen. Das Gleiche gilt für einen Jugendlichen, der sich als Leichenbeschauer, Gerichtsmediziner oder Reporter ausgeben will. Manchmal hatte ich Erfolg mit der Behauptung, ich würde für eine Schülerzeitung recherchieren. Das klappt ganz gut, solange das Objekt der Untersuchung keine verwesende menschliche Leiche ist.
Damit bleiben noch drei andere Möglichkeiten. Wenn man schnell genug ist, kann man den Leichenbeschauer vielleicht davon überzeugen, man sei der neue Fahrer der örtlichen Leichenhalle und habe den Auftrag, den Toten abzuholen und zum Einbalsamieren abzutransportieren. Dazu muss man ein paar Papiere fälschen, aber der Aufwand ist nicht so groß, wie man glauben könnte, denn als angeblicher Fahrer ist man ein unbedeutender Mitarbeiter, dessen Alter keine große Rolle spielt. Wenn man in einem Bestattungsunternehmen aufgewachsen ist, seit dem Alter von zehn Jahren im Familienbetrieb ausgeholfen hat und daher den ganzen Betrieb in- und auswendig kennt – auch dies wieder nur, um ein Beispiel aus dem Ärmel zu schütteln –, dann kommt man damit sogar ziemlich leicht durch. Das klappt jedoch nur, wenn man rechtzeitig eintrifft. Falls man zu spät kommt, weil man zwei Bundesstaaten entfernt ist und per Anhalter reist (der Grund ist eigentlich auch egal, wichtig ist nur, dass man zu spät kommt), muss man sich für die zweite Möglichkeit entscheiden, die mehr oder weniger die gleichen Fähigkeiten erfordert: nach Feierabend in die Leichenhalle einbrechen und sich umsehen. Ich sage hier, dass es mehr oder weniger die gleichen Fähigkeiten sind, weil man nie weiß, wie gut das Sicherheitssystem der Leichenhalle ist, und weil man rein hypothetisch gesehen eben ein jugendlicher Bestatter, aber kein Fassadenkletterer ist. In einer Kleinstadt oder sogar in einem größeren Ort – und wenn das Bestattungsunternehmen über eine entsprechende Tradition verfügt –, könnte das funktionieren, weil nicht jede Leichenhalle über genügend Geld verfügt, um alles auf dem neuesten Stand zu halten. Das ist ein Problem, unter dem die ganze Branche leidet.
Aber nehmen wir an, die Firma hat die Einrichtung modernisiert – nicht mit einer Kamera, sondern mit einem Bewegungsmelder –, und Sie wollen keinesfalls erwischt werden, wenn Sie bei einem Bestatter einbrechen. Ich meine, vermutlich will sowieso niemand bei einem Einbruch erwischt werden, aber nehmen wir in diesem Fall beispielsweise mal an, dass Sie ganz, ganz bestimmt nicht erwischt werden wollen. Wir gehen sogar so weit zu sagen, dass die bereits erwähnten Ordnungshüter, die zu imitieren unser völlig hypothetischer jugendlicher Beerdigungsexperte vorübergehend versucht war, sogar aktiv nach ihm suchen. Deshalb scheiden illegale Wege von vornherein aus. Damit bleibt uns nur noch eine einzige Möglichkeit: Wir müssen warten, bis der Bestatter die Türen öffnet, die Leiche ins Hinterzimmer schiebt und alle hereinbittet, die das Bedürfnis haben, von dem Toten Abschied zu nehmen. Aber das wird niemals passieren, oder?
Falsch. Man nennt es Aufbahrung, und es geschieht jeden Tag. Natürlich darf man dort nicht herumschnüffeln, aber es ist besser als gar nichts. Und im Fall von Kathy Schrenk, einer kleinen alten Dame, die in Lewisville in Arizona unter geheimnisvollen Umständen gestorben war, hatte der Bestatter die Aufbahrung für diesen Tag angesetzt. Vor der Tür stand ein jugendlicher Einbalsamierer mit FBI-Erfahrung und hoffte, dass sein Anzug nicht zu schmutzig war.
Hallo, ich bin John Cleaver, und mein Leben scheint ziemlich verrückt zu sein, wenn ich es auf diese Weise darstelle.
Ich kann es auch anders beschreiben, aber das klingt bestimmt nicht normaler: Ich jage Monster. Früher habe ich es allein getan, eine Weile habe ich mit einem spezialisierten Team der Behörde zusammengearbeitet, aber dann haben uns die Monster gefunden und fast alle umgebracht. Jetzt jage ich sie wieder allein. Die Monster nennen sich die Verwelkten oder manchmal die Verfluchten, mitunter auch die Gesegneten, wenn man mal einem begegnet, der guter Dinge ist, aber das kommt heutzutage nur selten vor. Sie sind alt und müde und klammern sich eher aus Starrsinn denn aus irgendeinem anderen Grund an das Leben. Früher waren sie Menschen, aber sie haben einen wesentlichen Teil ihrer Persönlichkeit aufgegeben – die Erinnerungen, die Gefühle oder ihre Identität. Das ist bei jedem anders, und jetzt sind sie keine Menschen mehr. Einer sagte mir mal, sie seien zugleich mehr und weniger als die Menschen. Zehntausende von Jahren lang besaßen sie unglaubliche Kräfte und beherrschten die Welt als Könige und Götter, aber jetzt knirschten sie mit den Zähnen und versuchten nur noch, irgendwie zu überleben.
Kathy Schrenks geheimnisvoller Tod war das klassische Futter für die Käseblätter. Sie war weit entfernt vom Wasser ertrunken, und der Körper war durchnässt, während ringsum alles knochentrocken war. Seltsam, aber nicht unbedingt übernatürlich. Miss Marple hätte den Fall vermutlich in der Mittagspause gelöst. In neun von zehn Fällen – oder in neuntausend von neuntausendundeins Fällen – steckte ein ganz normaler Zeitgenosse dahinter, der eifersüchtig, wütend oder gelangweilt war. Wir sind schreckliche Menschen, wenn man es recht betrachtet. Kaum wert, dass man uns rettet.
Aber was sollte ich denn tun? Damit aufhören?
Ich starrte die Leichenhalle eine ganze Weile an: Ottensen Brothers Funeral Home. Ich zupfte einen Flusen vom Ärmel, strich mir über das Haar, zupfte einen weiteren Flusen ab. Jetzt oder nie.
So hielt ich es schon seit Monaten, seitdem das Team gestorben war. Ich hatte Brooke nach Hause geschickt und war auf eigene Faust aufgebrochen, um die Verwelkten ohne Verstärkung, ohne Führung und ohne aktuelle Informationen zu jagen. Ich hielt Ausschau nach Anomalien und ging den Hinweisen nach. Meist kam nichts dabei heraus, und ich zog einfach weiter.
Ich betrat das Gebäude.
Die hypothetische Situation, die ich gerade beschrieben habe, war gar nicht so hypothetisch. Ich bin tatsächlich in einem Bestattungsinstitut aufgewachsen, aber das haben Sie vermutlich schon geahnt. Meine Eltern waren Bestatter, und wir lebten in einer kleinen Wohnung über der Kapelle. Mit zehn durfte ich bei den Beerdigungen helfen, und einige Jahre später habe ich selbstständig Leichen einbalsamiert. Als ich das Geschäft der Ottensen Brothers betrat, fühlte ich mich in meine eigene Vergangenheit zurückversetzt. Die geschmackvollen, dezenten Dekorationen, die mindestens ein Jahrzehnt aus der Mode waren, der halbmondförmige kleine Tisch mit dem Gästebuch und einem nur scheinbar kostbaren Füller, diese seltsame Mischung aus Kultiviertheit, echter Frömmigkeit und einem banalen Wasserspender an der Wand. Ich berührte die Tapete – elegant, aber abgestoßen und robust genug, um dem Gedränge der Menschen und den unerfahrenen Sargträgern standzuhalten. Währenddessen dachte ich über mein früheres Zuhause nach, das ich seit fast drei Jahren nicht mehr betreten hatte. Hin und wieder hatte ich es kurz in den Nachrichten gesehen. Meine Schwester und meine Tante führten das Bestattungsunternehmen inzwischen, aber wer konnte schon voraussagen, wie lange sie das noch schafften? Allein kamen sie nicht so gut zurecht, und mein Vater half ihnen bestimmt nicht. Meine Mutter … nun ja, auch sie war nicht mehr da, um ihnen zu helfen.
Ihre Leiche war so verstümmelt gewesen, dass ich sie nicht einmal einbalsamieren konnte. Diese Arbeit hatten wir als Einziges miteinander geteilt, und selbst das wurde uns verwehrt.
Kathy Schrenk hatte nicht viele Besucher. Überwiegend waren es ältere Damen, die bis zu ihrer eigenen Aufbahrung nicht mehr viel Zeit hatten, dazu ein halbes Dutzend alter Männer. Irgendjemand hatte an der Tür einen Tisch mit Fotos und Andenken aufgestellt. Es gab viele Gruppenbilder und einige Porträts, auf denen sie allein zu sehen war. Anscheinend hatte sie nie geheiratet und keine Kinder bekommen. Einige Aufnahmen zeigten eine Frau, die eine Zwillingsschwester sein konnte, und auf einem Foto stand Kathy Schrenk vor dem Bestattungsunternehmen und hatte den Arm um eine etwa fünfzigjährige große Frau gelegt. Ein seltsamer Platz für ein Foto – vielleicht war es bei der Beerdigung einer anderen Freundin entstanden? Aber nein, die beiden trugen keine Trauerkleidung. Waren sie Angestellte? Die übrige Tischfläche war mit kleinen Strickmützen und Halstüchern bedeckt. Wahrscheinlich hatte die Tote gern gestrickt. Ich ging an dem Tisch vorbei und betrat den Aufbahrungsraum. Der Sarg stand zwischen zwei Flaggen an der hinteren Wand und war von Stühlen und Sofas umgeben. Auf den meisten saßen alte Frauen, die sich leise unterhielten. In einer Ecke standen auf einem Tisch Erfrischungsgetränke und staubtrockene Kekse bereit.
„Sieht sie nicht schrecklich aus?“, fragte eine alte Dame am Tisch. Versuchte sie zu flüstern, oder tat sie nur so und wollte in Wahrheit gut gehört werden? Vielleicht wusste sie auch einfach nicht, wie sie die Stimme dämpfen sollte. „Ich habe noch nie einen toten Menschen gesehen, der dem lebenden Vorbild so wenig ähnlich war.“
Langsam ging ich an den Frauen vorbei zum Sarg und tat so, als würde ich dazugehören.
„Hallo.“ Ein Mann trat vor und reichte mir die Hand. Ich schlug ein. „Sind Sie ein Freund von Kathy?“ Er war sechzig oder fünfundsechzig Jahre alt.
„Ein Bekannter.“ Rasch spulte ich die vorbereitete Geschichte ab. „Sie war mit meiner Großmutter befreundet, die heute aber nicht herkommen kann. Deshalb soll ich ihr die letzte Ehre erweisen.“
„Wundervoll!“, sagte er. „Wie heißt Ihre Großmutter?“
„Julia.“ Ich kannte keine Julia, aber ein Name war so gut wie jeder andere.
„Ich glaube, Kathy hat sie mal erwähnt“, antwortete der Mann. Mir war nicht klar, ob ich zufällig einen zutreffenden Namen gewählt hatte oder ob der Mann nur höflich sein wollte. „Und wie heißen Sie, junger Herr?“
„Robert.“ Ich hatte einen Namen gewählt, der hoffentlich so häufig war, dass er ihn gleich wieder vergaß, falls später jemand danach fragen sollte. Aufgrund meiner Erfahrungen beim FBI versuchte ich, nie zweimal den gleichen falschen Namen zu benutzen. Ich sah ihn kurz an – abgetragener Anzug, die Hosenbeine hatten ein wenig Hochwasser, ein schlichtes weißes Hemd, das an den Ärmeln und am Kragen leicht ausfranste. Der Mann trug diese Kleidung sehr oft, also stellte ich die naheliegende Frage: „Arbeiten Sie hier in der Leichenhalle?“
„Ja“, bestätigte er und gab mir noch einmal die Hand. „Harold Ottensen, ich bin der Fahrer.“
„Der Fahrer?“ So viel zu meiner Annahme, Fahrer seien meist jung. „Dann nehme ich an, Ihr Bruder ist der Bestatter.“
„Das war er, aber leider ist er schon vor zwanzig Jahren gestorben.“
„Das tut mir leid.“
„So geht es eben manchmal“, sagte er. „Unsere Familie kennt sich ja damit aus. Margo erledigt jetzt alles. Sie muss hier irgendwo in der Nähe sein.“
Ich nickte, war aber von dem Small Talk bereits gelangweilt. „Es war schön, Sie kennenzulernen, Harold. Ich will mich jetzt verabschieden.“
Er nickte und bot mir zum dritten Mal die Hand. Bevor ich mich verdrücken konnte, kam eine andere alte Dame mit strengem Blick auf uns zu.
„Das ist absolut unmöglich“, schimpfte sie. „Können Sie denn nichts tun?“
„Ich habe es Ihnen doch gesagt, so sehen sie eben manchmal aus“, entgegnete Harold.
„Aber das ist Ihre Aufgabe“, beharrte die Frau. „Warum sind wir überhaupt hier, wenn Sie nicht einmal Ihre Arbeit erledigt haben?“
Inzwischen brannte ich darauf, die Tote zu sehen, und fragte mich, auf welch schrecklichen Anblick ich mich gefasst machen musste. Also überließ ich Harold seinem Schicksal und trat an den Sarg. Eine andere, viel jüngere Frau stand schon davor. Nicht viel älter als ich, neunzehn oder zwanzig, mit dunkler Haut. Vielleicht eine Mexikanerin? Sie wirkte unglücklich und sah finster drein, nahm sich aber zusammen, als sie mich aus den Augenwinkeln bemerkte.
Die Tote kam mir trotz aller Klagen recht normal vor. Kathy hatte auf den Fotos schmal gewirkt und war jetzt noch schmaler, das graue Haar lockte sich, das bleiche Gesicht wirkte hager. Ich hatte mit sichtbaren Verletzungen oder sonstigen Merkmalen gerechnet, die den Angriff eines Verwelkten verrieten – einer riesigen Bisswunde im Gesicht oder wenigstens einem Hinweis, dass es beim Einbalsamieren Probleme gegeben hatte. Dass man vielleicht das Gesicht nicht richtig hinbekommen hatte, weil die Augenlider eingefallen oder die Wangen hohl waren. Irgendein Anzeichen, das die Klagen der alten Freundinnen gerechtfertigt hätte. Was ich sah, war jedoch viel einfacher und so überraschend, dass ich es laut aussprach.
„Sie haben das Make-up vermasselt.“
„Verzeihung?“, sagte das Mädchen neben mir.
„Entschuldigung, ich war nur überrascht!“, stieß ich hervor.
„Du bist ein Trottel“, erklärte sie.
„Wie bitte?“
Sie lächelte ironisch. „Es hat dich also überrascht, aha. Passiert das nicht jedem mal? Dass er einfach damit herausplatzt, was ihm durch den Kopf geht? Also fassen wir zusammen: Wir stehen hier vor meiner toten Freundin, und irgendein Schwachmat macht sich ausgerechnet über ihr Make-up lustig.“
„Tut mir leid“, antwortete ich. „Ich halte jetzt lieber den Mund.“
„Ja, das ist gut. Ich sage auch nichts mehr und warte einfach ab, bis du wieder verschwindest.“
Das lief ja ausgezeichnet. „Ich … einen Augenblick noch, bitte!“ Ich achtete nicht weiter auf die junge Frau und betrachtete wieder die Tote. Zu den Aufgaben eines Bestatters – eigentlich war das nach dem Einbalsamieren sogar der wichtigere zweite Teil – gehörte es auch, den Toten möglichst naturgetreu so herzurichten, wie er im Leben ausgesehen hatte. Mit der armen Miss Schrenk stimmte allerdings etwas nicht. Ein gewöhnlicher Betrachter hätte nichts Auffälliges bemerkt, aber die Kleinigkeiten wirkten zusammen, und die Tote sah insgesamt eigenartig aus. Unverkennbar wie eine Tote und nicht wie ein Mensch, der in Frieden ruhte. Es machte mich unwillkürlich nervös, aber mit geübtem Auge erkannte ich, dass die Verantwortlichen nur wenige Kleinigkeiten falsch gemacht hatten.
Die Grundierung war sogar ganz gut gelungen. Tote hatten kein Blut mehr im Körper, deshalb waren sie viel blasser als im Leben. Der Make-up-Künstler der Leichenhalle hatte eine dunkle Grundierung und darüber eine helle aufgelegt, um dem Gesicht wieder etwas Farbe zu geben. Das zweite große Problem waren häufig die großen dunklen Ringe unter den Augen, die wie Prellungen aussahen. Auch die hatte der Maskenbildner gut verdeckt. Das war schwierig, und daher war es umso verwirrender, dass bei Kathy Schrenk etwas viel Einfacheres übersehen worden war: der Schattenwurf. Wir waren daran gewöhnt, die Menschen aufrecht zu sehen. Wenn sie lagen – besonders im künstlichen Licht eines Aufbahrungsraums –, wirkten die Gesichter falsch. An den Nasenflügeln und den Lippen stimmten die Schattierungen nicht mehr. Ein geübter Leichenkosmetiker hätte das richtig hinbekommen, aber hier war es offenkundig misslungen.
Die junge Frau neben mir sprach weiter: „Bist du von Cottwell’s?“
„Cottwell’s?“
„Ja, du Genie. Cottwell’s. Lewisvilles ältestes Bestattungsunternehmen … oder wie sie jetzt für sich werben. Du bist doch hoffentlich kein Spion oder so was?“
„Ich stamme gar nicht aus Lewisville, aber ich komme aus einer Bestatterfamilie“, erwiderte ich. „Tut mir leid, dass ich in Bezug auf deine Freundin so unhöflich war.“ Ich hielt inne und dachte kurz nach. Warum machte sie sich wegen Cottwell’s so große Sorgen? Und warum dachte sie, die Firma habe einen Spion geschickt? Mir fiel nur ein einziger Grund ein. „Arbeitest du hier in der Leichenhalle?“
Sie kniff die Augen zusammen. „Woher weißt du das, wenn du kein Spion bist?“
„Warum spionieren sich die Bestatter gegenseitig aus?“
„Das weiß ich nicht. Was haben sie dir denn erzählt, als sie dich angeheuert haben?“
„Das haben sie nicht … Hör mal, es tut mir leid, dass ich unhöflich war, ja? Ich habe deine verstorbene Freundin beleidigt, und anscheinend habe ich auch deinen Freund beleidigt, der hier für das Make-up zuständig … oh, verdammt!“
Sie lächelte spöttisch, als es mir dämmerte. „Genau.“
„Du bist es, oder? Du hast sie geschminkt.“
„Nur aushilfsweise“, räumte sie ein. „Eigentlich bin ich für das Einbalsamieren zuständig. Es ist schon komisch, wie lange du brauchst, um darauf zu kommen.“
„Ja, sehr komisch.“ Ich benötigte weitere Informationen, und die junge Frau war bisher mein einziger Ansatzpunkt. Ob sie nun etwas gegen mich hatte oder nicht, ich musste die Gelegenheit ergreifen. „Wer war denn sonst für das Make-up zuständig?“
„Keine Sorge, das findest du auch noch heraus.“
Ich schloss die Augen, als das nächste Puzzleteil seinen Platz fand. „Das war Kathy Schrenk.“
„Erstaunlich.“
„Und deshalb ist eine Zwanzigjährige mit einer alten Dame befreundet“, fuhr ich fort. „Ihr wart Kolleginnen. Und deshalb stimmt das Make-up nicht, denn der einzige Mensch, der hier weiß, wie man es macht, ist jetzt tot. Und keiner von euch wollte Cottwell’s um Hilfe bitten.“
„Klingt das kleinlich?“, fragte sie. „Ich will unbedingt kleinlich sein.“
„Ich bin jedenfalls kein Spion von der Konkurrenz“, erklärte ich. „So spannend das als BBC-Miniserie auch wäre.“ Rasch sah ich mich um – außer uns betrachtete niemand die Tote. „Aber ich bin tatsächlich Bestatter und könnte dir helfen, die Sache in Ordnung zu bringen.“ Ich wandte mich an die junge Frau mit der bronzefarbenen Haut. „Hast du dein Make-up griffbereit?“
Sie hob die Brauen. „Willst du wirklich hier und jetzt an ihrem Make-up herumfummeln?“
„Es dauert höchstens eine Minute“, versprach ich. „Mach die Augen zu!“
„Teufel, nein!“
„Ich mache bestimmt nichts kaputt“, versicherte ich ihr. „Das Problem sind die Schatten – zum Beispiel hier und hier. Du hast deine Sache wirklich gut gemacht, aber die Schattierung muss bei jedem Toten anders sein, und deshalb hast du nicht daran gedacht. Es ist ganz einfach, aber ich brauche ein bisschen dunkelbraunes Make-up. Vermutlich passt dein Lidschatten perfekt. Darf ich ihn mir ansehen?“
Sie starrte mich an und überlegte vermutlich, ob ich verrückt war, dann seufzte sie und schloss die Augen, damit das Augenlid ohne Falten über dem Augapfel lag. Ich betrachtete sie eine Weile, dann wandte ich mich wieder der Toten zu.
„Ja, das müsste gut passen“, sagte ich. „Hast du den Lidschatten dabei? In höchstens einer Minute ist alles erledigt.“
Sie wühlte in der Handtasche und holte die Puderdose hervor, doch als ich danach greifen wollte, zog sie die Hand zurück und hielt die Dose fest. Sie sah sich in dem Raum um. Harold war immer noch in ein Gespräch mit einer Schar unzufriedener zukünftiger Kundinnen vertieft. Schließlich sah mich das Mädchen seufzend an. „Eine Minute?“
„Höchstens.“
„Und ich darf dich abstechen, wenn du Mist baust?“
„Mit einem spitzen Gegenstand deiner Wahl.“ Sie zögerte noch einen Moment lang, dann gab sie mir den Lidschatten. Ich öffnete die Puderdose. Die Farbe sah gut aus. Ich nahm den Schwamm, benetzte ihn mit Make-up und tupfte ihn mir auf den Arm, um festzustellen, wie leicht sich die Farbe auf die Haut übertragen ließ. Schließlich wollte ich im Gesicht der Toten keinen riesigen Klecks hinterlassen. Die Farbe haftete leicht auf dem Arm, also begann ich mit feinen kleinen Linien im Gesicht der Toten – zuerst leicht, dann etwas zuversichtlicher, als die alten Erinnerungen erwachten. Die Fältchen um die Nasenflügel, die Oberlippenrinne, die Linie unter der Unterlippe, zwei, drei Tupfer auf das Kinn. Zwischendurch hielt ich inne, atmete tief durch und kostete die unerwartet starken Gefühle aus, als ich arbeitete – es war schockierend und beinahe peinlich, wie gut es sich anfühlte, wieder an einer Leiche zu arbeiten. Das hatte ich jahrelang getan und gehofft, es mein Leben lang tun zu können. Ich wollte als Bestatter arbeiten. Dem Tod gegenüber empfand ich große Achtung – und nicht minder für die Sachwalter, die sich um die Toten kümmerten und sie zu ihrer letzten Ruhestatt geleiteten. Als ich jetzt hier war und die Tote behandeln durfte, war es …
Mir wurde bewusst, dass mir eine Träne über das Gesicht lief. Ich wischte sie rasch weg und hoffte, dass die junge Frau nichts bemerkt hatte. Ein letztes Mal betrachtete ich die Tote und drehte den Kopf, um sie aus verschiedenen Blickwinkeln zu begutachten. Dann tupfte ich ihr einen letzten Hauch Make-up aufs Kinn. Schließlich klappte ich die Dose zu und gab sie der jungen Frau zurück, doch bevor sie den Lidschatten an sich nehmen konnte, drängte sich Kathy Schrenks Zwillingsschwester zwischen uns und zielte anklagend auf die Tote.
„Seht her, das ist doch … oh!“
„Lassen Sie mich mal sehen“, sagte eine andere Frau mit kräftiger Stimme. Ich wandte mich um. Hinter mir stand nun eine ganze Gruppe: Harold und ein Schwarm gebrechlicher alter Frauen und mittendrin die große Frau, die ich auf Kathys Foto gesehen hatte. Wahrscheinlich war es Margo, die Leiterin des Bestattungsunternehmens. Sie trat vor, betrachtete die Tote und wandte sich an die Besucherinnen.
„Ich finde, sie sieht gut aus.“
„Sind Sie blind?“, zischte eine alte Dame. „Sie sieht aus, als hätte man sie aus dem Fluss gezogen.“
Margo trat zur Seite, damit die alten Frauen nacheinander die Tote betrachten konnten. Ihre Mienen wurden weich.
„Sie sieht wundervoll aus“, sagte eine.
„So friedlich“, stimmte eine andere zu.
„Vielleicht haben wir uns getäuscht, oder es lag am Licht“, meinte die Schwester. Lächelnd wandte sie sich an Margo. „Es tut uns wirklich leid, dass wir Sie behelligt haben. Vielleicht hat vorhin das Licht nicht richtig funktioniert, aber jetzt sieht sie einfach schön aus.“
„Danke“, erwiderte Margo. „Und danke, dass Sie hergekommen sind.“
Während sich die Frauen um den Sarg drängten, blickte Harold verwundert in die Runde, und Margo zog die Mexikanerin beiseite. „So hat sie nicht ausgesehen, als wir sie von hinten geholt haben“, flüsterte Margo. „Was hast du da gemacht?“
„Ein kalkuliertes Risiko.“ Das Mädchen deutete auf mich. „Wenn ich keinem von der Straße vertrauen kann, wem kann ich dann trauen?“
Margo musterte mich und wandte sich mit hochgezogenen Augenbrauen wieder an das Mädchen. „Du hast ihm erlaubt, die Tote zu berühren? Ohne mich vorher zu fragen?“
„Es hat funktioniert“, erwiderte das Mädchen. „Sie sehen doch, wie gut er arbeitet.“
Margo seufzte, betrachtete mich und nickte mir zu. Der Blick war offen und professionell zugleich. „Danke für deine Hilfe.“ Sie gab mir die Hand. „Margo Bennett.“
„Robert.“ Ich schüttelte ihr die Hand.
„Wo hast du gelernt?“
„Im Familiengeschäft“, antwortete ich. „Eine formale Ausbildung habe ich nicht.“
„Du hast gut gearbeitet.“ Sie wandte sich wieder an das Mädchen. „Aber beim nächsten Mal fragst du mich vorher.“
„Ganz bestimmt.“
Margo nickte noch einmal und ging. „Also, dann muss ich dich wohl doch nicht erstechen“, sagte das Mädchen.
„Das macht auch gar nicht so viel Spaß, wie du vielleicht meinst.“ Ich trat von einem Fuß auf den anderen. Small Talk war nicht mein Ding. Mit Leuten zu reden, lag mir grundsätzlich nicht, aber ich brauchte Informationen. Und dies war vermutlich die beste Gelegenheit, die sich mir überhaupt bot. „Wie war noch gleich dein Name?“
„Jasmyn“, antwortete sie. „Mit Ypsilon.“
„Freut mich, Jasmyn.“ Beinahe hätte ich Jasmyn mit Ypsilon gesagt, aber ob ich mich nun mit Small Talk auskannte oder nicht, ich besaß immerhin eine gewisse Selbstachtung. „Also machst du hier eine Ausbildung zur Einbalsamiererin.“
„Ja“, bestätigte sie. „Seit ungefähr einem Jahr.“
Ich nickte, fragte mich, ob ich vielleicht zu oft nickte, und hörte wieder auf. Dies war die Gelegenheit, Fragen zu stellen, aber ich wusste nicht, wie ich beginnen sollte. „Also …“ Ich zögerte und suchte viel zu lange nach den richtigen Worten. „Gefällt es dir?“
„Du bist eindeutig kein Spion.“
„Warum nicht?“
„Weil du das so schlecht machst. Dies ist der mieseste Small Talk, den ich je geführt habe.“
„Um ehrlich zu sein, ich rede nicht gern.“ Das war ein Risiko, aber wenn ich sie richtig einschätzte, dann würde sie darauf reagieren.
Sie lächelte schief und verdrehte die Augen. „Ja, das kann ich verstehen. Manche Leute sind echt übel.“
Bingo.
„Ich werde meine Sorgen mit Keksen ersticken“, sagte ich und deutete auf den Tisch an der Seite. „Willst du was?“
„Die sind auch übel“, prophezeite sie. „Aber warum nicht?“
Wir traten an den Tisch, und ich nahm mir einen Keks, der auf halbem Weg zum Mund zerbrach. Die untere Hälfte fiel wieder auf das Tablett.
„Siehst du?“ Jasmyn biss in ein krümelndes Gebäckstück. „Margo besteht darauf, will aber kein Geld für gute Kekse ausgeben.“
„In unserer Leichenhalle gab es nie Kekse“, meinte ich.
„Das sage ich ihr auch immer“, stimmte sie zu. „Bei einer Aufbahrung bietet man einfach keine Kekse an, es sei denn, die Familie bringt selbst welche mit.“ Sie biss noch einmal ab. „Vielleicht hat sie Aktien bei einem Keksproduzenten.“
„Gibt es bei Cottwell’s Kekse?“
Jasmyn schüttelte den Kopf. „Nein. Vielleicht besteht Margo deshalb darauf. Sie will sich von den anderen abheben.“
„Also, tja.“ Ich wollte nach der Toten fragen und dachte, endlich eine vernünftige Frage gefunden zu haben. Nun ja, halbwegs vernünftig. „Kathy Schrenk ist anscheinend ertrunken, oder?“
„Das sagt man“, bestätigte Jasmyn. „Obwohl niemand weiß, wie das möglich war. Sie lag im Hinterhof, und dort gibt es keinen Teich oder so was. Sie hat auch nicht in der Nähe des Kanals gewohnt.“
Jetzt konnte ich auf ihre Unerfahrenheit beim Einbalsamieren bauen. „Wasserleichen sind schwierig“, behauptete ich. „Da kommt immer so ein seltsamer schwarzer Brei raus.“ Das war natürlich eine Lüge, eine leicht durchschaubare obendrein. Niemand, der ertrank, hatte schwarzen Brei im Körper, sofern er nicht gerade in einer Lache aus schwarzem Brei erstickt war. Der Kleister, den ich meinte, hatte mit dem Ertrinken nichts zu tun, sondern war vielmehr ein Hinweis darauf, dass ein Verwelkter gestorben war. Sie nannten diese Substanz Seelenstoff. Es handelte sich dabei um eine Art schmierige Asche, die bei vielen ihrer Angriffe zurückblieb. Vermutlich bestanden ihre Körper im Grunde aus dem Zeug, auch wenn sie eine menschliche Gestalt annahmen. Jedes Mal, wenn ich einen Verwelkten getötet hatte, war er nämlich zu einem garstigen kleinen Klecks dieser schwarzen Masse zusammengefallen. Wenn ein Verwelkter Kathy Schrenk getötet hatte, dann hatte Jasmyn möglicherweise beim Einbalsamieren etwas von dem Seelenstoff bemerkt. Und wenn nicht, nun ja, sie war noch nicht lange in diesem Job und wahrscheinlich nicht in der Lage, mich einen Lügner zu nennen.
Ich schöpfte ein wenig Hoffnung und musterte Jasmyn mit fragendem Blick. Hatte ich richtig geraten?
Nein. Sie schien verwirrt. „Ehrlich?“, fragte sie. „Schwarzer Kleister?“
Ich seufzte. „Manchmal ist das so. Ich dachte, es kann nicht schaden, wenn ich nachfrage.“
„He, Jazz!“, rief Harold. „Kannst du mir mal helfen?“
„Klar.“ Jasmyn eilte zu ihm hinüber. Ich zog mich bis an die Wand zurück und fragte mich, was ich als Nächstes tun sollte. Vor allem aber war ich glücklich, dass ich endlich wieder in einer Leichenhalle war – nicht, weil sie besonders schön eingerichtet war, sondern weil ich mich damit auskannte. Die Menschen, die Bilder an den Wänden, die Musik, der Sarg, die Tote. Obwohl ich mich seit Jahren damit befasste, wusste ich im Grunde nicht genau, wie man Monster jagte. Ich wusste nicht, wie man trampte und wie man auf der Straße überlebte, wie man der Polizei entwischte und alles das bewältigte, wozu mich mein Leben jetzt zwang. Aber ich wusste, welche Arbeiten in einer Leichenhalle anfielen. An keinem Ort fühlte ich mich wohler als an diesem.
Aus den Augenwinkeln bemerkte ich eine andere Frau, die gerade erst hereingekommen war. Sie war um die dreißig, trug aber ein altmodisch geschnittenes Kleid, das so schmutzig war, als hätte sie es mehrere Jahre nicht ausgezogen. Die Haare hingen wie Rattenschwänze vor dem Gesicht. Die anderen Gäste wichen vor ihr zurück, als sie eintrat, sich orientierte und mich anstarrte. Eilig sah ich mich in der Leichenhalle um, ob Jasmyn, Harold oder Margo in der Nähe wären, doch sie waren alle hinausgegangen, um irgendetwas zu erledigen. Die zerlumpte Frau kam auf mich zu. Gesicht und Arme waren ebenso schmutzig wie das Kleid, die Fingernägel waren abgebrochen und mit blutigen alten Krusten überzogen. Die Füße waren nackt und ebenfalls schmutzig. Sie ging eigenartig, als sei sie nicht daran gewöhnt, und musterte mich unverwandt. Einige Schritte vor mir blieb sie stehen.
„Ich kenne dich“, sagte sie schließlich.
„Das glaube ich nicht“, widersprach ich.
„Kennst du mich?“
Ich schüttelte den Kopf. „Nein, tut mir leid.“
Die Frau starrte mich an und beugte sich vor.
„Lauf vor Rain weg!“, flüsterte sie.
Dann drehte sie sich um und rannte hinaus.
„›Ein Killer wie du und ich‹ liefert als äußerst gelungener Abschlussband gleichzeitig ein authentisches Gesamtbild aller sechs Romane.“
„›Ein Killer wie du und ich‹ ist ein absolutes, kurzweiliges Lesevergnügen. (…) Sehr stimmungsvoller Abschlussband der Serienkiller-Reihe.“















DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.