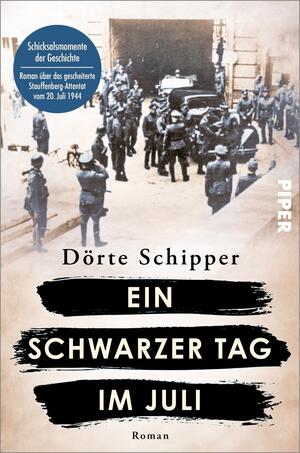

Ein schwarzer Tag im Juli (Schicksalsmomente der Geschichte 5) Ein schwarzer Tag im Juli (Schicksalsmomente der Geschichte 5) - eBook-Ausgabe
Roman
— Historischer Roman über das gescheiterte Stauffenberg-Attentat vom 20. Juli 1944„Der Roman bietet ein spannendes und berührendes Leseerlebnis, weil er die Hintergründe, die Planung und das letztliche Scheitern des Attentats in Beziehung setzt zu den Menschen, die dem Kriesgwahnsinn unter Einsatz ihres Lebens beenden wollen.“ - hr-info
Ein schwarzer Tag im Juli (Schicksalsmomente der Geschichte 5) — Inhalt
Ein schwarzer Tag im Juli | Historischer Roman über das gescheiterte Stauffenberg-Attentat
20. Juli 1944: Es war der Tag, an dem der Krieg enden sollte. Es wurde ein schwarzer Tag.
In dem historischen Roman „Ein schwarzer Tag im Juli“ setzt sich Dörte Schipper mit einem der dramatischsten Tage der deutschen Geschichte auseinander: dem 20. Juli 1944.
Egon ist ein junger Offiziersanwärter. Bevor er in wenigen Wochen an die Front muss, will er seine schwangere Freundin heiraten. Die Familie ist zerstritten: Stramme Nazis stehen den Kritikern Hitlers unversöhnlich gegenüber. Über seinen Onkel lernt Egon einen ranghohen Militär aus dem Stauffenberg-Kreis kennen, der ihn um einen vertraulichen Botengang bittet. Unwissentlich wird Egon so Teil der Widerstandsgruppe, die den grausamen Krieg endlich beenden will: Nur wenige Tage, dann soll das "Unternehmen Walküre" starten. Tage, die Egons Leben und das seiner Familie dramatisch verändern werden …
Dieser historische Roman über einen düsteren Schicksalsmoment der deutschen Geschichte ist nicht nur fesselnd geschrieben, sondern auch exzellent recherchiert.
Während ein paar hochrangige Offiziere ihr Leben für das Ende des Zweiten Weltkriegs riskieren, zerbricht eine Berliner Familie an den Folgen dieser mutigen Tat.
Die AutorinDörte Schipper über ihren Beweggrund, einen Roman über das Stauffenberg-Attentat zu schreiben:
Dieses Ereignis aus der Sicht einer normalen Familie zu erzählen, bietet die Chance, den Menschen dieses wichtige Kapitel unserer Geschichte auch heute noch nahe zu bringen. Je mehr ich in die Historie eintauchte, desto neugieriger wurde ich. Die Invasion der Alliierten in Frankreich, die ausweglose Situation an der Ostfront – der Krieg war im Juli 1944 längst verloren. Dennoch ging er weiter, weil Hitler nicht zu stoppen war. Nach langer Vorbereitung mussten die "Verschwörer" schnell handeln.
Leseprobe zu „Ein schwarzer Tag im Juli (Schicksalsmomente der Geschichte 5)“
1
Brandenburg – Sonntag, 2. Juli 1944
In der Nacht hatte es heftig gestürmt, was für die Jahreszeit ungewöhnlich war. Mit Besen, Kehrblech und einem Sack in der Hand machte Paula sich an die Arbeit. Sie sammelte die abgerissenen Zweige und Blätter ein, die der Wind von den Bäumen an der Straße in den Hof geweht hatte. Dabei ließ sie Bruno, auf den sie aufpassen sollte, nicht aus den Augen. Paula mochte das Spiel nicht, das sich der Sechsjährige vor ein paar Tagen ausgedacht hatte. Wie ein Besessener lief er hin und her und jagte die Hühner. Manchmal [...]
1
Brandenburg – Sonntag, 2. Juli 1944
In der Nacht hatte es heftig gestürmt, was für die Jahreszeit ungewöhnlich war. Mit Besen, Kehrblech und einem Sack in der Hand machte Paula sich an die Arbeit. Sie sammelte die abgerissenen Zweige und Blätter ein, die der Wind von den Bäumen an der Straße in den Hof geweht hatte. Dabei ließ sie Bruno, auf den sie aufpassen sollte, nicht aus den Augen. Paula mochte das Spiel nicht, das sich der Sechsjährige vor ein paar Tagen ausgedacht hatte. Wie ein Besessener lief er hin und her und jagte die Hühner. Manchmal blieb er plötzlich stehen, legte sein aus Holz geschnitztes Schießgewehr an und zielte: „Peng! Kopfschuss! Wieder ein Russe weniger.“ Dann riss er den Arm hoch und fuchtelte jubelnd mit der Flinte: „Sieg Heil!“
„Hör auf damit!“, rief Paula ihm zu. „Du sollst nicht Hitler spielen. Wie oft muss ich dir das noch sagen?“
Bruno ließ sich von Paulas Ermahnung nicht beirren, im Gegenteil. Mit dem Spielzeuggewehr im Anschlag rannte er erneut hinter den aufgeschreckten Hühnern her und knallte eins nach dem anderen ab – so lange, bis Paula ihn unsanft an den Hosenträgern packte und festhielt. „Was hier herumläuft, sind keine bolschewistischen Feinde, sondern fleißige Hennen. Wenn du sie noch länger durch die Gegend scheuchst, legen sie vor Schreck keine Eier mehr.“
Paula musterte Bruno. „Wie du wieder aussiehst!“ Sie zog ihr Taschentuch aus der Schürzentasche, spuckte drauf und wischte dem Kleinen den Schnurrbart weg, den er sich mit Ruß unter die Nase gerieben hatte.
Bruno verzog das Gesicht. „Das ist ekelig! Ich mag deine Spucke nicht. Wann fährst du endlich zurück nach Berlin?“
Paula tat so, als hätte sie die Frage überhört. Bruno wusste noch nicht, dass ihre Zeit auf dem Gutshof bald vorbei war. Egal, wie böse er sie gerade anschaute, in Wirklichkeit hatte er sie lieb gewonnen und würde sie vermissen, genau wie sie ihn auch. Trotz aller Zuneigung blieb die Neunzehnjährige dennoch hart. „Der Bart ist ab sofort verboten! Verstanden?“
„Und was soll ich denn sonst spielen?“, maulte Bruno und schulterte sein Gewehr, als wollte er auf die Pirsch gehen.
„Du könntest mir helfen“, sagte Paula leicht genervt und hob demonstrativ einen Zweig auf, der vor seinen Füßen lag. „Meinetwegen kannst du auch Winnetou, Häuptling der Apachen, spielen oder was weiß ich. Aber keinen obersten Befehlshaber, der …“
„Pass auf, was du sagst. Er ist noch ein Kind“, unterbrach sie eine kräftige Stimme. Baron Leopold von Schürlow kam mit langsamen Schritten aus der Scheune, blieb stehen und wischte sich die Hände mit einem Lappen ab. In seiner Arbeitshose und dem verschlissenen langen Hemd sah er mal wieder aus wie ein einfacher Bauer, nicht wie ein adeliger Gutsherr. Lediglich die Größe der Ländereien, die sich hinter der Scheune und den Stallungen erstreckten, wiesen auf seine Herkunft hin, über die er Paula gegenüber kaum sprach.
„Titel und Besitz sind wie Schall und Rauch. In diesen Zeiten geht es nur ums Überleben“, hatte er ihr noch am Morgen nach dem Frühstück zu verstehen gegeben und sich dann auf den aktuellen Wehrmachtsbericht in der Sonntagsausgabe der Zeitung konzentriert. Nach einer Weile las er laut vor: „Die Truppe kämpft allerorts heldenmütig und aufopfernd.“ Er schüttelte den Kopf. „In meinen Ohren klingt dieser Satz nach Untergang und nicht nach Zuversicht. Spätestens seit der Landung in der Normandie kann doch kein halbwegs gescheiter Mensch mehr an einen Endsieg glauben“, war sein lakonischer Kommentar gewesen. Kurz darauf hatte er die Küche verlassen, um ein wichtiges Telefonat zu führen. Wie Paula ihn inzwischen kannte, würde er ihr später sicherlich davon berichten – unter vier Augen, wie immer.
Paula hatte diese vertraulichen Gespräche schätzen gelernt. Der Baron war zwar schon Mitte fünfzig, aber zum Glück nicht der Typ Mann, der ihr bei jeder passenden Gelegenheit über den Mund fuhr, als wäre sie ein kleines, dummes Mädchen. Schon allein deshalb fand sie ihn sympathisch. Zudem war er ein enger Freund ihres verstorbenen Vaters gewesen, den sie als „Onkel Leo vom Land“ seit Kindertagen kannte. Andere junge Frauen mussten ihr hauswirtschaftliches Pflichtjahr weit weg von zu Hause bei wildfremden Menschen ableisten. Da hatte sie es besser getroffen, obwohl sie vor keiner Arbeit verschont blieb und die tägliche Routine sie langweilte. Jeden Morgen nach dem Frühstück abwaschen, anschließend nach draußen gehen und fegen …
„So sieht es ja schon wieder ganz anständig aus bei uns“, rief Leopold von Schürlow von der Scheune aus quer über den Hof. Paula sah ihm die Schmerzen an, die ihn gerade plagten.
Der Baron senkte den Blick und starrte auf sein rechtes Knie, als würde es nicht zu ihm gehören. Dann biss er die Zähne zusammen und wagte sich endlich von der Stelle. Mühsam humpelte er über das Kopfsteinpflaster.
„14/18 lässt mal wieder grüßen“, murmelte er und lächelte tapfer, um die Situation zu überspielen – was ihm nicht gelang. Bruno ließ sofort das Gewehr fallen, rannte auf ihn zu und reichte ihm die Hand. „Opa, ich helfe dir.“
„Schon gut.“ Der Baron strich seinem Enkel über den Kopf. „Sei bitte artig und tu, was Paula sagt“, mahnte er dann. „Du bist noch zu klein, um der größte Feldherr zu sein. Der Führer würde übrigens nie an vorderster Front kämpfen. Dafür hat er seine Soldaten und Offiziere.“
„Offiziere wie mein Papa?“
„Ja, wie dein Papa, den wir alle hier – vermissen.“ Schürlows Stimme stockte, er räusperte sich verlegen. „So, und jetzt ab mit dir. Deine Mutter wartet bestimmt schon auf dich. Sie ist in der Küche und bereitet das Mittagessen vor.“
„Jetzt schon?“, fragte Paula dazwischen. „Ich wollte ihr doch dabei helfen, die Kartoffeln und Möhren zu schälen.“
„Das wird Christa ja wohl alleine schaffen. Du bleibst bitte hier“, entgegnete der Baron und sah seinem Enkel hinterher, bis er im Haus war.
„Es ist noch schlimmer, als ich dachte“, wandte er sich dann an Paula. „Ich habe meinen alten Kameraden in Berlin erreicht. Du weißt, er verkehrt in ranghohen Militärkreisen und beschreibt die Lage als ›katastrophal‹. Der Krieg ist längst verloren, aber unsere Truppen müssen trotzdem weiterkämpfen, in Frankreich, in Russland. Wie lange soll das noch weitergehen? Ein Jahr? Zwei Jahre? So lange, bis auch der letzte Soldat tot ist?“
Schürlow raufte sich die Haare, und Paula schaute in sein sorgenvolles Gesicht, das sie zu deuten wusste. Onkel Leos Gedanken waren bei Richard. Seit vielen Wochen schon quälte ihn die Ungewissheit über das Schicksal seines einzigen Sohns, der an der Ostfront im Einsatz war.
„Man kann nur hoffen, dass jetzt schnell das Richtige geschieht. Deutschland steht am Abgrund, wir brauchen einen Neuanfang“, sagte Schürlow unvermittelt.
„Wie meinst du das?“, fragte Paula ihn.
„Wer zu laut über die Zukunft nachdenkt, begibt sich in Gefahr“, war seine knappe Antwort.
„Bist du das nicht sowieso schon?“, hakte Paula vorsichtig nach. „Bei den vielen Verboten, die du missachtest? Bei allem, was du unverblümt von dir gibst?“
Schürlow schmunzelte. „Du solltest mich inzwischen kennen. Ich bin ein freier Geist, ich lasse mich von keinem mehr verbiegen. Egal, wer kommt.“
Er deutete mit dem Finger auf die schmale Straße, die hinter seinem Grundstück endete und zwischen den Bäumen bis zum weitab gelegenen Nachbarhof einsehbar war. Ein Wagen mit offenem Verdeck näherte sich. Am Steuer konnte nur Ortsgruppenleiter Baumann sitzen, sein ungeschickter Fahrstil war unverkennbar. Wann immer er versuchte, einem Schlagloch auszuweichen, landete er mittendrin, hob kurz ab, schlug wieder auf und rückte seine Schirmmütze zurecht. Mit Schadenfreude sah Paula ihm zu. Seitdem der Ortsgruppenleiter vor einigen Monaten mit Genehmigung von „oben“, wie er gern betonte, sein Moped gegen ein standesgemäßes Fahrzeug eintauschen durfte, ließ er erst recht den Parteibonzen heraushängen.
Was will der schon wieder hier, dachte Paula noch, da stieg Ewald Baumann bereits in tadelloser Uniform und mit Deutschem Gruß aus dem Auto. Zum Glück beachtete er sie kaum, er ging geradewegs auf den Baron zu, der keine Miene verzog.
„Wie ich dich kenne, hast du heute bestimmt auch schon den Frontbericht studiert“, sagte Baumann zur Begrüßung und schlug Schürlow kumpelhaft auf die Schulter. „Das hat nicht viel zu bedeuten, nur eine kleine militärische Krise, die der Führer schnell lösen wird. Und spätestens dann werden die Alliierten ihre Invasion in Frankreich bitter bereuen, und die Bolschewiken werden sich auch noch umgucken.“ Als wollte er seinem Optimismus besonderen Ausdruck verleihen, rieb Ewald Baumann sich zufrieden die Hände.
Paula beobachtete ihn schräg von der Seite. Was für ein unangenehmer, feister Kerl er doch war. Sie sah noch genau vor sich, wie er bei einem seiner letzten Besuche ähnlich selbstgefällig auf dem Hof gestanden und in einem unbeobachteten Moment versucht hatte, sie mit seinen Wurstfingern zu betatschen.
„Ewald, warum bist du eigentlich hier? Nur um auch sonntags Propagandareden zu schwingen?“, fragte der Baron trocken. „Hungrig wird dieser Krieg bestimmt nicht gewonnen. Sag mir lieber, wie viele Arbeiter du mir für die Ernte besorgen kannst. Russen, Polen, egal.“
„Tja, mal schauen … Du bist nicht der Einzige, der wegen zusätzlicher Leute anfragt. Der Bezirksbauernführer sitzt mir im Nacken, und die Munitionsfabrik in Strausberg auch“, redete Baumann daher und strich wie zufällig über das Hakenkreuz auf seiner Armbinde. Dann beugte er sich so weit nach vorne, bis ihn nur noch ein Atemzug vom Baron trennte. „Dir fehlt leider die richtige Überzeugung, darum stehst du ganz hinten. Außerdem hast du schon einen Polen, als Ersatz für deinen Sohn.“
„Ja, Jacenty“, erwiderte Schürlow, „der schuftet von morgens bis abends.“
„Dazu ist er da. Mir ist übrigens zu Ohren gekommen, dass der Polacke auf deinem Hof zu gut verpflegt wird. Sei vorsichtig! Ich werde der Sache nachgehen.“
Baumanns drohender Tonfall schreckte Paula auf, auch wenn Onkel Leo die Ruhe behielt und sich zu keiner unbedachten Bemerkung hinreißen ließ. Einen Kopf größer, blickte er auf den Ortsgruppenleiter hinab und meinte nur: „War es das für heute?“
War es nicht. „Routinemäßige Kontrolle“, nannte Baumann sein Anliegen und bestand darauf, den Stall zu inspizieren.
„Vier Augen zählen die Schweine besser als zwei. Fräulein Reusler, kommen Sie bitte mit“, forderte er Paula auf, die ihm angesichts der angespannten Stimmung sofort gehorchte.
„Ich will auch mit!“, hörte sie nach ein paar Schritten Brunos Stimme, was ihr in diesem Augenblick wie ein Geschenk vorkam.
„Ich kann auch zählen, bis hundert“, rief der Kleine dem Ortsgruppenleiter von der Haustür aus zu und hüpfte mit seinem Gewehr voraus. Als Paula und Baumann den Stall erreichten, war er längst über eines der Gatter geklettert und wartete darauf, sein Können unter Beweis zu stellen. Aufmerksam ging er von einem Schwein zum nächsten, zeigte auf jedes mit dem Finger und zählte in sich versunken mit. „Vergiss die Ferkel nicht, die im Stroh liegen“, erinnerte Paula ihn und seufzte.
„Wie soll es bloß weitergehen bei der schwierigen Versorgungslage?“, fragte sie den Ortsgruppenleiter. „Der Baron hat die größten Felder in der Gegend. Er kann die kostbare Ernte doch nicht verkommen lassen. Was würde der Führer dazu sagen?“
Baumann winkte ab. „Darüber sollten Sie sich Ihren hübschen Lockenkopf nicht unnötig zerbrechen. Wissen Sie eigentlich, dass Ihr Haar glänzt wie Gold und Ihre Augen blau wie Saphire leuchten?“
„Wirklich?“ Paula lächelte ihn gequält an. „Sie sind ein angesehener Mann mit viel Verantwortung“, bemerkte sie dann mit schmeichelnder Stimme. „Bitte unterstützen Sie den Baron, auch mir zuliebe.“
Natürlich zeigte sich der Ortsgruppenleiter sofort gebauchpinselt und trat einen Schritt näher.
„Sie sind mir vom letzten Mal noch eine Antwort schuldig“, meinte er augenzwinkernd, ohne auf Paulas Bitte einzugehen. „Ich lasse Sie nicht eher zurück nach Berlin, bis Sie meiner Einladung gefolgt sind. Am Straussee gibt es ein lauschiges Gartenlokal …“
„Fertig!“, redete Bruno vorlaut dazwischen und zog an Baumanns Jackenärmel, um auf sich aufmerksam zu machen. „Es sind fünfundvierzig, mit Ferkeln. Ganz bestimmt!“
Davon wollte Baumann sich selbst überzeugen. Gewichtig schritt er durch den Stall und zählte akribisch nach. „Auf dich ist Verlass“, lobte er den Jungen anschließend und schien beeindruckt. „Woher kannst du das schon so gut?“
„Paula hat es mir beigebracht.“
„Er hat Freude daran“, mischte sie sich ein. „Wir zählen viel. Die Bäume, an denen wir vorbeilaufen, die Sterne am Himmel …“
„Und ab jetzt auch die Schweine“, unterbrach Baumann sie grob und beugte sich lächelnd zu Bruno hinunter. „Fünfundvierzig, merk dir die Zahl gut. Von nun an musst du nämlich aufpassen, dass kein Schwein verloren geht. Wenn du das brav machst, bekommst du etwas von mir, woran du Freude haben wirst.“
Bruno stutzte. „Aber ich freue mich doch schon über das Gewehr von Ihnen.“
„Das ist nichts gegen einen Panzer, in den du dich richtig reinsetzen kannst.“
„Einen Panzer?“ Brunos Augen leuchteten. „Mit Kanone?“
„Natürlich mit Kanonenrohr, ohne das würde Kriegspielen doch keinen Spaß machen.“ Baumann strich dem Kleinen über die Haare, in denen sich ein paar Strohhalme verfangen hatten, und verabschiedete sich erst von ihm, dann von Paula. „Sie entkommen mir nicht“, sagte er mit einem Grinsen. „Ich werde bald wieder hier sein.“
„Gerne doch, ich richte es dem Baron aus“, erwiderte sie. Du mieser Kerl, dachte sie und ging hinters Haus, um die Wäsche aufzuhängen.
Einen „Heiligen Sonntag“ mit Kirchgang und anschließendem Ausflug, wie Paula ihn aus Berlin kannte, hatte sie auf Gut Schürlow noch nicht erlebt. Das lag wohl an Onkel Leos mangelnder Religiosität. Außerdem war er kein Freund von Müßiggang und fand immer etwas, das sie erledigen sollte.
„Die Erdbeersaison neigt sich dem Ende zu“, erklärte er nach dem Mittagessen. „Ich habe gesehen, dass die letzten Früchte überreif sind, wir dürfen sie nicht verkommen lassen und sollten sie verarbeiten.“
Paula verstand den Wink mit dem Zaunpfahl und fand sich wenig später mit einem Korb auf dem kleinen Feld wieder, das Schürlow mit ihrer Hilfe im letzten Jahr angelegt hatte. Gebückt ging sie die Reihen entlang und pflückte die tiefroten saftigen Früchte, die noch an den Pflanzen hingen. Es waren nicht mehr allzu viele, aber die Ausbeute konnte sich dennoch sehen lassen. Nachdem Paula die Früchte gewaschen und geputzt hatte, stand sie am späten Nachmittag zufrieden am Herd. Ernten war von allen Arbeiten auf dem Hof einfach die schönste. Fasziniert rührte sie im Topf und probierte die dampfende Erdbeermarmelade, die sie zum ersten Mal allein zubereitet hatte.
Onkel Leo, Christa und Bruno ließen sich erst zum Abendbrot wieder in der Küche blicken. Außer dem Kleinen nahm keiner Notiz von dem leckeren Duft und den gefüllten Gläsern, die zum Abkühlen neben dem Herd standen. Paula wunderte das nicht weiter.
Dass zwischen Schwiegervater und Schwiegertochter schlechte Stimmung herrschte, war ihr schon seit einigen Tagen aufgefallen. Auch jetzt bei Tisch redeten die beiden kaum miteinander. Lustlos schmierte Christa eine Schmalzstulle und stand nach einem Bissen auf. „Ich fühle mich nicht wohl, ich muss nach draußen. Ich brauche frische Luft“, entschuldigte sie sich und gab Bruno einen Gutenachtkuss. „Paula bringt dich gleich ins Bett und liest dir sicherlich noch eine Geschichte vor.“
„Vergiss nicht, dass du die Mutter bist“, mischte Schürlow sich ein. „Während sein Vater weg ist, braucht der Junge dich umso mehr.“
„Das weiß ich“, erwiderte Christa und verließ dennoch die Küche. Kurz darauf war sie durchs Fenster zu sehen, sie ging über den Hof auf den Feldweg und verschwand aus dem Blickfeld.
Gut möglich, dass sie in den Wald will oder zum See, überlegte Paula. Gleich darauf stupste Bruno sie an. „Erzählst du mir von Rotkäppchen und dem bösen Wolf?“
„Schon wieder? Das Märchen kennst du doch in- und auswendig.“
„Egal, Hauptsache, du hörst nicht wieder vorm Ende auf. Das war doof.“
„Du meinst gestern? Da dachte ich, du wärst längst eingeschlafen.“ Paula lächelte, nahm den Kleinen an der Hand und ging mit ihm ins Kinderzimmer, das kaum größer war als die Kammer, in der sie schlief. Nachdem Bruno seinem Stoffhasen, den beiden Kasperlepuppen und dem Gewehr gute Nacht gesagt hatte und nach dem Zähneputzen endlich unter der Decke lag, setzte Paula sich zu ihm auf die Bettkante.
„Meine Mama kommt doch wieder, oder?“, fragte er und kuschelte sich verschreckt an sie.
„Natürlich kommt deine Mama wieder. Morgen in der Früh wird sie dich wecken wie immer, und dann frühstückt ihr miteinander. Und jetzt hör zu: ›Als Rotkäppchen in den Wald ging, um ihrer kranken Großmutter Essen und Trinken zu bringen, begegnete ihr ein Wolf. Sie begrüßte ihn freundlich und ahnte nicht, dass er Böses mit ihr vorhatte …‹“
Nur mit Rotkäppchen war es an diesem Abend nicht getan. Bruno gab keine Ruhe. „Mehr! Mehr!“, bettelte er und schmiegte sich noch dichter an Paula, die inzwischen neben ihm auf dem Bett lag.
Erst nach dem Gestiefelten Kater fielen dem Kleinen die Augen zu, und Paula konnte zurück in die Küche. Sie war noch mit dem Abwasch beschäftigt, da rief Schürlow sie zum Telefon, das ein Stockwerk höher in seinem Büro stand. Rasch trocknete sie die Hände, lief die Treppe hinauf und konnte auf den letzten Stufen das Gespräch mithören.
„Wenn du Olbricht triffst, grüß ihn von mir. Er wird sich freuen.“ Onkel Leo, der schon auf sie wartete, gab ihr ein Zeichen, sich hinzusetzen. „Jetzt ist sie da“, sagte er in den Hörer und reichte ihn weiter. „Dein Bruder ist dran, die Leitung ist sehr schlecht.“
Tatsächlich hörte Paula zunächst nur ein Pfeifen und Krächzen, bevor sie wie aus der Tiefe eines Kellers Egons Stimme vernahm.
„Wo bist du?“, rief sie laut ins Mikrofon. „In der Kaserne?“
„Nein, seit heute wieder zu Hause. Ich will mich kurzfassen, sonst schimpft Mutter wegen der Kosten. Hör zu! Die Hochzeit ist vorverlegt, ich werde schon am 15. heiraten, also eine Woche früher. Hast du mich verstanden? Hallo? Bist du noch da?“
„Ja! Ich habe dich verstanden“, schrie Paula in den Hörer. „Aber warum muss das sein?“
„Sie wollen mich möglichst schnell in den Kampf schicken. Jetzt, wo ich Offiziersanwärter bin, soll ich in den russischen Sümpfen beweisen, was ich während der Ausbildung gelernt habe. Frontbewährung nennt sich das und klingt für mich wie eine Drohung: Schieß als Erster oder krepier …“ Was Egon dann noch sagte, ging im Rauschen unter. Kurz darauf wurde die Verbindung unterbrochen.
Nach einer Weile legte Paula auf und ärgerte sich über die schlechte Telefonleitung auf Onkel Leos abgelegenem Hof.
2
Berlin – Montag, 3. Juli 1944
„Hast du deine Schwester gestern noch erreicht?“, erkundigte Käthe Reusler sich gleich in der Früh, als ihr Sohn in die Küche kam.
„Ja, sie weiß Bescheid, und Leopold auch.“ Egon setzte sich an den Tisch, und die Mutter reichte ihm auf einem Tablett die Morgenzeitung, so, wie sie es früher bei ihrem Mann getan hatte.
Egon schlug die Zeitung lustlos auf. Nach ungebrochenem Kampfeswillen, Tapferkeit und Heldentum war ihm heute nicht zumute. Die Überschriften, die er überflog, klangen geradezu, als hätte kein einziger Soldat Angst vor dem Töten und dem Sterben. Er blätterte weiter. Erst ab Seite fünf wurden die Themen bunter. Käthe hatte inzwischen das bescheidene Frühstück aufgetischt und Malzkaffee eingeschenkt. Egon nahm einen Schluck, abgelenkt von dem, was er gerade las.
„Erstaunlich, die Feuerzangenbowle mit Heinz Rühmann läuft immer noch im Kino.“ Er schaute hoch. „Mutter, du solltest dich mal wieder amüsieren, der Film ist wirklich lustig. Sieh ihn dir an, bevor es zu spät ist und er abgesetzt wird.“
„Ich habe Wichtigeres um die Ohren. Ich muss die Hochzeit vorbereiten, und das schneller, als ich gestern noch dachte.“ Kaum hatte Käthe sich hingesetzt, stand sie wieder auf und öffnete die Tür der Speisekammer. „Das ist alles, was ich von den wenigen Lebensmittelkarten bislang aufsparen konnte. Wir brauchen mehr Mehl für die Kuchen, und auch noch Butter und Fleisch. Es soll doch ein schönes Fest werden, du heiratest schließlich nur einmal.“
Egon warf einen Blick auf die spärlich gefüllten Regale und konnte sich ein Stirnrunzeln nicht verkneifen. Typisch Mutter, schoss es ihm durch den Kopf. Überkorrekt, wie sie war, fehlte ihr das Organisationstalent, das der Kriegsalltag nun einmal erforderte. Sie hätte es nie gewagt, auch nur eine ihrer feinen Leinentischdecken unter der Hand gegen Naturalien einzutauschen, geschweige denn, sich auf andere halbseidene Geschäfte einzulassen. Dennoch hatte sie darauf bestanden, dass nicht die Brauteltern, sondern sie die Hochzeitsfeier ausrichtete, zu Ehren ihres verstorbenen Mannes.
„Was soll ich denn jetzt machen?“, fragte sie ratlos. „Meinst du, Leopold könnte etwas beisteuern, ohne sich selbst in Schwierigkeiten zu bringen?“
„Wie ich ihn kenne, wird er nicht mit leeren Händen kommen“, erwiderte Egon. Im nächsten Moment dachte er über den widersinnigen Wunsch nach, im Krieg ein Fest zu feiern wie im Frieden. Mit großem Mahl und einer fröhlichen Runde, die am fein gedeckten Tisch genüsslich speiste. Und dann, was wäre, wenn es mittendrin Fliegeralarm gäbe? Die ganze Gesellschaft würde mit Gasmasken oder nassen Tüchern vor dem Gesicht in den Luftschutzkeller eilen und hoffen, dass es später noch ein Zurück gab. Kaum hatte er sich dieses Szenario in Einzelheiten ausgemalt, hörte er aus dem Korridor Türengeklapper und kurz darauf Schritte. Tante Hetti und Onkel Albert waren im Anmarsch. Egon stand unvermittelt auf.
„Ich finde es nicht gut, dass du die beiden aufgenommen hast. Das hättest du vorher mit mir besprechen sollen“, warf er seiner Mutter leise vor.
„Wie sollte ich das denn machen? Sie waren ausgebombt, und dich konnte ich in der Kaserne nicht erreichen“, flüsterte sie ebenso leise zurück. „Hetti ist meine Schwester, und wir haben eine große Wohnung. Ehe hier im Frühling womöglich wildfremde Menschen einquartiert worden wären, fand ich es besser, Verwandte um mich zu haben.“
„Aber doch nicht die beiden! Sie sind falsche Fuffziger und viel zu aufdringlich. Das kann ich schwer ertragen.“ Egon sah seine Mutter kopfschüttelnd an und dachte plötzlich an den Schuppen hinter dem Haus. Dorthin war sein Vater oft gegangen, wenn er seine Ruhe haben wollte.
Egon nahm noch einen Schluck Kaffee im Gehen, dann standen Onkel und Tante auch schon in der Küche, und er kam um ein verkniffenes „Guten Morgen. Entschuldigt, die Pflicht ruft“ nicht herum.
„Ich konnte für deine Verlobte ein Brautkleid organisieren“, rief Hetti ihm hinterher. „Sie kommt heute Nachmittag zur Anprobe vorbei.“
„Um das Kleid wollte sich ihre Mutter kümmern, da solltest du dich nicht einmischen“, erwiderte er kurz angebunden und verschwand in seinem Zimmer. Dort holte er die abgewetzte Aktentasche seines Vaters aus dem Schrank, die er seit dessen Tod benutzte. Er steckte den Umschlag hinein, den er im Heeresamt abliefern sollte.
Egon konnte nicht ganz nachvollziehen, warum ausgerechnet er für den Botengang ausgewählt worden war. Kurz vor der Heimfahrt nach Berlin hatte ihn Hoffmann, sein Kompaniechef, gestern in der Kaserne zu sich zitiert.
„Reusler, ich habe einen Auftrag, den Sie morgen gewissenhaft erledigen müssen!“, lautete die Anweisung. „Um Punkt zehn Uhr, nicht früher, nicht später, haben Sie bei General Olbricht im Bendlerblock zu erscheinen. Er ist der Chef des Allgemeinen Heeresamts. Also benehmen Sie sich anständig. Sie sind bereits angemeldet.“
Von zu Hause waren es knapp drei Kilometer bis zum Heeresamt. Gegen neun, frühzeitig genug, machte Egon sich zu Fuß auf den Weg und war auf Schlimmes gefasst. Während der Ausbildung in der Kaserne, die außerhalb der Stadt lag, hatte er die Bombenangriffe auf Berlin nur an seinen freien Tagen hautnah miterlebt. Natürlich wusste er vom Hörensagen, dass inzwischen ganze Stadtteile staubigen Steinwüsten glichen.
Charlottenburg, wo er wohnte, hatte es bereits im letzten Winter arg getroffen. Und doch erschien ihm die Gegend trotz aller Zerstörungen nach wie vor vertraut. Er bog in die Fasanenstraße ein und lief an den Häuserlücken vorbei, als wären sie schon immer dort gewesen, als hätte es ein Leben ohne Trümmer nie gegeben. Ähnlich erging es ihm eine Weile später beim Anblick der Gedächtniskirche. Sie war nur noch eine Ruine. Egon verharrte einen Augenblick und sah das Feuer wieder vor sich, das den Turm der Kirche Ende letzten Jahres einstürzen ließ.
Er hatte an diesem ungemütlich kalten Novembertag seine Schwester auf dem Land besucht und war gegen Abend mit dem Zug nach Berlin zurückgekehrt. Als die Sirenen heulten, war er gerade am Bahnhof Zoo. Er flüchtete in den großen, fünfgeschossigen Bunker in der Nähe und hoffte, dass der Spuk bald vorbei sein würde. Doch es kam anders. Offensichtlich hatten die Engländer einen Großangriff gestartet, der von den Geschossen der Flugabwehrkanonen nicht aufzuhalten war. Die Flakgeschütze klangen in Egons Ohren dröhnend und kläglich zugleich, als würden sie in größter Verzweiflung in den Himmel gefeuert.
Die britischen Flieger schienen ihre Route der Zerstörung unbeirrt zu verfolgen. Die Bomben waren immer lauter zu hören, schlugen immer näher ein. Mit krachenden Donnerschlägen fielen sie in grausamer Schnelligkeit. Je länger der Angriff dauerte, desto stiller wurde es im Bunker.
Die alte Frau, die dicht neben Egon auf der Bank saß, schaute ihn verängstigt an. „Hoffentlich überleben wir das hier.“
„Das werden wir“, versuchte Egon sie und sich selbst zu beruhigen, obwohl ihm das Herz bei jeder Explosion bis zum Hals schlug. Die Frau zitterte.
„Die lassen uns nicht in Ruhe. Ich fürchte, dass die nächsten Wochen noch viel schlimmer werden“, sagte sie leise und machte ein Kreuzzeichen.
Erst Stunden später wagten sie sich wieder nach draußen, zusammen mit etwa zweitausend anderen. Egon bemerkte im Gedränge, dass die Frau schlecht zu Fuß war, und hakte sie unter auf der Treppe, die zum Ausgang führte. Kaum hatten sie einen Schritt vor die Tür gesetzt, strömte ihnen beißender Rauch entgegen. Egal, wohin sie schauten, überall loderten Flammen. Auch die Gedächtniskirche brannte lichterloh, sie sah aus wie ein riesiger Scheiterhaufen.
„Das haben wir nicht verdient“, meinte die alte Frau. „Erst sprengen sie unsere Wohnungen kaputt, und dann schmeißen sie noch Brandbomben obendrauf, damit wir bloß nichts von unserem Hab und Gut retten können.“
Sie reichte Egon zum Abschied die Hand. „Ich drücke Ihnen einen meiner Daumen, dass Sie noch ein Dach über dem Kopf haben, wenn Sie zu Hause ankommen. Den anderen drücke ich mir selbst.“ Mit einem müden Lächeln machte sie sich auf den Weg. Egon schaute ihr hinterher, bis sie in der gespenstischen, vom Feuer erleuchteten Nacht verschwand – er hatte sie nicht einmal nach ihrem Namen gefragt.
Egon blickte auf den Landwehrkanal, an dem er, die Aktentasche unterm Arm, soeben vorbeikam. Kurz blieb er stehen und überlegte, wie blauäugig er doch lange Zeit gewesen war.
Als im Sommer 1940 die ersten Bomben auf Berlin fielen, hatte er an eine kurze Drohgebärde geglaubt. Wie andere Schaulustige war er zum Ort des Geschehens hingefahren und hatte sich die Schäden neugierig aus nächster Nähe angesehen.
Das käme ihm heute, vier Jahre später, nicht mehr in den Sinn. Egon schüttelte über sich selbst den Kopf. Er hob einen Stein auf, flitschte ihn wie ein kleiner Junge übers Wasser und wartete so lange, bis er nach ein paar Sprüngen unterging. Dann warf er einen Blick auf die Uhr und ging mit strammen Schritten weiter.
Das Heeresamt war in einem großen Gebäudekomplex untergebracht, den alle nur Bendlerblock nannten. Hin und wieder hatte Egon dort schon zu tun gehabt. Bis zur Chefetage, wo die ranghöchsten Militärs saßen, war er allerdings noch nie vorgedrungen.
Wenige Meter vor dem Eingang zog er die Uniformjacke glatt, rückte den Gürtel zurecht und begutachtete kritisch seine Stiefel, die er am Morgen besonders gründlich geputzt hatte.
Die bewaffneten Soldaten vom Wachbataillon, die am Tor ihren Dienst verrichteten, nahmen seine Ankunft kaum zur Kenntnis. Sie lungerten in der Einfahrt und scherzten miteinander. Außer einem, der halb verdeckt an der Mauer lehnte und ihn aufmerksam beäugte.
„Reusler, alter Schwede, du bist es wirklich!“, rief er einen Moment später und kam ein paar Schritte näher. „Dann haben sie dich trotz Asthma also doch noch gekrallt …“
Egon brauchte einen Moment, bis er in dem jungen Mann mit der auffällig großen Narbe im Gesicht Stefan erkannte, einen ehemaligen Mitschüler aus der Volksschule. „Meine Asthmaanfälle sind weniger geworden“, sagte er. „Aber – was ist mit dir passiert?“
„Nicht der Rede wert, nur ein kleines Missgeschick.“
„Das sieht aber nach etwas Größerem aus“, erwiderte Egon.
„Lass uns nicht weiter darüber reden, lohnt sich nicht. Was passiert ist, ist passiert.“
Mit einer lässigen Handbewegung machte Stefan ihm den Weg frei ins „Herz der Wehrmacht“, wie er die militärische Hauptzentrale, in der alle Fäden zusammenliefen, flapsig nannte.
„Pass gut auf dich auf! Und wenn der ganze Mist vorbei ist, dann trinken wir in Frieden ein Bier zusammen“, sagte er noch und zündete sich eine Zigarette an.
Egon erledigte beim Pförtner die üblichen Formalitäten. Nachdem er den Passierschein akribisch ausgefüllt hatte, ließ er sich von ihm den Weg genau erklären. „Ein kleines Stück über den Innenhof, dann links rein in den Ostflügel, zweiter Stock, Gang entlang, vorletzte Tür links.“
Der Hof, den er nicht zum ersten Mal durchquerte, kam Egon heute seltsam still vor. Obwohl einige Fenster der umliegenden Dienst- und Schreibstuben geöffnet waren, drangen keine Geräusche nach draußen. Auch im Treppenhaus hörte er nur seine eigenen Schritte, während er mit den schweren Stiefeln die breite steinerne Treppe hinaufging und an die Begrüßung dachte, die ihm bevorstand. Jeden Morgen hatte er sie beim Appell auf dem Kasernenhof exerzieren müssen: Hacken zusammen, strammstehen, Arm anwinkeln, Finger an die Schläfe. Vom Bewegungsablauf her war so ein zackiger militärischer Gruß keine große Sache und schnell erledigt. Egon graute eher davor, dass er jetzt gleich wieder seine innere Einstellung verbergen musste.
Er klopfte an die Tür, wartete geduldig auf ein „Herein!“ und salutierte vorschriftsmäßig. Dann stellte er sich vor und überreichte den Umschlag.
„Was ist da drin?“, fragte General Olbricht vom Schreibtisch aus.
„Das weiß ich nicht“, antwortete Egon und hielt dem forschenden Blick so lange stand, bis der General zum Brieföffner griff und selbst nachschaute.
„Ach, die Liste der Offiziersanwärter, die ich angefordert habe.“ Olbricht legte sie auf einen Stapel anderer Unterlagen und sah Egon wieder an. „Interessant, Sie haben also gerade Ihre Ausbildung hinter sich gebracht. Was war denn für Sie das Wesentliche, das Sie gelernt haben?“
„Jeder Soldat muss allzeit bereit sein, für Führer, Volk und Vaterland Opfer zu bringen“, rasselte Egon herunter, was ihm in der Kaserne eingetrichtert worden war.
„Wie alt sind Sie?“, wollte Olbricht als Nächstes wissen, während Egon noch immer regungslos wie ein Zinnsoldat dastand.
„Zweiundzwanzig, Herr General!“
Olbricht musterte ihn von oben bis unten. „In Ihrem Alter sind andere längst Leutnant. Warum Sie nicht?“
„Ich wurde krankheitsbedingt zurückgestellt, leider“, entschuldigte Egon sich.
„Und was haben Sie in der Zwischenzeit gemacht?“
„Ich habe Philosophie studiert.“
„Philosophie …“ Kommentarlos setzte Olbricht seine Brille wieder auf, die er einen Moment lang abgelegt hatte, und wies auf die Aktenordner und Kladden, die verteilt auf dem wuchtigen Schreibtisch lagen. „Ich habe zu tun. Oder gibt es noch etwas Dringendes?“
„Ja, ganz kurz.“ Egon wagte zum ersten Mal, eine etwas lockerere Haltung einzunehmen, und trat von einem Bein aufs andere. „Ich soll Sie von Baron von Schürlow grüßen. Er wird voraussichtlich Mitte des Monats in Berlin sein.“
„Leopold, mein treuer Weggefährte!“ Ein leichtes Lächeln huschte über Olbrichts Gesicht. Er lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und schien für einen Moment alles Unerledigte um sich herum zu vergessen. „Leopold und ich, wir haben uns 1916 in Frankreich gemeinsam durchgeschlagen.“
„Mir hat er mal erzählt, dass Sie ihm damals unter großer Gefahr das Leben gerettet haben“, entgegnete Egon.
„Er übertreibt, ich habe lediglich getan, was ich unter Eid geschworen hatte. Dazu sind Sie als Soldat auch verpflichtet.“
Egon schluckte und überlegte zu lange, was er darauf antworten sollte. Der General setzte sich unterdessen wieder aufrecht hin. Entschlossen griff er nach einer der Akten, öffnete sie und deutete damit an, dass das Gespräch für ihn beendet war. „Sie entschuldigen mich nun bitte!“, sagte er unerwartet barsch.
Egon verabschiedete sich und ging. Wohl war ihm nach der Begegnung nicht, er hatte gehofft, dass sie einen etwas persönlicheren Verlauf nehmen würde. Woher er den Baron kannte und warum der nach Berlin kommen wollte, hatte den General anscheinend überhaupt nicht interessiert.
Wieder allein in seinem Dienstzimmer, wartete Olbricht so lange, bis Egons Schritte auf dem Gang verhallten. Dann griff er zum Hörer.
„Verbinden Sie mich bitte mit dem Gutshof Schürlow“, wies er die Dame von der Telefonzentrale an. Trotz hochmoderner Technik, mit der das Heeresamt ausgestattet war, musste er lange warten, bis ein Freizeichen ertönte und er Leopold endlich an der Strippe hatte.
„Ich habe Egon kennengelernt, er war eben bei mir“, berichtete Olbricht ihm. „Er scheint ein netter, aufgeschlossener junger Mann zu sein. Aber …“ Er machte eine kurze Pause und nahm den Telefonhörer in die andere Hand. „Ein fanatischer Kämpfer wird er wohl kaum werden. Eher einer von denen, die am liebsten ohne Waffen in den Krieg ziehen würden.“
„Gut möglich, sein Vater war ähnlich“, sagte Schürlow am anderen Ende der Leitung. „Egon würde das aber nie offen sagen, er hat gelernt zu schweigen.“
„Stimmt, angemerkt habe ich es ihm dennoch. Bevor er sich um Kopf und Kragen geredet hätte, habe ich ihn weggeschickt. Aber die Hauptsache ist, dass du ihm vertrauen kannst, wenn es darauf ankommt.“
„Das kann ich, für ihn würde ich meine Hand ins Feuer legen.“
„Moment mal …“ Olbricht war abgelenkt, weil schon wieder jemand an die Tür pochte. Herein kam einer seiner wichtigsten Männer und Informanten, Oberst Graf von Stauffenberg. Er gehörte zu den wenigen Auserwählten, die den Führer gelegentlich noch aus nächster Nähe erlebten. In der Regel dann, wenn Hitler mal wieder eine seiner berüchtigten Lagebesprechungen abhielt, die meist mit einem Tobsuchtsanfall endeten.
„Ich muss jetzt auflegen“, entschuldigte Olbricht sich bei Schürlow. „Über alles Weitere reden wir in den kommenden Tagen. Ich rufe dich von zu Hause aus an.“
Oberst Graf von Stauffenberg hatte sich inzwischen auf einen der Stühle vor dem Schreibtisch gesetzt. Er informierte den General über den nächsten Termin im Führerhauptquartier, bei dem seine Anwesenheit erwartet wurde. Das Treffen war mit hoher Dringlichkeitsstufe anberaumt.
„Wolfsschanze oder Obersalzberg?“, fragte Olbricht.
„Obersalzberg, Sondersitzung zur militärischen Lage. Der Reichsmarschall und der Innenminister werden auch anreisen.“
„Gleich beide? Göring und Himmler?“
Stauffenberg nickte. „Der Führer wird vermutlich sehr einschneidende neue Kommandos erteilen.“ Seine Stimme klang ungerührt, geradezu nüchtern. Sein Blick hingegen sagte etwas anderes.
Olbricht meinte, in Stauffenbergs Gesicht die gleiche Gewissensnot zu sehen, die auch ihn als General seit Langem plagte. Wer, wenn nicht wir?, fragte er sich jeden Tag. Es war überfällig zu handeln, ein Staatsstreich unumgänglich. Viel zu lange waren sie als ranghohe Militärs Hitlers Rassenwahn und seiner rücksichtslosen Kriegspolitik gefolgt. Als oberster Befehlshaber der Wehrmacht trieb der Führer mit immer irrsinnigeren Befehlen die eigenen Truppen geradewegs in den Tod. Bis auf den letzten Schuss sollten sie versuchen zurückzuerobern, was längst verloren war – und sich dem Feind zum Sterben ausliefern.
Während er Stauffenberg und sich Tee einschenkte, dachte Olbricht an den gemeinsamen Spaziergang an der Spree, der schon eine Zeit lang zurücklag.
Während sie am Ufer entlangschlenderten, hatten sie beide ein schnelles Ende des Kriegs herbeigesehnt, um nicht noch mehr Soldaten beklagen zu müssen.
„Ich könnte den Frauen und Kindern der Gefallenen nicht in die Augen sehen, wenn ich nicht alles täte, dieses sinnlose Menschenopfer zu verhindern“, hatte Stauffenberg mit Entschlossenheit erklärt. Seine Worte klangen glaubwürdig und überzeugend, aber ob er sie wirklich ernst meinte, hatte Olbricht damals noch nicht recht einschätzen können. Er wusste, dass Stauffenberg Hitlers vernichtende Politik über Jahre verteidigt hatte und ein begeisterter Anhänger des Führers gewesen war. Dass ausgerechnet jemand wie er die Seiten gewechselt hatte, war erstaunlich, fast zu schön, um wahr zu sein.
Das gab Olbricht einerseits zu denken, andererseits sah er die Chance, Stauffenberg als Mitstreiter zu gewinnen. Trotz des Dilemmas, in dem er sich befand, weihte Olbricht den Oberst während des Spaziergangs in seine geheimen Pläne ein. „Ich arbeite seit Langem daran, wie ein Umsturz, bei dem wir Militärs die Macht im Staat übernehmen, reibungslos gelingen könnte“, hatte er ihm offenbart.
Im eigenen Büro vermied der General inzwischen vertrauliche Gespräche dieser Art, so auch jetzt. Die Gefahr, dass der „Feind“ mithörte, war zu groß. Olbricht trank einen Schluck Tee, setzte die Tasse wieder ab und fragte Stauffenberg scheinbar unverfänglich in einer Redeweise, die nur sie beide zu deuten wussten: „Wie sehen denn Ihre Urlaubspläne aus? Sind sie inzwischen gediehen?“
„Die Familie wartet schon auf mich, die Kinder fragen ständig nach mir. Ich werde bald genauer wissen, wann ein guter Termin für mich wäre hinzufahren“, antwortete Stauffenberg genauso harmlos und zeigte flüchtig einen Zettel, auf dem nicht mehr als ein Datum stand: 11. Juli?
Olbricht atmete verhalten auf und sah zu, wie sein Mitverschwörer das kleine Stück Papier umständlich wieder in die Jackentasche steckte. Aufgrund einer schweren Kriegsverletzung fehlten ihm eine Hand und an der anderen zwei Finger. Zudem hatte er nur noch ein Auge. Die Behinderungen bedeuteten für das, was sie vorhatten, eine zusätzliche Erschwernis, abgesehen von den ohnehin schlecht kalkulierbaren äußeren Bedingungen, dessen war Olbricht sich bewusst.
„Erlauben Sie mir noch die Frage nach Ihren Terminen. Werden Sie die nächste Zeit in Berlin sein?“, sagte Stauffenberg, der bereits im Aufbruch war.
„Ja, ich habe viel um die Ohren, aber ich komme mit der Arbeit gut voran.“ Olbricht nickte ihm zu und dachte dabei auch an die anderen Verbündeten. Zusammen waren sie nicht sehr viele, aber hoffentlich genug …









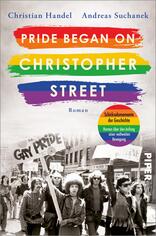








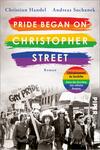


Ein Buch, dass man nicht weglegen möchte, bevor man es nicht zu Ende gelesen hat!
Bei diesem Roman handelt es sich um eine fiktive Geschichte. Er kreist um das historische Attentat von Stauffenberg auf Hitler und beschreibt die Kriegszeit. Die Autorin beschreibt das mögliche Umfeld Stauffenbergs aus der Sicht einer normalen Familie. Der Roman zeigt das Leben auf dem Lande und in der Stadt während den Wochen vor dem Attentat. Mit den Geschwistern Paula und Egon erleben wir den Kriegssommer 1944. Das eigentliche Attentat auf Hitler steht im Hintergrund. Es geht um das Leben einer Familie, um die Ängste vor Bomben, um die Planung einer Hochzeit mitten im Krieg und um den Schrecken und die Sinnlosigkeit des Krieges. Man erlebt die Konflikte, wenn ein Familienmitglied ein fanatischer Hitler-Verehrer ist und die anderen kriegsmüde sind. Die Zeit in der der Roman spielt, ist sehr anschaulich dargestellt. Und die Familiengeschichte der Hauptprotagonisten Paula und Egon ist packend und gefühlsmäßig berührend. Ich habe das Buch mit Begeisterung gelesen.
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.