
Eine amerikanische Familie - eBook-Ausgabe
Roman
„Shriver katapultiert uns mit scharfem Verstand und bissigem Witz ins Jahr 2029.“ - Brigitte
Eine amerikanische Familie — Inhalt
USA im Jahr 2029. Der Dollar ist kollabiert und durch eine Reservewährung ersetzt. Wasser ist kostbar geworden. Und Florence Mandible und ihr dreizehnjähriger Sohn Willing essen seit viel zu langer Zeit nur Kohl. Dass es Florence trotz guter Ausbildung so schwer haben würde, ihr Leben zu meistern, hätte niemand aus der Familie gedacht. Doch als die Mandibles alles verlieren und in einem Park Unterschlupf suchen müssen, sind es nicht die Erwachsenen, sondern Willing, der mit Pragmatismus, Weitsicht und notfalls auch krimineller Entschlossenheit dem Mandible-Clan wieder auf die Beine hilft … Scharfsinnig und ironisch erzählt Lionel Shriver von den Konsequenzen von Globalisierung und Nationalismus – eine beängstigende Zukunftsvision und ein komischer, liebevoller, fesselnder Familienroman.
Leseprobe zu „Eine amerikanische Familie“
2029
„Nimm kein sauberes Wasser zum Händewaschen!“
Was als sanfte Erinnerung gedacht war, kam als schrille Ermahnung. Florence wollte nicht wirken wie jemand, den ihr Sohn einen Boomertrottel nennen würde, trotzdem ... die Regeln im Haus waren einfach, und Esteban missachtete sie ständig. Dabei gab es genug Arten, klarzumachen, dass man nicht unter der Fuchtel einer (etwas) älteren Frau stand – auch ohne Wasser zu verschwenden. Er war ein so irrsinnig gutaussehender Mann, dass sie ihm sonst fast alles durchgehen ließ.
»Vergib mir, Vater, denn ich habe [...]
2029
„Nimm kein sauberes Wasser zum Händewaschen!“
Was als sanfte Erinnerung gedacht war, kam als schrille Ermahnung. Florence wollte nicht wirken wie jemand, den ihr Sohn einen Boomertrottel nennen würde, trotzdem ... die Regeln im Haus waren einfach, und Esteban missachtete sie ständig. Dabei gab es genug Arten, klarzumachen, dass man nicht unter der Fuchtel einer (etwas) älteren Frau stand – auch ohne Wasser zu verschwenden. Er war ein so irrsinnig gutaussehender Mann, dass sie ihm sonst fast alles durchgehen ließ.
„Vergib mir, Vater, denn ich habe gesündigt“, murmelte Esteban und steckte die Hände in die Plastikschüssel, in der das ablaufende Wasser aufgefangen wurde. Kohlschnipsel trieben am Rand entlang.
„Das bringt jetzt auch nichts mehr, oder?“, sagte Florence. „Sie mit dem Grauwasser zu waschen, wo du schon das saubere benutzt hast?“
„Ich tu nur, was man mir sagt.“
„Das ist ja was ganz Neues.“
„Was ist dir denn über die Leber gelaufen?“ Esteban wischte seine jetzt fettigen Hände an dem noch fettigeren Geschirrtuch ab (noch eine Regel: eine Rolle Küchenpapier muss sechs Wochen halten). „Stimmt was im Adelphi nicht?“
„Im Adelphi stimmt nie was“, sagte sie. „Drogen, Prügeleien, Diebstahl. Schreiende Babys mit Ekzemen. So sind Obdachlosenheime nun mal. Ernsthaft, ich kapiere nicht, warum es so schwer ist, die Leute dazu zu bekommen, die Toilettenspülung zu drücken. Was hier im Haus ein wahrer Luxus ist.“
„Ich wünschte, du fändest etwas Anderes.“
„Ich auch. Aber sag’s niemandem. Das würde meinen Heiligenschein zerstören.“ Florence schnitt weiter ihren Kohl klein. Auch für zwanzig Dollar noch preisgünstig, allerdings war sie nicht sicher, wie lange ihr Sohn Willing das Gemüse noch ertrug.
Die Leute waren immer erstaunt, dass sie jetzt schon seit vier langen Jahren, wie lobenswert!, einen so anstrengenden, undankbaren Job machte. Aber wer sie für einen Engel hielt, lag daneben. Vorher war sie von einer schlecht bezahlten Stelle (mitunter Teilzeitstellen) in die andere geschlittert, und das hatte ihr das naive Gutmenschentum, mit dem sie am Barnard College ihren schwachsinnigen Doppel-Abschluss in Amerikanistik und Umweltpolitik gemacht hatte, gründlich, oder doch fast, ausgetrieben. Die Hälfte ihrer Jobs hatte sich in Wohlgefallen aufgelöst, weil sie durch irgendeine Innovation plötzlich überflüssig wurden. So hatte Florence für eine Firma gearbeitet, die elektrische Unterwäsche zum Sparen von Heizkosten verkaufte, aber plötzlich wollten die Leute nur noch mit elektrifizierten Graphen beheizte Wäsche. Andere Stellen fielen durch Computerprogramme weg, die man in ihren Zwanzigern Bots genannt hatte, die für all die freigesetzten Arbeiter heute aber, aus nachvollziehbaren Gründen, nur noch Robs waren, Räuber, die ihnen die Existenz nahmen. Ihren vielversprechendsten Job hatte sie bei einem Start-up gehabt, das gut schmeckende Proteinriegel aus Grillenpulver herstellte. Als dann jedoch Hershey’s einen ähnlichen, allerdings berüchtigt fetthaltigen Riegel, massenproduzierte, brach der Markt für Snacks auf Insektenbasis ein. Auf die Anzeige für den Posten in einem städtischen Obdachlosenheim in Fort Greene bewarb sie sich aus einer Mischung von Verzweiflung und Cleverness: Das einzige, was New York City nie ausgehen würde, waren Obdachlose.
„Mom?“ Willing steckte den Kopf zur Tür herein und fragte ruhig: „Bin ich nicht mit Duschen dran?“
Ihr Dreizehnjähriger hatte erst vor fünf Tagen geduscht und wusste ganz genau, dass sie sich eigentlich auf einmal pro Woche geeinigt hatten (zwischendrin benutzten sie ein in die Haare zu kämmendes Trockenshampoo). Willing beschwerte sich im Übrigen auch, mit ihrem Ultra-Spar-Duschkopf werde das Duschen zu einem „Gang durch den Nebel“. Es stimmte, die Strahlen waren so fein, dass man kaum die Spülung aus dem Haar bekam. Aber die Antwort darauf bestand eben nicht darin, mehr Wasser zu verbrauchen, sondern auf die Spülung zu verzichten.
„Vielleicht noch nicht ganz ... aber okay“, gab sie nach. „Vergiss nur nicht, beim Einseifen das Wasser auszudrehen.“
„Dann wird mir kalt“, sagte er tonlos. Er beschwerte sich nicht. Es war eine Feststellung.
„Zittern soll gut für den Stoffwechsel sein“, sagte Florence.
„Mann, dann muss ich einen absolut geilen Stoffwechsel haben“, sagte Willing trocken und drehte sich um. Dass er sich über ihre leicht angestaubte Ausdrucksweise lustig machte, war nicht fair. Sie hatte vor ewigen Zeiten schon gelernt, stattdessen böse zu sagen.
„Wenn du recht hast, und das mit dem Wasser wird nur noch schlimmer“, sagte Esteban und stellte die Teller fürs Essen auf den Tisch, „sollten wir es aufdrehen, solange es geht.“
„Manchmal träume ich von einer langen, heißen Dusche“, gestand Florence.
„Ach?“ Er umfasste ihre Taille, während sie ein weiteres Stück Kohl aufschnitt. „Tief in dieser strengen, herrischen Chorsängerin steckt also eine Hedonistin, die an die Oberfläche drängt.“
„Mein Gott, als Teenager habe ich wahre Sturzfluten über mich rauschen lassen, und das so heiß, dass ich es gerade noch ertragen konnte. Einmal hab ich das Bad derartig vernebelt, dass wir es neu streichen mussten.“
„Das ist das Schärfste, was du mir je erzählt hast“, flüsterte er ihr ins Ohr.
„Oje, wie deprimierend.“
Er lachte. Bei seiner Arbeit musste er oft füllige ältere Körper in und aus Elektromobilen heben (Mobes nannte man die Dinger, wenn man auch nur entfernt hip war), das hielt ihn in Form. Sie spürte seine Brust- und Bauchmuskeln fest auf ihrem Rücken. Sicher, sie war müde und ehrliche Vierundvierzig, aber ihn so zu spüren, ließ sie wieder zu einem jungen Mädchen werden. Ihr Sex war gut. Vielleicht war es das Mexikanische, auf jeden Fall war er im Unterschied zu all den anderen Männern, die sie gekannt hatte, nicht vom fünften Lebensjahr an mit Pornos groß geworden. Ihm gefielen richtige Frauen.
Nicht, dass sich Florence da Besonderes zugutehielt. Ihre jüngere Schwester sah weit besser aus. Avery war dunkel und grazil, mit exakt der Dosis Zerbrechlichkeit, die Männer so anziehend fanden. Florence dagegen war sehnig und stark, da sie immer in Bewegung war, schmalhüftig und hibbelig, hatte ein langes Gesicht und eine dichte kastanienbraune Mähne, die ständig dem Kopftuch entwischte, das sie sich im Piratenstil um den Kopf knotete, um die widerspenstigen Locken zu bändigen. Manche sagten, sie hätte was von einem „Pferd“, was sie für abschätzig hielt, bis Esteban die Aussage mit Zuneigung füllte und die Lenden seines „nervösen Füllens“ tätschelte. Vielleicht gab es ja Schlimmeres.
„Ich habe da eine ganz andere Philosophie, weißt du“, murmelte Esteban in ihren Nacken. „Es gibt bald keinen Fisch mehr? Dann stopf dich mit chilenischem Seebarsch voll, als gäbe es kein Morgen.“
„Die Gefahr, dass es kein Morgen mehr gibt, ist genau der Punkt.“ Sie dämpfte das Oberlehrerhafte mit etwas Selbstironie, da sie wusste, dass ihm ihre strenge, aufrechte Fassade auf die Nerven ging. „Wenn jeder mit halbstündigem Duschen auf die Wasserknappheit reagiert, ›solange es noch geht‹, haben wir noch eher keins mehr. Und wenn dir das als Grund nicht reicht? Wasser ist teuer. Immens teuer, wie die Kids sagen.“
Er ließ ihre Taille los. „Du bist so eine Spaßbremse, mi querida. Wenn uns das Steini eines gelehrt hat, dann, dass die Welt von heute auf morgen zum Teufel gehen kann. Da dürfen wir uns in den kleinen Lücken zwischen den Katastrophen ruhig mal was gönnen.“
Da war was dran. Eigentlich hatte sie vorgehabt, das Pfund Schweinehack, das sie heute gekauft hatte und das ihr erstes richtiges Fleisch seit einem Monat war, über zwei Mahlzeiten zu strecken, aber nach Estebans Drängen, auch mal zu genießen, was sich bot, entschied sie sich hastig, die Portionen zu verdoppeln, und ihr wurde fast schwindelig angesichts der Verschwendung und Hemmungslosigkeit, doch dann sie fing sich: Sollen wir nicht angeblich zur Mittelklasse gehören?
Im Barnard hatte es noch als gewagt gegolten, ihre am Ende mit Auszeichnung angenommene Abschlussarbeit zum Thema Das Klassensystem, 1945 bis heute zu schreiben, bildeten sich die Amerikaner doch immer noch etwas darauf ein, eine klassenlose Gesellschaft zu sein. Allerdings war das vor dem legendären wirtschaftlichen Niedergang, der „Steinzeit“ oder dem „Steini“, der mit ihrem Abschluss zusammenfiel und nach dem Amerika plötzlich über nichts anderes mehr sprach als über Klassen.
Florence hatte sich eine schroffe, praktische Natur zu eigen gemacht und ließ kein Selbstmitleid aufkommen. Dank des Collegefonds ihres Großvaters lasteten die Kosten ihrer sinnlosen Ausbildung weniger auf ihr, als es bei vielen Freunden der Fall war, und sie mochte ihre Schwester ja um ihr Aussehen beneiden, deren Beruf wollte sie ganz sicher nicht. Insgeheim hielt sie Averys eher ausgefallene therapeutische Praxis „PhysHead“ für parasitären Humbug. Zudem hatte sich Florences Kauf eines Hauses in East Flatbush als clever erwiesen, war das einstmals verlotterte Viertel doch ins bessere Segment aufgestiegen. Die Inder in Mumbai probten den Aufstand, weil sie sich kein Gemüse mehr leisten konnten, Florence hatte noch ausreichend Geld für Zwiebeln. Rein formal mochte sie eine alleinerziehende Mutter sein, aber die waren in diesem Land gegenüber den verheirateten in der Überzahl, und so hatte auch das nichts Abwertendes mehr.
Nur ihre Eltern schienen das nicht zu kapieren. So wenig sie sich wieder einzukriegen vermochten mit ihren Versicherungen, wie „stolz“ sie doch auf sie seien, war ihr sich darin ausdrückender Glaube, dass ihre Älteste in ihren Vierzigern immer noch angefeuert werden musste, nichts anderes als eine Beleidigung. Die Lobeshymnen wegen ihrer Arbeit mit den Obdachlosen waren unerträglich. Sie hatte die Stelle nicht angenommen, weil es um eine gute Sache ging, sondern weil es ein Job war. Sicher, das Asyl war eine wichtige öffentliche Leistung, aber in einer für Florence idealen Welt wäre die von jemand anderem erbracht worden.
Klar, ihre Eltern hatten mit eigenen Belastungen zu kämpfen. Ihr Vater Carter hatte sich lange als Versager gefühlt. Ewig hatte er beim Newsday in Long Island festgesteckt, ohne eine der einflussreicheren, besser dotierten Stellen zu ergattern, die ihm seiner Meinung nach zugestanden hätten. (Wobei Dad auch nicht ganz mit sich im Reinen zu sein schien, was sein Verhältnis zu seiner Schwester Nollie anging, deren Bücher, wie er fand und mehr als einmal angedeutet hatte, weit überschätzt würden.) Gegen Ende seiner Karriere bekam er dann endlich einen Job bei seiner geliebten New York Times (Gott hab sie selig!). Es war zwar nur eine Stelle im Automobil-Teil, und später in der Immobilien-Redaktion, aber es in diese Zeitung zu schaffen, die er so verehrte, war eine späte Anerkennung seiner lebenslangen Bemühungen. Florences Mutter Jayne stolperte von einem apokalyptischen Projekt zum nächsten und führte schließlich die geliebte Buchhandlung Shelf Life, bis sie bankrottging. Der Feinkostladen mit Selbstgemachtem in der Smith Street, den sie darauf übernahm, wurde in der Steinzeit geplündert, was sie so traumatisierte, dass sie keinen Fuß mehr hineinzusetzen vermochte. Aber ihnen gehörte das Haus, oder etwa nicht? Es war abbezahlt! Und ein Auto hatten sie auch immer gehabt. Sicher, es hatte die üblichen Probleme gegeben, Familie und Karriere unter einen Hut zu bringen, aber sie hatten tatsächlich noch „Karrieren“, nicht einfach nur Jobs. Als Jayne spät noch mit Jarred schwanger wurde, sorgten sie sich wegen des Altersunterschieds zu den beiden Mädchen, aber keiner quälte sich wie Florence, als sie mit Willing schwanger war, ob sie sich das Kind überhaupt leisten konnte.
Wie sollten die beiden die missliche Lage ihrer älteren Tochter verstehen? Sechs lange Jahre hatte Florence nach ihrem Abschluss bei ihnen in Carroll Gardens leben müssen, und diese große, hässliche Leerstelle verschandelte ihren Lebenslauf immer noch. Wenigstens war ihr kleiner Bruder Jarred noch zu Hause gewesen, ging in die Highschool und leistete ihr Gesellschaft. Dennoch, es war erniedrigend, sich für den blöden Bachelor abgerackert zu haben, um anschließend Rezepte für Erdnussbutter-Brownies mit Chocolate Chips und Minzgeschmack auszuprobieren. Während der sogenannten „Erholung“ nach dem Steini zog sie endlich aus, zog in enge, schäbige Behausungen, die sie sich mit Altersgenossen teilte, die wie sie Abschlüsse von Elite-Unis hatten, in Geschichte oder Politik, die kellnerten und Kaffee aufbrühten, Tische abräumten und alte Smartphones verhökerten, unzuverlässige Dinger, die abstürzten und die man ständig im Apple-Store aufladen musste. Keine einzige der bescheuerten Stellen, die sie seitdem hatte ergattern können, hatte auch nur entfernt mit ihrem formalen Abschluss zu tun gehabt.
Es stimmte, die USA kamen schneller wieder aus der Krise heraus als vorhergesagt. Die Restaurants in New York waren wieder voll, und der Aktienmarkt boomte. Aber Florence interessierte nicht, ob der Dow Jones jetzt bei 30.000 oder 40.000 stand, weil der wahnsinnige Aufwärtstrend ihr, Willing und Esteban rein gar nichts brachte. Vielleicht gehörte sie eben doch nicht zur Mittelklasse, vielleicht war ihr Gefühl, immer noch Teil davon zu sein, kaum mehr als der letzte Nachhall ihrer Kindheit in einer gebildeten, kultivierten Familie, an den sie sich klammerte, um sich von Leuten abzusetzen, denen es eigentlich nicht viel schlechter ging als ihr. Es gab nicht so viele unterschiedliche Gerichte, die sich allein aus Zwiebeln herstellen ließen.
„Mom!“, rief Willing aus dem Wohnzimmer. „Was ist eine Reservewährung?“
Florence wischte sich die Hände am Geschirrtuch ab, das kalte Grauwasser hatte das Fett der Frikadellen nicht abwaschen können. Ihr Sohn war frisch geduscht und das nasse Haar ein wilder, dunkler Wuschel. Wenn er in diesem Jahr auch einige Zentimeter gewachsen war, wirkte er doch immer noch zart und etwas zu klein dafür, dass er in drei Monaten vierzehn wurde. Früher war er ausgelassen und wild gewesen, doch jener schicksalshafte März vor fünf Jahren hatte ihn, wenn auch nicht unbedingt ängstlich (er war kein kleines Kind mehr), so doch wachsam werden lassen. Er war zu ernst für sein Alter, und zu ruhig. Manchmal fühlte sie sich von ihm unangenehm beobachtet, als lebte sie unter dem unbewegten Auge einer Überwachungskamera. Florence wusste nicht, was sie vor ihrem Sohn verbergen wollte. Was die Privatsphäre am besten schützte, war nicht Heimlichtuerei, sondern Gleichgültigkeit, damit sich die Leute einfach nicht für dich interessierten.
Der für einen Cockerspaniel ebenfalls ausgesprochen ruhige Milo lag reglos neben seinem Herrn, die Schnauze sorgenvoll auf dem Boden, wobei die ständig in Falten liegende Stirn vielleicht auf einen Tropfen Bluthund verwies. Das schokoladenbraune Fell glänzte, doch die Augen blickten bekümmert. Was für ein Pärchen.
Typisch für diese Uhrzeit bekriegte sich Willing nicht mit Aliens und Warlords, sondern sah sich die Nachrichten an. Es war schon witzig, jahrelang hatten sie das Ende des Fernsehens vorausgesagt, Programme wurden gestreamt, aber das Nachrichtenformat hatte sich erhalten – es bot das offene Feuer, den gemeinschaftlichen Herd, und war durch individuelle Gadgets nicht wirklich zu ersetzen. Seit dem fast kompletten Ende der Zeitungen hatte der Printjournalismus einem Gesindel von Amateuren Platz gemacht, die ungeprüfte Geschichten verbreiteten, und das so gut wie immer zu ideologischen Zwecken. Die Fernsehnachrichten waren mit die letzte Informationsquelle, der Florence noch irgendwie traute. Der Dollar ist mittlerweile unter vierzig Prozent des weltweiten ... hörte sie einen Sprecher jammern.
„Ich habe keine Ahnung, was eine Reservewährung ist“, gestand sie. „Ich verfolge das ganze Wirtschaftsgeschwätz nicht mehr. Als ich vom College abging, redeten die Leute von nichts anderem. Es ging nur noch um Derivate, Zinsniveaus und etwas, das LIBOR hieß. Ich konnte es nicht mehr hören. Eigentlich hat es mich nie sonderlich interessiert.“
„Ist es nicht wichtig?“
„Nicht, ob ich daran interessiert bin. Ich schwöre, jahrelang hab ich die Zeitungen von vorne bis hinten gelesen, aber dass ich wusste, wovon ich mittlerweile das meiste wieder vergessen habe, hat nichts geändert. Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückbekommen. Ich dachte immer, ich würde die Zeitungen vermissen, aber das tu ich nicht.“
„Erzähl das nicht Carter“, sagte Willing. „Du würdest ihm wehtun.“
Florence zuckte bei „Carter“ zusammen. Ihre Eltern hatten alle Enkel und Enkelinnen gedrängt, sie beim Vornamen zu nennen. Da sie „erst“ fünfzig und zweiundfünfzig waren, als Avery ihr erstes Kind bekam, lehnten sie „Grandma“ und „Granddad“ ab, suggerierte es doch einen eher geriatrischen Zustand, mit dem sie sich nicht identifizieren konnten. Offenbar stellten sie sich vor, als „Jayne“ und „Carter“ etwas behaglich Egalitäres auszustrahlen, ganz so, als wären sie nicht älter, sondern Kumpel. Vermutlich sollte die Zurückweisung der Konvention sie jung und modern erscheinen lassen. Florence war das unbehaglich, sprach ihr Sohn doch mit einer größeren Vertrautheit über ihre Eltern als sie selbst. Deren Weigerung, die offizielle Bezeichnung für das abzulehnen, was sie nun mal waren, Willings Großeltern, ob es ihnen gefiel oder nicht, zeugte von Selbsttäuschung und war ein Ausweis von Schwäche. Florence schämte sich für sie, wenn es ihnen selbst schon nicht peinlich war. Die forcierte Kumpanei führte nicht zu größerer Nähe, sondern zu Respektlosigkeit. Und statt irgendwie doch nonkonformistisch zu sein, war die „Jayne“-und-„Carter“-Nummer auf ermüdende Weise typisch für die Babyboomer. Trotzdem sollte Florence ihren Unmut darüber nicht an Willing auslassen, der nur tat, was ihm gesagt wurde.
„Keine Sorge, ich habe gegenüber deinem Großvater nie etwas Schlechtes über Zeitungen gesagt“, erwiderte Florence. „Aber selbst während der Steinzeit ... Alle dachten, es sei so schrecklich, und einiges war es ja auch. Aber, Mann, für mich war die Befreiung von all dem Lärm echt cool ...“ Sie hob die Hände. „Sorry, lässig natürlich. Alles schien leicht, heiter und offen. Mir war zuvor nie aufgefallen, dass ein Tag so lang war.“
„Du hast wieder angefangen, Bücher zu lesen.“ Die Erwähnung der Steinzeit machte Willing nachdenklich.
„Nun, das hat nicht lange angehalten! Aber du hast recht. Ich habe wieder Bücher gelesen, die alten, zum Blättern. Tante Avery fand das ›skurril‹.“ Sie klopfte ihrem Sohn auf die Schulter und überließ ihn den Langweiligsten Nachrichten Aller Zeiten. Gott, Willing musste der einzige Dreizehnjährige in Brooklyn sein, den die Wirtschaftsnachrichten faszinierten.
Sie sah nach dem Reis und versuchte sich daran zu erinnern, was ihrem merkwürdigen Sohn zur Unterernährung in Afrika und Indien eingefallen war, die wieder zunahm, nachdem beide Regionen solche Fortschritte gemacht hatten. Es sei ein Skandal, dass die Armen dort nicht genug zu essen hätten, hatte sie geklagt, wo es auf dem Planeten doch so viel Nahrung gebe. Worauf Willing einfach nur antwortete: „Nein, gibt es nicht“, und eine gequälte Erklärung seines Urgroßvaters rekapitulierte, irgendwas wie: „Es scheint nur so, als gäbe es genug Nahrung, selbst wenn du den Armen Geld geben würdest, würden die Preise nur noch höher schießen, und sie könnten sich immer noch nichts leisten.“ Was überhaupt keinen Sinn ergab. In Anwesenheit von Willing sollte sie die Propagandareden ihres Großvaters genauer überwachen. Der alte Mann war eigentlich liberal, aber sie hatte noch nie jemanden mit Geld kennengelernt, der keinerlei konservative Instinkte hatte. Einer davon bestand etwa darin, das moralisch Offensichtliche (wenn es fiskalisch nicht genehm war) schrecklich kompliziert erscheinen zu lassen. Wenn der Reis zu teuer ist, gib den Leuten eben das Geld dafür. Basta.
In der Schule war Willing eher zurückhaltend und bescheiden, aber hinter geschlossener Tür konnte er ziemlich penetrant werden.
„Übrigens, ich habe ausgemacht, nach dem Essen mit meiner Schwester zu sprechen“, sagte Florence zu Esteban, als der nach einem kalten Bier griff. „Ich hoffe, es stört dich nicht, den Abwasch zu übernehmen.“
„Lass mich sauberes Wasser benutzen, und ich wasche jeden Tag ab.“
„Das Grauwasser ist sauber genug, nur nicht besonders klar.“ Sie wollte diese Auseinandersetzung nicht jeden Abend austragen und war erleichtert, dass er das Thema wechselte, als das Fleisch zu brutzeln anfing.
„Hab am Nachmittag die neue Gruppe getroffen, mit der wir auf den Mount Washington raufgehen“, sagte Esteban, „und gleich den Störenfried ausfindig gemacht. Es sind nie die schwachen, bedauernswerten Klienten, die uns Kummer machen, sondern die geriatrischen Superhelden, normalerweise Männer, manchmal ist es allerdings auch einer von den taffen Ich-glaube-ich-bin-immer-noch-fünfunddreißig-Drachen, die ohne Klebeband und plastische Chirurgie, Hunderttausende stecken sie da rein, längst auseinandergefallen wären.“
Er wusste, sie mochte es nicht, wenn er mit solcher Verachtung über seine Kunden sprach, aber vielleicht musste er sich seine Frustration einfach außerhalb von deren Hörweite aus dem System schaffen. „Und, wer ist es?“, fragte sie. „Himmel, das Fleisch ist so voller Wasser, die Frikadellen werden gekocht, statt gebraten.“
„Muss schon über achtzig sein, geht man nach den sehnigen Bizepsknollen. Verbringt sicher Stunden im Fitnesscenter und merkt nicht, dass er mittlerweile mit Hanteln aus Balsaholz trainiert. Wollte meinen Sicherheitsinstruktionen nicht zuhören. Seine einzige Frage war, wie wir damit umgehen, dass Leute ›verschieden schnell gehen‹ und einige Kletterer gerne was aus sich ›rausholen‹. Das ist ein Typ. Einer von den Rennern, oder wenigstens war er mal einer, aber das war vor den zwei neuen Hüften und den fünf minimalinvasiven Herz-OPs. Du kannst drauf wetten, dass diese Kerle Geld haben und mal sehr erfolgreich waren, irgendwann vor Beginn der Zeitrechnung, und deshalb traut sich auch niemand, ihnen zu sagen, dass sie verdammt noch mal alt sind. Für gewöhnlich hat ihr Arzt oder Ehepartner die Regel erlassen, sie dürfen nicht mehr raus in den Wald, ohne dass einer dabei ist, der sie aufliest, wenn sie in ein Loch oder eine Rinne fallen und sich die Beine brechen. Aber die Vorstellung, in einer Gruppe loszuziehen, gefällt ihnen nicht und sie gucken sich ständig um nach den anderen arthritischen Losern und denken: Was mache ich hier mit diesen Boomerscheißern?, wo sie doch bestens dazu passen. Sie folgen den Anweisungen nicht und sind dann genau die, denen was passiert und die uns einen schlechten Ruf verschaffen. Bei einer Kanufahrt schießen sie allein los, nehmen den falschen Zufluss, und wir müssen den ganzen Trupp allein lassen, um sie zu suchen. Weil es ihnen nicht gefällt, einem Führer zu folgen. Besonders nicht einem Latino-Führer. Es macht sie wütend, dass heute die Lats den Laden schmeißen, wo doch einer ...“
„Genug.“ Florence warf den Kohl hinein, langsam sah es aus wie Schweinesuppe. „Du vergisst, dass ich auf deiner Seite bin.“
„Ich weiß, du kannst es nicht mehr hören, aber du machst dir keine Vorstellung davon, welche Feindseligkeit mir tagtäglich von den Knittrigen entgegenschlägt. Sie wollen ihre Oberherrschaft zurück, selbst die, die denken, fortschrittlich zu sein. Sie wollen Anerkennung dafür, tolerant zu sein, ohne sich einzugestehen, dass man nur ›toleriert‹, was man nicht ausstehen kann. Im Übrigen müssen wir die Idioten genauso tolerieren, wie die sich mit uns abzufinden haben. Es ist genauso unser Land wie das dieser War-mal-Gringos, und wäre es noch mehr, wenn sich die tattrigen weißen Schwachköpfe beeilten und endlich sterben würden.“
„Mi amado, das geht zu weit“, schimpfte sie halbherzig. „Bitte rede vor Willing nicht so.“
Wie immer musste sie Esteban nicht bitten, den Tisch zu decken, Wasser einzugießen und den Salzstreuer aufzufüllen. Er war in einer riesigen Familie aufgewachsen und fasste selbstverständlich mit an. Esteban war ihr erster Freund, der sie davon überzeugt hatte, dass, auch wenn sie keine Gesellschaft brauchte, und auch niemanden, der ihr half, ihren Sohn großzuziehen, das noch lange nicht hieß, dass sie keinen Mann in ihrem Bett mögen und es ihr nicht gefallen durfte, dass Willing so eine Art Vater hatte – der es sich zugutehalten konnte, dass ihr Sohn perfekt zweisprachig war. Wobei Esteban in Amerika geboren und aufgewachsen war und ein völlig akzentfreies Englisch sprach. Gelegentliche spanische Einschübe waren meist augenzwinkernd gemeint, ein lustiges Spiel mit dem Klischee, das seine etwas betagteren Klienten begierig aufgriffen. Sicher, er war nicht aufs College gegangen, doch das war ihrer Meinung nach eher ein kluger finanzieller Schachzug gewesen.
Was das Ethnische anging, so stimmte es einfach nicht, dass sie sich, wie ihre Schwester eindeutig glaubte, an einen Lat gehängt hatte, um hip (upps!, lässig) zu sein, zu vereinnahmen, was sie nicht vertreiben konnte, oder aus banaler liberaler Scham ihr Erbe zu verleugnen. Ungeachtet seiner Abstammung war Esteban ein entschiedener, verantwortungsbewusster, vitaler Mann, und sie hatten viel gemeinsam, nicht zuletzt, dass ihr Lieblingsgefühl Entrüstung war. Trotzdem fühlte sie sich mit der Wahl eines mexikanischen Liebhabers auch auf der richtigen Seite der Geschichte, offen und nach vorn blickend, und ja, es stimmte, seine Herkunft war ein Plus. Ob sie sich immer noch so von ihm angezogen fühlte, wenn er ein normaler weißer Mann wäre, war eine Frage, die sie sich nicht stellen mochte. Menschen waren Gesamtpakete. Man konnte nicht auseinanderfieseln, wer und was sie waren, und unterm Strich mochte sie einfach Estebans nussfarbene Haut, seinen seidigen schwarzen Zopf und fand die weiten, hohen Wangenknochen unwiderstehlich sexy. Mit seiner Andersartigkeit erweiterte er ihre Welt und gewährte ihr Zutritt zu einem reichen, komplexen amerikanischen Paralleluniversum, das für vernagelte rechte Paranoide wie ihre Schwester Avery eine undurchschaubare, monumentale Bedrohung darstellte.
„Hey, erinnerst du dich an den Mann, der letztes Jahr gegenüber auf der anderen Straßenseite eingezogen ist?“, sagte Florence, während Esteban die Kohlreste vom Boden auffegte. „Brendan Sowieso. Da habe ich dir gesagt, es sei ein Zeichen dafür, dass ich mir heute hier im Viertel kein Haus mehr würde kaufen können. Er arbeitet an der Wall Street.“
„Yeah, dunkel. Ein Investmentbanker, sagtest du.“
„Heute Morgen bin ich ihm auf dem Weg zum Bus begegnet, und wir hatten eine ziemlich merkwürdige Unterhaltung. Ich glaube, er wollte mir helfen. Ich hab das Gefühl, er mag mich.“
„Hey, das gefällt mir aber gar nicht!“
„Oh, das ist sicher nur wieder dieser abscheuliche Ruf von Güte und Barmherzigkeit, der mir wie nasser Straßenköter überallhin folgt. Er sagte, wir sollten ›unsere Investitionen‹ aus dem Land schaffen, sofort, heute noch, und alles Bargeld in eine andere Währung tauschen. Was für Bargeld, bitteschön? Ich wünschte, es wäre nicht so komisch, ›und gehen Sie‹, ich zitiere, ›aus allen Dollar-Aktiva raus‹. Gott, er war richtig theatralisch. Vielleicht haben diese Leute sonst nicht viel Drama in ihrem Leben. Bei der Schulter hat er mich gefasst und mir direkt in die Augen gesehen, ganz so wie: Das ist verdammt noch mal ernst gemeint, ich mache keine Witze. Es war irre. Keine Ahnung, was ihn auf die Idee bringt, Leute wie wir hätten ›Investitionen‹.“
„Hätten wir ja auch, wenn dein abuelo abdanken würde.“
„Wenn wir da auch nur einen Cent sehen wollen, müssen auch meine Eltern abdanken. Fordere das Schicksal nicht heraus.“
Obwohl Esteban kein Goldgräber war, wurde Florence immer leicht unwohl, wenn vom Vermögen der Mandibles die Rede war. Ohnehin schien niemand zu wissen, wie groß es war. Der wohlhabende Großvater väterlicherseits hatte ihre bescheidene Kindheit nicht merklich verändert, und über die Zeit hatte sie einiges an Energie darauf verwandt, ihren Lat-Freund davon zu überzeugen, dass sie keine faule, verwöhnte, anspruchsberechtigte Gringa war, die ihr Glück nicht verdiente – aber wann immer das Geld Erwähnung fand, hob die verhätschelte Kreatur wieder den Kopf. Es war heikel genug, dass sie die Übertragungsurkunde von 335 East 55th Street besaß und Estebans Angebot widerstanden hatte, sich an den Hypothekenzahlungen zu beteiligen. Sie waren jetzt seit fünf Jahren zusammen, aber ihm zu erlauben, sich Ansprüche auf ihr Kapital zu erwerben, hätte geheißen, der Beziehung eine Umdrehung mehr zu trauen, als es sich für sie angesichts der Reihe seiner Vorgänger richtig anfühlte. Samt und sonders hatten sie sich als spektakuläre Enttäuschungen erwiesen.
„Was, denkst du, geht da vor, dass der Kerl so was so sagt?“, fragte Esteban. „So aus dem Blauen heraus.“
„Ich weiß es nicht. Offenbar ist vor ein paar Tagen in England eine Bank pleite gegangen, aber was soll’s. Es kam in den Nachrichten und hat nichts mit uns zu tun. Und gestern, was war da noch wieder, da hat bei irgendwem irgendwie was mit der ›Zinsbindung‹ nicht funktioniert ...? Du weißt, dass ich das nicht verfolge, aber das war auch irgendwo in Europa. Nach Jahren des ›geordneten Rückzugs aus dem Euro‹ bin ich deren Finanzprobleme immens leid. Wobei, in den Nachrichten eben, die Willing sich immer ansieht, da ging es um Anleihen. Trotzdem, ich wette, Brendan wollte mich nur beeindrucken.
Oh, und wo wir schon davon reden, was wirklich super merkwürdig war“, erinnerte sie sich und stellte das Essen auf den Tisch. „Brendan wollte wissen, ob uns das Haus gehört, und als ich ja sagte, und dass wir einen Mieter hätte, der helfe, das Darlehen zu bezahlen, meinte er: ›Besitz könnte sich als günstig erweisen. Dass Sie einen Mieter haben, könnten Sie bereuen.‹“
Bei den berühmten Wo-warst-du-damals-Fragen war es nur zu leicht, so zu tun, als erinnerte man sich: zurückzublicken und die harten Fakten, die man erst im Nachhinein erfahren hatte, in die eigentlich nebulöse Vergangenheit zu pflanzen. Für jemanden wie seine Großtante Nollie ging es mit dem Kennedy-Attentat so, für die Generation seiner Mutter mit 9/11. Und so beschloss Willing denn, sich später wirklich in allen Einzelheiten an diesen Abend zu erinnern, bis hin zu den sandigen Frikadellen, dem langen Video-Palaver zwischen seiner Mutter und seiner Tante nach dem Essen und der zeitweisen Wassersperre (an die sie sich längst gewöhnt hatten). Dabei wollte er nicht verschweigen, dass er noch nicht gewusst hatte, was eine Reservewährung war, genauso wenig wie, was unter einer Anleihenauktion zu verstehen war, obwohl beides zweifellos schon seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten, von fast allen für langweilig und unwichtig gehalten wurde. Trotzdem wollte er sich zumindest so viel zugutehalten: Dass ihm in den Sieben-Uhr-Nachrichten, auch wenn er nicht kapiert hatte, was es mit der „Anlagenauktion des Finanzministeriums“ und der „Zinsniveauspitze“ auf sich hatte, der Ton aufgefallen war.
Seit der Steinzeit hatte er ein Ohr für derlei Dinge. Alle dachten, dass sie das Schlimmste hinter sich hätten und die Ordnung glorreich und dauerhaft wiederhergestellt sei. Für Willing jedoch war seine eigene grundlegende Wo-warst-du-damals-Begebenheit im zarten Alter von acht Jahren, Der-Tag-an-dem-nichts-mehr-weiterging, eine Offenbarung gewesen, und Offenbarungen ließen sich nicht rückgängig machen oder irgendwo in einem Schrank verstauen. In Folge dieser irreversiblen Erleuchtung hatte er gelernt, Erwartungen zu kippen. Es war nichts Erstaunliches daran, dass Dinge nicht funktionierten und zerfielen. Versagen und Verfall waren der natürliche Zustand der Welt. Erstaunlich war eher, dass überhaupt etwas wie beabsichtigt funktionierte, für wie lange auch immer. So hatte er die letzten Jahre in einem Zustand dankbaren Staunens verbracht – über den Fernseher, der immer wieder mit supergesättigten Farben zum Leben erwachte (er lässt sich einschalten!, schon wieder!), über seine Mutter, die mit einem Bus von der Arbeit kam (pünktlich!, und überhaupt!), und dass sauberes Wasser aus der Leitung floss, auch wenn er es kaum einmal benutzen durfte.
Der Ton fiel ihm auf, als seine Mutter noch in der Küche plauderte und mit dem Kohl hantierte. Weder sie noch Esteban schienen zu bemerken, dass da etwas Besonderes mitschwang. Nur Willing. Willing und Milo, um genau zu sein, denn auch der Spaniel hörte etwas Sonderbares, reckte aufmerksam den Kopf, sah zum Bildschirm hin und hob die Ohren. In der Stimme des Sprechers schwang eine Art nervöser Erregung mit. Leute, die Nachrichten verlasen, liebten es, wenn etwas passierte. Das konnte man ihnen kaum vorwerfen, war es doch ihr Job zu verkünden, was war, und sie hatten nun mal gern zu tun. Wenn es um schlimme Ereignisse ging, was fast immer der Fall war, da gute Nachrichten meist bedeuteten, dass alles gleich blieb, waren sie peinlich berührt, wie glücklich sie das Schlimme machte. Die schlechten Moderatoren verbargen ihr Glück hinter übertrieben falscher Traurigkeit, auf die keiner hereinfiel. Willing wünschte, sie würden es lieber gleich lassen.
Wenigstens war für‘s erste keiner gestorben, und was immer das für undurchschaubare Geschehnisse waren, über die da berichtet wurde, sie hatten mit Zahlen und sperrigen Begriffen zu tun, die, da hätte Willing gewettet, vom Rest der Zuschauer auch nicht verstanden wurden. Und so zogen denn der Sprecher und seine Gäste die Mundwinkel auch nicht herunter und wechselten in ein künstlich bedrücktes Moll. Im Gegenteil, alle im Studio schienen zufrieden, ja sogar begeistert. Wobei ihre kribblige Fröhlichkeit vom klaren Bewusstsein durchdrungen war, dass sie, so gut es ging, ihre Erregung verbergen sollten, die sie bald schon bedauern würden. Der Ton besagte: Im Moment ist es fun, aber das wird nicht lange halten.
„Eine wahnsinnig aktuelle, immens treffsichere und bezaubernd zynische SF-Satire.“
„Obwohl Lionel Shriver einen pessimistischen Blick in die Zukunft ihres Landes wirft, hat sie doch unwillkürlich auch einen Roman über den amerikanischen Traum geschrieben, der in jeder Epoche immer wieder gelebt werden kann, vorausgesetzt es gibt Menschen wie den jungen Willing, der mit Einfallsreichtum und Entschlossenheit auf die jeweils neuen Verhältnisse reagiert.“
„Was wäre, wenn der Dollar kollabieren würde? Shriver hat für ihr Buch intensiv recherchiert und kann die wirtschaftliche Kettenreaktion entsprechend kenntnisreich beschreiben. Seine besondere Stärke entfaltet ihr Buch aber an den Stellen, an denen es die Folgen der ökonomischen Apokalypse im zwischenmenschlichen Bereich beschreibt. Wie die Menschen reagieren, wenn plötzlich auf nichts mehr Verlass ist. Man muss sich fast dazu zwingen, nach der Lektüre nicht zum nächsten Supermarkt zu fahren, um Klopapier zu horten.“
„In diesem düsteren Szenario (…) schlägt die Autorin an vielen Stellen einen recht ungewöhnlichen Ton an: Er ist recht schwarzhumorig, gar zynisch und verstärkt die Wirkung des beklemmenden Geschehens. Großartig sind zudem die lebendigen wie dichten Dialoge (…).“
„(…) ein durchaus fordernder und dennoch auf hohem Niveau unterhaltender Roman, der ein beängstigendes, aber realistisches Szenario entwirft. Eine Geschichte, die das, was wir für selbstverständlich erachten, in Zweifel zieht. Und die trotzdem nicht ohne Hoffnung ist. Ein absolut lesenswerter Roman.“
„Die Konsequenzen von Globalisierung und Nationalismus werden in diesem spannenden Familienroman überzeugend und humorvoll dargelegt ….“
„Lionel Shriver hat mit ›Eine amerikanische Familie‹ einen Weckruf geschrieben, der in seiner Komplexität weit über die Grenzen Nordamerikas reicht und trotz des nicht gerade amüsanten Themas spannend und empfehlenswert ist …“
„Shrivers euer Roman ›Eine amerikanische Familie‹ ist eine treffsichere Satire auf unsere Gegenwart, und damit die genüsslichste Form der Speculative Fiction.“
„Beklemmend gute Zukunftsmusik.“
„Lionel Shriver, hochgelobte US-Schriftstellerin, zeichnet in ›Eine amerikanische Familie‹ ein kraftvolles Sittengemälde einer apokalyptischen Zeit, in der den Menschen jede Moral abhandengekommen ist. (…) Spannend, packend, ironisch, philosophisch und mit politischer Relevanz erzählt sie von einer ›Amerikanischen Familie‹ in einer untergehenden Welt.“
„Hochdramatisch und bitterböse.“
„Sie liefert erschreckend klarsichtige Analysen unseres Lebens auf Pump in einer packenden Story.“
„Lionel Shriver hat mit ›Eine amerikanische Familie‹ einen Zukunftsroman – nicht zuletzt über Geld - geschrieben, der mit satirischer Energie hellsichtig in unsere Gegenwart strahlt.“
„Shriver katapultiert uns mit scharfem Verstand und bissigem Witz ins Jahr 2029.“


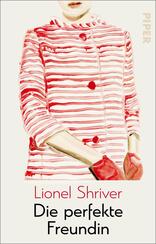











DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.