
Erika und Therese - eBook-Ausgabe
Erika Mann und Therese Giehse – Eine Liebe zwischen Kunst und Krieg
„Die Autorin Gunna Wendt verarbeitete diese Schicksalsjahre zu einem Doppelportät, das Tabus und Traumata einer Generation nicht ausspart.“ - HAZ Magazin (CH)
Erika und Therese — Inhalt
Zwei Frauen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten: Erika Mann, talentierte Tochter Thomas Manns, und Therese Giehse, beliebte Theaterschauspielerin. Als sie sich kennenlernten, waren beide bereits etabliert und wagten kurz darauf dennoch einen Neubeginn: Am 1. Januar 1933 gründeten sie das politische Kabarett „Die Pfeffermühle“. Erika verfasste die Szenen, in denen Therese brillierte. Doch schon zwei Monate später mussten die beiden Frauen, die nicht nur das gemeinsame Projekt, sondern auch eine problematische Liebesbeziehung verband, ins Schweizer Exil, bis ihre Wege sich 1937 schließlich trennten. Gunna Wendt verarbeitet diese Schicksalsjahre zweier ungleicher Frauen zu einem einmaligen Doppelporträt, das Tabus und Traumata einer Generation nicht ausspart.
Leseprobe zu „Erika und Therese“
Prolog
„Nicht auch noch du! Du …“ Erika, die Redegewandte, schien nach Worten zu ringen. Sie blickte die erschrockene Freundin so wütend an, wie es Therese bisher noch nicht erlebt hatte. Wütend und zugleich enttäuscht. Gerade in der Garderobe angekommen und in ihr Auftrittskostüm geschlüpft, sah Erika aus wie ein verzweifelter Pierrot. Auch ohne Maske und Schminke.
„Unschuld, Hoffnung, Neid und Trauer, / Scham und Schande hab ich an, – / Wartet, wartet bis genauer / Ich es Euch erklären kann“, ging es Therese durch den Kopf. Sie liebte es, die Freundin [...]
Prolog
„Nicht auch noch du! Du …“ Erika, die Redegewandte, schien nach Worten zu ringen. Sie blickte die erschrockene Freundin so wütend an, wie es Therese bisher noch nicht erlebt hatte. Wütend und zugleich enttäuscht. Gerade in der Garderobe angekommen und in ihr Auftrittskostüm geschlüpft, sah Erika aus wie ein verzweifelter Pierrot. Auch ohne Maske und Schminke.
„Unschuld, Hoffnung, Neid und Trauer, / Scham und Schande hab ich an, – / Wartet, wartet bis genauer / Ich es Euch erklären kann“, ging es Therese durch den Kopf. Sie liebte es, die Freundin in dieser Rolle zu sehen.
Erikas Augen ließen Therese nicht los, sodass sie sich verpflichtet fühlte, der Freundin zu antworten. Etwas, was sie nur widerwillig tat. Sie ließ sich ungern provozieren. Sie wollte selbst bestimmen, wann sie zu Wort kam. Im Zweifelsfall verzichtete sie am liebsten ganz darauf. Erklärungen, Erörterungen, Bekenntnisse, Geständnisse – so etwas war nicht ihre Sache. Das konnten andere besser, vor allem Erika. Wenn die erst einmal anfing zu reden … Therese lächelte, was Erika sofort registrierte: „Was gibt es da zu lachen? Es ist mir ernst. Sag doch endlich was. Warum wirfst du mir vor, dass ich lüge?“
„Weil du mir lang und breit erzählst, wie du mit Klaus an den Texten für unser Programm gearbeitet hast, aber nicht mit einem Satz erwähnst, dass du Fritz getroffen hast.“ So, jetzt war es heraus. Trotzig blickte Therese vor sich hin. Sie machte keine Anstalten, sich umzuziehen, obwohl sie wieder einmal spät dran waren. Die Pfeffermühle würde in weniger als einer halben Stunde den Vorhang öffnen.
Erika wurde laut: „Das war doch nicht wichtig.“
„Mir schon. Ich hab dich gefragt, ob noch jemand dabei war. Du hast dich ewig lange über Valentin ausgelassen und wie schlecht er die Liesl behandelt. Dass er sie unterdrückt, dass er sie benutzt, dass er sie kleinmacht. Das weiß ich doch. Ich weiß, wie gut sie ist. Sonst hätte ich doch gar nicht erst vorgeschlagen, dass sie mich an den Kammerspielen vertritt. Sie hat das bravourös gemacht: zwei Vorstellungen an zwei verschiedenen Häusern an einem Abend, hin- und herlaufen von der Bonbonniere zu den Kammerspielen – das ist kein Kinderspiel, das kannst du mir glauben.“
„Und dann muss sie sich von Valentin noch sagen lassen: ›Vergiss nicht, die richtige Liesl Karlstadt bist du nur an meiner Seite!‹“, ergänzte Erika. „Aber sie ist nicht nur eine sehr gute Schauspielerin, sie hat sich alles, was die beiden auf der Bühne vorführen, mit ausgedacht. Und das wird immer unterschlagen. Das ist ungerecht.“
Therese schüttelte verständnislos den Kopf. Erika erzählte nichts Neues. All das war ihnen beiden seit Langem bekannt. Doch was konnten sie dagegen tun? Warum hatte die Freundin dieses Thema wieder so ausgebreitet – ein Thema, über das sie ständig sprachen – aber nichts von Fritz Landshoff erzählt? Kein Wort darüber. Therese wurde misstrauisch. Hatten sie sich zufällig getroffen? Oder waren sie verabredet gewesen? Erika wusste doch, wie eifersüchtig sie auf den „brüderlichen Freund“ war, vor allem auf die Art und Weise, wie er Erika anschaute und auch auf ihre Reaktion darauf. Der junge Verleger Fritz Landshoff gehörte zu den Menschen – Männern und Frauen –, mit denen Erika hemmungslos flirtete. Die Liste derjenigen, die Thereses Eifersucht erregten, war lang. Den Anfang machte Pamela Wedekind. Wenn von der schönen, verflossenen Freundin die Rede war, verspürte Therese ein großes Unbehagen, das allmählich in Hilflosigkeit überging. Ein Gefühl, das sie nur selten verspürte und mit dem sie daher nur schwer umgehen konnte. Warum hatte Erika nicht erzählt, dass sie Fritz getroffen hatte. Warum tat sie ihr das an?
Aus Thereses Traurigkeit wurde langsam Wut: „Ich weiß gar nicht, warum dich Karl Valentins Verhalten so aufregt. Dein Vater hat doch auch viele Anregungen von deiner Mutter übernommen. Wenn die damals nicht in Davos gewesen wäre und ihre Kur gemacht hätte …“ Sie wusste, wie sie die Freundin treffen konnte. Es funktionierte: Erika reagierte prompt und heftig: „Lass meinen Vater da raus! Du weißt, das haben wir abgemacht.“
Auf ihren Vater, so despotisch und egozentrisch er sich auch verhalten mochte, ließ Erika nichts kommen. Auf ihren Bruder auch nicht. Pamela hatte ihr immer wieder vorgeworfen: „Klaus ist der einzige Mensch, den du wirklich liebst.“ Nachdem sie das die ersten Male mechanisch abgestritten hatte, schwieg sie später dazu. Vielleicht hatte Pamela ja recht.
Thereses Eifersucht richtete sich niemals auf Klaus, selbst wenn sie Grund dazu gehabt hätte, sondern auf längst vergangene Liebschaften: Pamela – ja, Erika war von ihr fasziniert gewesen, und umgekehrt: Pamela von Erika, aber ihre Liebe war nicht von Bestand gewesen.
Auf den Vorwurf der Lüge reagierte Erika so empfindlich, weil er sie seit ihrer Kindheit begleitet und gequält hatte. In der Schule, wenn sie erzählte, sie sei ohnmächtig geworden und deshalb zu spät gekommen, nahm man ihr das nicht ab. Also simulierte sie Ohnmachtsanfälle mitten im Unterricht. Sie spielte sie so perfekt, dass die Lehrer in großer Sorge um sie waren und ihr bedingungslos glaubten. Wenn sie zu Hause von Streichen wie diesen erzählte, hörten ihr alle gespannt zu. Die Eltern waren stolz auf ihre fantasievolle Tochter, die ihre Erlebnisse so bildreich auszuschmücken vermochte. Doch irgendwann einmal reagierte ihre Mutter ungehalten und warf ihr vor, es mit der Wahrheit nicht so genau zu nehmen. Dabei hatte sie gar nicht gelogen, nur ein wenig übertrieben. Dass ihr der Vater nicht beistand, traf sie am meisten.
Genau wie Klaus’ Reaktion während ihrer Radtour in den Dolomiten: Beim Bergabfahren mit hoher Geschwindigkeit hatte sie die Kontrolle über ihr Fahrrad verloren und war gestürzt. Klaus, der vorausfuhr, bemerkte erst nach einer Weile, dass die Schwester nicht mehr hinter ihm war. Er rief nach ihr, erhielt keine Antwort, kehrte um und fand sie neben ihrem Fahrrad im Gebüsch liegen. Seine ersten Worte waren: „Was soll das Theater?“ Vergeblich versuchte ihm Erika klarzumachen, dass sie nach ihrem Sturz für kurze Zeit bewusstlos gewesen war. Klaus wies nur ungläubig auf ihr völlig intaktes Fahrrad und murmelte ärgerlich: „Das ist typisch für dich, mitten in unserer besten Fahrt musst du wieder deine Schau abziehen.“ Wie konnte er sich so täuschen und sie für eine Lügnerin halten?
Und jetzt Therese. Ihre geliebte Therese: Ehrlichkeit, Gradlinigkeit bis zur Unhöflichkeit! Nein, charmant und liebenswürdig war sie nicht, aber gerade das war es ja, was Erika so liebte. Sie war so anders.
Alleinig von Anfang an
Ein Sonntagmorgen im März 1898. In der Münchner Herzog-Rudolf-Straße 34 herrschte schon in aller Frühe große Aufregung. Bei Gertrude Gift hatten die Wehen eingesetzt. Die kleine zierliche Frau erwartete ihr fünftes Kind. Bereits am Vortag war die Sabbatruhe immer wieder durch erste Anzeichen der bevorstehenden Geburt unterbrochen worden. Die ganze Familie hatte sich zu Hause versammelt: der Vater Salomon Gift, der sechzehnjährige Max, die fünfzehnjährige Jeanette, der vierzehnjährige Siegfried und die siebenjährige Irma. Alle waren gespannt auf den neuen Erdenbürger. Würde es ein Mädchen oder ein Junge sein? Vermutlich war die späte Schwangerschaft – Gertrude war schon fünfunddreißig Jahre alt – eher überraschend als erwünscht gewesen. Schließlich hatte sie bereits drei halbwüchsige Kinder und eins, das gerade in die Schule gekommen war. Und sie wusste, dass sie sich nicht so intensiv um ihr Jüngstes kümmern konnte, wie sie es gern getan hätte, weil ihr Mann sie dringend brauchte. Salomon Gift war dreizehn Jahre älter als sie und schwer herzkrank. Für die Familie war es selbstverständlich, auf seinen Gesundheitszustand Rücksicht zu nehmen und den Alltag dementsprechend zu gestalten. Doch Therese behauptete vom ersten Tag an unübersehbar ihren Platz – wie sie es später auf der Bühne tun würde: ein Schwergewicht in jeder Beziehung. Am 6. März um 7 Uhr 28 erblickte sie das Licht der Welt. Sie habe bei ihrer Geburt zehn Pfund gewogen und sich dementsprechend weiterentwickelt, lautete ihr rückblickender Kommentar. Ein erster Auftritt vor großem Publikum: Das Nesthäkchen wurde von den Eltern und der Geschwisterschar willkommen geheißen.
Am Ende des 19. Jahrhunderts, zwei Jahre vor der Wende zum 20. wurde also die Frau geboren, die als eine der größten Schauspielerinnen in die Theatergeschichte eingehen und Kultstatus genießen würde – vergleichbar mit Sarah Bernhardt und Eleonora Duse. Therese Giehse kam im selben Jahr auf die Welt wie der Dichter, der für sie eine künstlerische wie menschliche Offenbarung bedeuten sollte – genau wie umgekehrt sie für ihn, sodass er Bühnenfiguren für sie erfand und sie als die größte Schauspielerin Europas bezeichnete: Bertolt Brecht. Obwohl das zum Zeitpunkt ihrer Geburt noch keine Rolle spielte, verführt es doch dazu, diese Tatsache im Nachhinein als Omen zu betrachten.
Rückblickend beschreibt sich Therese Giehse nicht als fröhlich-unbekümmertes Kind, sondern als ernst, vernünftig, nachdenklich und „alleinig“. Allein unter Erwachsenen. Schließlich waren ihre Geschwister – bis auf Irma, die Jüngste – keine Kinder mehr. Sie waren ihr an Erfahrungen überlegen. Eine unumstößliche Tatsache, die Therese akzeptieren musste. Dennoch wollte sie sich auf keinen Fall bevormunden lassen, sondern entwickelte eine gewisse Sturheit, die später legendär werden sollte. Bewusst auf sich selbst gestellt, lernte sie schon sehr früh, ihre Umgebung, die Menschen und deren Verhalten genau zu betrachten, sich ihr eigenes Urteil zu bilden und diesem zu vertrauen. Das über ihren Vater lautete: „freundlich, aber überhaupt nicht weise“. Er war kein Patriarch, kein starker Vater, kein gefürchtetes Familienoberhaupt, wie sie es aus anderen jüdischen Familien kannte. Sie empfand ihn eher als schwach. Dazu hat sicherlich seine Krankheit beigetragen, die ihn zwang, sich zu schonen, viele seiner ursprünglichen Aufgaben und Kompetenzen zu delegieren und sich eher im Hintergrund zu halten.
Salomon Gift war Textilkaufmann, genau wie sein Vater Mendel Gift, und stammte aus Hainsfarth bei Oettingen im Landkreis Donau-Ries. Die Ahnenreihe der Familie Gift lässt sich bis Mitte des 18. Jahrhunderts zurückverfolgen. 1748 übersiedelte der Viehhändler Löw von Ichenhausen nach Hainsfarth. Er nannte sich wegen der Herkunft seiner Familie aus dem einstigen Stamm Levi in Israel „Löw Levi“. Der Familienname „Gift“ tauchte erst um 1813 in den Dokumenten auf. Das königlich bayerische Judenedikt vom selben Jahr beinhaltete nämlich neben einer Anzahl von Genehmigungen – wie zum Beispiel, öffentliche Schulen zu besuchen, Grundbesitz zu erwerben, Unternehmen zu gründen, Schulen und Synagogen zu bauen, Friedhöfe anzulegen – die Forderung, einen Familiennamen anzunehmen, was bis dahin lediglich bei einer Minderheit der Fall war.
Therese Giehses Urgroßvater Jakob Löw, einer der Söhne Löw Levis, nahm also 1813 den Namen Gift an. Er war Viehhändler wie sein Vater und hatte fünf Kinder. Die Familie lebte in großer Armut, der seine Söhne zu entkommen suchten. Im Beruf ihres Vaters sahen sie keine Perspektive. Statt wie er Pferde und Rinder zu verkaufen, wandten sie sich dem Textilhandel zu, den sie für weitaus Erfolg versprechender hielten, und wurden Tuch- und Schnittwarenhändler. Drei der Gift’schen Söhne boten auf der Ingolstädter Dult hochwertige Tuch- und Modewaren an: „Tibets, Ginghams, Napolitains, Shirtings und Buckskins“. Mendel Gift formulierte sein Angebot wie folgt: „Unter Zusicherung der reellsten Bedienung, schmeichelt sich mit zahlreichem Besuch beehrt zu werden, und hegt die Überzeugung, dass jedermann sein Warenlager befriedigt verlassen wird – M. Gift“. Er ging 1863 nach München, wo er jedoch schon fünf Jahre später starb. Sein Sohn Salomon, Therese Giehses Vater, betrieb ab 1879 mit seinen Geschäftspartnern Abraham Holzer und Alois Eisenreich einen Posamentier- und Seidenwarenhandel en gros.
Doch es gab innerhalb der Familie Gift nicht nur Kaufleute, sondern – neben Therese – einen weiteren Künstler, der allerdings heute so gut wie vergessen ist, obwohl er fast zwanzig Jahre am Münchner Nationaltheater engagiert war: den Opernsänger Emil Grifft. Sein Großvater David Gift war ein Bruder von Therese Giehses Großvater Mendel Gift. Emil Gift wurde 1879 in Ingolstadt geboren. Auch er wusste, dass der Name Gift nicht gerade eine Empfehlung bedeutete, sodass ein Künstlername notwendig war. Er wählte den Namen Grifft.
Mitte der 1920er-Jahre, als Therese Giehse an den Münchner Kammerspielen erste Erfolge feierte, war Emil Grifft bereits ein populärer Opernsänger am Münchner Nationaltheater. Begonnen hatte er seine Karriere 1903 als Dirigent des Stadtorchesters in Mainz. Über Berlin, Kiel und Breslau gelangte er 1917 nach München, wo er siebzehn Jahre lang an der Oper engagiert war. Das Repertoire des Bassbaritons umfasste siebzig Rollen. Obwohl er 1919 zum Katholizismus konvertiert war, wurde ihm seine jüdische Herkunft zum Verhängnis: 1933 erhielt er Berufsverbot, verlor seine Existenzgrundlage und seinen Lebensinhalt. 1941 beging er Selbstmord.
Thereses Vater, Salomon Gift, der Textilkaufmann für „Stoffe, Tücher, Seiden, Posamentierwaren en gros“ heiratete 1879 im Alter von dreißig Jahren die siebzehnjährige Gertrude Hainemann, die in Amerika aufgewachsen war. Dass der Name ihres Mannes im Englischen etwas völlig anderes als im Deutschen, nämlich Geschenk, bedeutet, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Ihre Eltern besaßen eine Farbenfabrik in New York. Gertrude kam dort 1862 zur Welt. Erst 1867, also fünf Jahre später, heirateten die Eltern. Gertrude war also eine Zeit lang ein uneheliches Kind, wie Therese Giehses Notizen zu Familienfotos belegen. Die Hainemanns kehrten mit ihrer Tochter zurück nach Europa, wo sie einen ruhigen Lebensabend verbringen wollten. Das war bei den in Amerika lebenden Juden damals durchaus üblich. Sie wollten der Hektik des American Way of Life entfliehen und verbanden mit einem Leben in Europa Beständigkeit und Entspannung. Therese hat ihre Großeltern nicht mehr kennengelernt. Als sie geboren wurde, waren sie längst verstorben. Einen engeren Bezug zu Amerika hat sie nicht verspürt und sich dort später – nach ihrer Emigration – nie wohlgefühlt. Ihr Aufenthalt mit dem Kabarett „Pfeffermühle“ geriet zu einem kurzen Intermezzo. Die mütterlichen amerikanischen Wurzeln hatten weder hilfreiche Vorbereitung bedeutet noch stärkende Wirkung gehabt oder irgendeine Form von Nähe zu dem fremden Kontinent erzeugt.
Therese wuchs in ihrem konservativen jüdischen Elternhaus sehr frei auf – so nebenbei, ohne Kontrolle, Autorität, Bevormundung. Der Nachkömmling war früh selbstständig und auf sich gestellt, im Schatten der älteren Geschwister – ein „alleiniger“ junger Mensch, der genau davon profitierte, weil er sich ungestört entwickeln konnte. Die Familie Gift lebte in einer großen Wohnung in der Herzog-Rudolf-Straße, gegenüber der Synagoge des orthodoxen Ritus, „Ohel Jakob – das Zelt Jakobs“. Oft stand Therese am Fenster, schaute dem Treiben auf der Straße zu und machte sich ihre Gedanken. Sie war neugierig, erfand ihre eigene Welt und gestaltete ihre Umgebung fantasievoll als Schauplatz für die Spiele, in die sie manchmal so tief eintauchte, dass sie darüber alles andere vergaß.
Irma musste oft drei-, viermal nach der kleinen Schwester rufen, ohne dass diese antwortete. Sie betrat das Wohnzimmer, das so ganz anders aussah als sonst. Drei der gepolsterten Stühle waren hintereinandergestellt, die Stuhlbeine links und rechts bildeten exakte Linien. Daneben waren zwei der voluminösen Sessel platziert, ebenfalls hintereinander. Wie hatte Therese die beiden wuchtigen Sitzgelegenheiten vom Fleck bewegen können? Und wozu diente überhaupt diese Umgestaltung des Wohnzimmers? „Theres!“ Wieder keine Antwort. Aber sie musste doch irgendwo in der Nähe sein. Dann entdeckte Irma den Stoffteddy und den Plüschhund auf den Stühlen: den Hund auf dem hinteren, den Teddy auf dem vorderen, entschlossen mit seinen glänzenden Glasaugen geradeaus blickend. Eine Kutsche?, fragte sich Irma und verließ den Salon.
Im Flur entdeckte sie ihre kleine Schwester. Therese stand am Fenster. Sie trug ein Matrosenkleid, in dem sie sich sichtlich unwohl fühlte. Die schönen roten Haare wurden mit einem Samtband zusammengehalten. Oben auf dem Kopf thronte – wie immer etwas schief – eine Schleife. Therese musste gehört haben, dass Irma ihren Namen rief, reagierte aber nicht einmal, als sich die Schwester mit den Worten „Was gibt es denn da zu sehen?“ neben sie stellte. Die Antwort gab sich Irma selbst: „Ach ja, deine schwarzen Männer.“ Wie so oft staunte die kleine Schwester über die schwarz gekleideten Männer mit strenger Miene, die im Haus gegenüber, der Synagoge, ein und aus gingen. Therese nickte und lächelte verschmitzt. „Irgendwie sind sie mir unheimlich“, gestand Irma. „Mir nicht“, konterte Therese sofort. „Mir gefallen sie. Sie sind so ernst und feierlich. Aber warum sind es nur Männer? Wo sind die Frauen?“ Irma wusste keine Antwort und schob die Schwester vom Fenster weg zurück in den Salon.
„Was tippst du, wer gewinnt das Rennen, die Kutsche oder die Droschke?“ Therese deutete auf die beiden Ensembles aus Stühlen und Sesseln. „Womit möchtest du fahren?“ Irma zögerte, entschied dann: „Mit der Kutsche“ und schlug vor: „Lass doch eine von deinen Puppen mitfahren. Die neue, die du zum Geburtstag bekommen hast, trägt so ein schickes Reisekostüm. Wie heißt sie doch gleich?“ Therese schien nicht daran interessiert, sondern wies Irma schweigend den Platz auf dem vorderen Sessel zu, ging zu den Stühlen und nahm ebenfalls ganz vorn Platz, den Teddy auf ihrem Schoß. Das Rennen konnte beginnen.
Manchmal durfte Therese ihre Mutter beim Einkaufen begleiten, was sie sehr gerne tat. Die Mutter erklärte ihr, worauf man achten musste, wenn man Lebensmittel auswählte, und sie prägte es sich gut ein. Es gefiel ihr, wenn ihr die Mutter die Entscheidung überließ und sie fragte: „Welches Brot sollen wir nehmen? Welche Marmelade magst du am liebsten?“ Damit zeigte die Mutter ihrer Jüngsten, dass sie ernst genommen wurde und dass nicht nur die Meinung der Erwachsenen und der älteren Geschwister zählte.
Als einen ausgesprochenen Höhepunkt empfand sie ihren ersten Oktoberfestbesuch, den sie ihrem großen Bruder Max verdankte. Er schwärmte ihr von der Wiesn vor, lud sie ein, und nicht nur das: Er verführte die Halbwüchsige zu ihrem ersten Bier in einem der riesigen Bräusäle. Der Funke sprang sofort über: Von diesem Zeitpunkt an liebte Therese das berühmte bayerische Volksfest, traf sich dort jedes Jahr mit Freundinnen und Freunden und war unglücklich, wenn sie einmal nicht dabei sein konnte, weil ein Engagement außerhalb von München sie daran hinderte. Mit ihrer späteren Freundin Erika Mann teilte sie die Leidenschaft für die Wiesn. Diese hat das, was das Volksfest für die Münchner und für die Welt bedeutete, 1929 in einer Glosse dargestellt, die mit dem Satz beginnt: „Bei uns in München ist große Zeit.“ Die größte Festwiese der Welt sei herrlich anzuschauen, schwärmt sie, und die Einwohner dieser Stadt, die gemacht sei für Feste, jubelten und scheuten sich nicht, all ihr Erspartes auszugeben. „Diese sparen aufs Oktoberfest, wie andere auf die Sommerreise.“ Erst beim Feiern zeige München sein wahres Gesicht, tue es mit ganzer Seele, ohne in diesen Tagen überhaupt nur einen Gedanken ans Arbeiten zu verschwenden. Der „Wiesenmagen“ sei die bekannte und populäre saisonale Krankheit, die viele Münchner befalle. Sie gehe auf das zurück, was während eines Oktoberfestbesuchs durcheinandergegessen, getrunken, gefahren und gerutscht wird.
Erikas Lieblingsort auf der Wiesn ist der Bräusaal der Augustiner, in dem man sich niederlässt, um eine Riesenmaß Augustiner Edelstoff zu trinken, Rettich, Wurst, Huhn und „kollossale Brezeln“ zu essen. Ein Foto zeigt sie dabei mit Liesl Karlstadt und deren Schwester Amalie: drei Frauen in ausgelassener Stimmung, die Maßkrüge zum Prost erhoben – fehlte nur noch Therese, die Freundschaft zu allen dreien pflegte und meistens dabei war.
Die Verfasserin der Glosse wäre jedoch nicht Erika Mann, wenn sie nicht auch das Abseitige des berühmten Volksfests anführen und sich über die „Psychologie des Vergnügens“ wundern würde: „Instrumente gibt es auf diesem Oktoberfest, Vorrichtungen, von denen ich sicher weiß, dass sie im Grunde Marterwerkzeuge sind und aus dem frühen Mittelalter stammen.“ Dazu zählen die „lustigen Tonnen“, die die Besucher freiwillig besteigen und in denen sie sich herumrollen lassen. „Du siehst Damenbeine, verrutschte Blusen und die unverhohlenste Verzweiflung.“ Doch um zehn Uhr wird dem wilden Treiben Einhalt geboten: Das Fest ist zu Ende, „Kinder und Volk gehören um zehn ins Bett“.
Weihnachten, das Fest, das für die Familie Mann zu allen Zeiten und an allen Orten einen Höhepunkt des Jahres bildete, wurde in der jüdischen Familie Gift nicht gefeiert. Ihr Personal wurde allerdings in der guten Stube reich beschenkt. Staunend beobachtete Therese, wie die in Glanzpapier verpackten Gaben verteilt wurden. Therese wurde nicht orthodox, doch im jüdischen Glauben erzogen. Später wird sie sagen, dass sie bereits mit sechzehn aus der jüdischen Glaubensgemeinschaft ausgetreten sei, weil sie deren Defizite früh erkannt habe. Ihr fehlte der Gedanke von Gnade und Vergebung. Was mag sie sonst vermisst haben? Einen angemessenen Platz für Frauen und Mädchen? Darüber schweigt sie sich aus.
Als sie die Bergpredigt kennenlernte, habe sie diese einfach in ihren persönlichen Glauben integriert. Sätze aus dem Matthäusevangelium wie „Wenn du aber betest, so gehe in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist; und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir’s öffentlich vergelten“ entsprachen ihrer Erfahrung als „alleiniger Mensch“. Sie trug ihren individuellen Glauben nicht laut vor sich her, fühlte sich nicht zum unbedingten Gehorsam verpflichtet, sondern entwickelte eigene Maßstäbe, einen eigenen Verhaltenskodex, der sie weitgehend unbeeinflussbar und gänzlich unkorrumpierbar machte. Trotz aller Kritik bekannte sie sich rückblickend grundsätzlich zum Judentum. Im Alter von siebenundsechzig Jahren antwortete sie in einem Interview auf die Frage nach dem Geheimnis ihrer Kunst, für diese sei das Bayerische, doch vor allem das Jüdische, „die große Stärke des Judentums“, prägend gewesen.
Im Alter von sechs Jahren, 1904, wird Therese in der Volksschule am St.-Anna-Platz im Münchner Lehel eingeschult. Über ihren ersten Schultag befand sie: „Ganz hübsch, aber so zeitraubend.“ Dabei sollte es bleiben. Der Lernstoff interessierte sie nicht. Das, was sie selbst gerade beschäftigte und bedrängte, kam im Unterricht nicht vor, zum Beispiel, warum sich Menschen so unberechenbar verhielten, wie sie es gerade am eigenen Leibe erfuhr. Von den Mitschülerinnen und Mitschülern, mit denen sie sich anfangs gut verstanden hatte, wurde sie auf einmal geschnitten – als Außenseiterin gemobbt, wie man es heute nennen würde. Grundlos, ohne dass sie selbst ihr Verhalten geändert oder in irgendeiner Weise dazu beigetragen hätte. Sie war ratlos, fühlte sich hilf- und schutzlos, ohne die geringste Ahnung, warum sie abgelehnt, gemieden, diskriminiert und bedroht wurde. Dass sie nicht verstand, warum all das geschah, empfand sie als besonders schlimm. Sie wusste nicht, mit wem sie darüber reden sollte. Zu Hause verschwieg sie ihre Sorgen. Wen hätte sie auch fragen sollen? Die Geschwister waren mit sich selbst und ihren eigenen Problemen beschäftigt. Der Mutter wollte sie nicht zusätzlichen Kummer bereiten, war diese doch durch die Krankheit des Vaters mehr als genug beansprucht.
Judden, Judden
Der kurze Schulweg von der elterlichen Wohnung in der Herzog-Rudolf-Straße zur Volksschule am St.-Anna-Platz geriet für Therese immer mehr zum täglichen Spießrutenlauf zwischen zwei gegensätzlichen Welten. Wenn sie morgens aus dem Haus trat, fiel ihr erster Blick auf die gegenüberliegende Synagoge. Nach etwas mehr als fünf Minuten am Ziel angelangt, wurde sie gleich von zwei katholischen Monumenten empfangen: der St.-Anna-Klosterkirche und der gewaltigen St.-Anna-Pfarrkirche, neben der sich ihre Schule befand. Zwischen den Stationen Wohnung und Schule lagen unerfreuliche Zusammenstöße mit Mitschülern, die sie jeden Tag aufs Neue fürchtete: Die Kinder hänselten und drangsalierten sie, riefen ihr „Judden, Judden“ nach, rissen an ihren langen, roten Zöpfen. Täglich galt es, diesen Parcours der Niedertracht zu überwinden. Brutal wurde sie mit einer anderen Welt konfrontiert als der, die sie bis zu diesem Zeitpunkt kannte. Sie lernte die Bösartigkeit kennen, die in vielen Menschen versteckt schlummerte und nun unverhohlen zum Ausbruch kam. Sie erfuhr, dass es nicht alle gut mit ihr meinten – wie sie es von zu Hause gewöhnt war. Allen voran der katholische Religionslehrer, der weit davon entfernt war, ihre Partei zu ergreifen oder sie gar zu schützen, sondern – im Gegenteil – seinen Schülern sogar noch die Begründung für ihr Verhalten lieferte und es dadurch legitimierte, sodass Therese das Fazit zog: „Ich war dick und rothaarig und hatt’ den Herrn Jesu umgebracht.“
Da scheint es nur folgerichtig, dass sie eine gewisse Distanz zu den Menschen in ihrer Umgebung aufbaute. Das blinde Vertrauen, das in ihrem Elternhaus herrschte, wurde von Vorsicht und Skepsis abgelöst. Eine Weile überwog sogar die Angst, sodass sie durch keinen Raum gehen mochte, „wenn Leut drin waren“. Die Menschen waren für sie unberechenbar geworden. Es war ihr unangenehm, beobachtet zu werden. Die abschätzenden Blicke ihrer Mitschüler verletzten sie. Damals wusste sie noch nicht, dass es einmal einen Raum geben würde, den sie souverän beschreiten würde, bewundert von einer großen Menschenmenge, die ihr zuschaute. Und dass sie es genießen würde, wenn sich einige Hundert Augenpaare auf sie richten würden. Dabei halfen ihr die strikten Trennungen Bühne – Zuschauerraum, Schauspieler – Publikum. Auf der Bühne fühlte sie sich gut aufgehoben und sicher, von den Zuschauern beschützt und in ihrer Mitte geborgen.
Ihre negativen Erfahrungen ließen sie beim Vorsprechen am Theater souverän auftreten. Sie wusste, was es hieß, kritisch betrachtet zu werden. Doch nun waren die Positionen, Rollen, Aufgaben klar definiert. Außerdem hatte sie sich selbst in diese Situation begeben. Sie wurde nicht vorgeführt – wie als Kind in der Schule –, sondern sie selbst führte etwas vor. Sie übernahm den aktiven Part. Das kleine, verzweifelte Mädchen, das sich die Ohren zuhielt, um das „Judden“-Geschrei nicht hören zu müssen, hatte den Spieß umgedreht und war von der Erleidenden zur Agierenden geworden.
In seinem Buch Kind dieser Zeit schildert Klaus Mann den in seiner Kindheit üblichen alltäglichen Antisemitismus – allerdings nicht als Erleidender, sondern als Zufügender: „Die Juden entbieten“ zählte zu den beliebten Spielen der Herzogparkbande, deren Anführer seine Schwester Erika und er waren. Dafür kletterten sie in der Dämmerung, wenn es endlich dunkel genug war, an der Fassade einer Herzogpark-Villa empor, deren Bewohner ihre jüdischen Wurzeln gern verschwiegen. Sie klopften mit ihren Fäusten ans Fenster des Esszimmers, konnten zwar nicht hineinsehen, da die Vorhänge zugezogen waren, wussten aber, dass die Familie beim Abendessen saß. Dann schrien sie mit „grässlich rauen Stimmen“: „Judden! Judden!“ Sie fanden es reizvoll, das Wort auf diese eigenartige Weise zu betonen, wie es auch Therese Giehse erlebt hatte. Erstaunlicherweise gibt Klaus Mann an keiner Stelle zu bedenken, dass zu den „Herrschaften“ des Bogenhausener Villenviertels, „die zwar ein wenig semitisches Blut hatten, aber nicht gern viel davon hergemacht sahen“, auch seine Familie zählte. Die eigenen jüdischen Wurzeln kommen in seinen Erinnerungen nicht vor. Anscheinend ist es weder ihm noch Erika überhaupt in den Sinn gekommen, dass sie selbst jüdische Vorfahren hatten. Klaus Mann – und das ist erstaunlich – nicht einmal im Nachhinein beim Schildern dieser Begebenheiten. Erika Mann, deren politische Texte durchaus in der Tradition des jüdischen Journalismus standen, erwähnt dies an keiner Stelle. Dabei war das Judentum in ihrer künstlerischen und publizistischen Arbeit ein ständig wiederkehrendes Thema: in ihrem Kabarett „Die Pfeffermühle“ genauso wie in ihrer Berichterstattung vom Nürnberger Kriegsverbrecherprozess. Sie beruft sich jedoch niemals auf ihre jüdische Urgroßmutter, die feministische Essayistin Hedwig Dohm, sondern immer nur auf ihren Vater, wenn es um das Schreiben geht.
Mitglieder der Pfeffermühle, allen voran Initiator Magnus Henning, betonten später, dass das Ensemble fast rein jüdisch gewesen sei, was sich deutlich in den Programmnummern niedergeschlagen habe. Eindrucksvolle Beispiele für die Art und Weise, wie das Kabarett mit Antisemitismus umging, bildeten die Nummern „Die Schönheitskönigin“ und besonders „Die Hexe“, mit der Therese Giehse brillierte:
Wie ich hier steh in Blus und Rock, –
War ich der Menschheit Sündenbock
Durch viele Hundert Jahre.
Mich kriegt im Grund sie niemals satt,
Weil sie mich dringend nötig hat,
Das ist das Sonderbare.
Mit Euch zu plaudern kam ich her,
ich gute Hexe Gruselsehr,
Und etwas auszurasten.
Ein wahres Glück, dass heutzutag,
Von einem Teil der Schimpf und Plag,
Die Juden mich entlasten.
In ihrem Buch Erika Mann. Eine jüdische Tochter führt die Publizisitin Viola Roggenkamp Erikas Verschweigen des Judentums, das bis zur Verleugnung reicht, auf ihre Mutter Katia Mann zurück. Deren jüngste Tochter Elisabeth berichtet, ihre Mutter habe nicht nur die Auskunft darüber verweigert, sondern sei „immer vollkommen rasend“ geworden, wenn ihre Kinder danach fragten. Sie habe es kategorisch als „Unsinn“ zurückgewiesen, wenn man sie als jüdisch bezeichnete und signalisiert, dass für sie damit das Thema erledigt war. Weitaus kritischer und weitsichtiger zeigte sich ihre Großmutter Hedwig Dohm, die Parallelen zwischen dem Judenhass und dem Frauenhass in den Schriften gelehrter Männer der „christlich-europäischen Gesellschaft“ aufdeckte: Der Mann fühle sich der Frau überlegen wie der Arier dem Juden.
Katia Mann, geborene Pringsheim, gehörte zu der Generation deutscher Juden, die sich primär als Deutsche fühlten, sogar antisemitische Auffassungen teilten und sich selbst von deren Zuschreibungen nicht angesprochen fühlten. Sie fühlte sich nicht bedroht. Juden – das waren in ihren Augen ganz andere Leute, zum Beispiel Therese Giehse, die eines Tages von Erika mit nach Hause gebracht wurde. Katia Mann bezeichnete die Freundin ihrer Tochter in ihren „ungeschriebenen Memoiren“ als „rein jüdisch“.
1908 wechselte Therese nach vier Jahren Volksschule am St.-Anna-Platz ins angesehene höhere Bildungsinstitut für Mädchen, die Kerschensteiner Schule in Schwabing in der Franz-Joseph-Straße. Laut Selbstaussage war sie eine schlechte Schülerin. Der Unterricht langweilte sie nach wie vor, und ihr Außenseitertum belastete sie. 1911 starb der Vater. Da war sie dreizehn Jahre alt. Obwohl sein Tod nicht überraschend eintrat – durch die lange Krankheit war die Familie darauf vorbereitet –, bedeutete er einen tiefen Einschnitt. Nun musste die Mutter das Geschäft allein weiterführen, unterstützt von ihrem ältesten Sohn Max.
Obwohl Therese ganz andere Interessen hatte als die Fächer, die in der Schule gelehrt wurden, wusste sie um die Notwendigkeit von Bildung für ihr weiteres Leben. Daher war sie sehr darauf bedacht, nicht sitzen zu bleiben, und arbeitete gerade so viel, dass sie das Klassenziel erreichte und versetzt wurde. In den Gesprächen mit der Journalistin Monika Sperr, die unter dem Titel Ich hab nichts zum Sagen erschienen, charakterisierte sie sich rückblickend als „stinkfaul“ und gleichgültig gegenüber dem Lehrstoff. Wie sollte ein Thema wie „Brief an eine Freundin über die Oberflächenbeschaffenheit der oberbayerischen Tiefebenen“ auch ihr Interesse wecken? So schnell wie möglich wollte sie die Schule abschließen. 1914 war es dann so weit. Endlich fühlte sie sich frei.
Die kühne und herrliche Tochter
In der Franz-Joseph-Straße, in der sich die Kerschensteiner Schule befand, die Therese Giehse von 1908 bis 1914 besuchte, lebte damals die Familie Mann mit ihren beiden Kindern Erika und Klaus. Erika Mann wurde am 9. November 1905 geboren. Im selben Jahr, am 11. Februar, hatten ihre Eltern, Thomas Mann und Katia Pringsheim, geheiratet. Thomas Mann war neunundzwanzig, Katia einundzwanzig Jahre alt. Gleich nach der Hochzeit war das junge Ehepaar in eine große Siebenzimmerwohnung in der Franz-Joseph-Str. 2 gezogen.
1905 war also besonders für Katia ein aufregendes Jahr: Aus der verwöhnten einzigen Tochter, die inmitten von Brüdern in einer sehr begüterten Familie aufwuchs, war innerhalb eines Jahres eine Ehefrau und Mutter geworden. Letzteres gegen den Rat ihrer Ärzte, die ihr aus gesundheitlichen Gründen empfohlen hatten, nicht zu früh Kinder zu bekommen. Die Heirat bedeutete für Katia keinesfalls, dass sie den Tochterstatus ablegte: Sie blieb auch als Frau Mann die Tochter Pringsheim, der jeder Wunsch erfüllt wurde. Katia war doppelt abgesichert: Der Ehemann war ein erfolgreicher, gut verdienender Schriftsteller. Und wenn es einmal knapp wurde, standen die Eltern parat.
Die Eltern, das waren der Mathematikprofessor und Ordinarius an der Ludwig-Maximilians-Universität, Alfred Pringsheim und seine Frau Hedwig, geborene Dohm. Alfred Pringsheim stammte aus einem äußerst vermögenden Elternhaus, das es ihm unter anderem ermöglichte, für seine Familie ein prächtiges Renaissance-Palais in der Arcisstraße zu errichten. Hedwig, eine gebürtige Berlinerin, war die älteste Tochter der bekannten Feministin Hedwig Dohm. Sie hatte eine Zeit lang der berühmten Theatergruppe „Die Meininger“ angehört.
Gleich in den ersten Ehejahren wurden drei Söhne geboren, 1883 kam überraschend ein Zwillingspaar zur Welt, Klaus und Katharina, genannt Katia. Sie wurden 1885 protestantisch getauft. Allerdings legte der Vater seinen jüdischen Glauben offiziell nie ab und ließ sich auch nicht taufen, um seine Karriere zu sichern, als es ihm nahegelegt wurde. Nicht weil er so tief im Glauben verhaftet war, sondern weil es ihm sein Stolz verbot. Er wollte sich von niemandem vorschreiben lassen, was er zu tun hatte.
Im Gegensatz zu seiner späteren Frau betrachtete Thomas Mann deren Familie und folglich auch sie selbst durchaus als jüdisch: eine reiche, einflussreiche jüdische Familie in München, deren Salon die Eintrittskarte in die gehobene Kulturszene bedeutete. Katia hatte anscheinend gezögert, den Heiratsantrag anzunehmen, wie aus Thomas Manns Worten hervorgeht, er habe kaum Hoffnung, dass dieses „fremdartige, gütige und doch egoistische, willenlos höfliche kleine Judenmädchen“ das „Ja“ über ihre Lippen bringen würde. Doch da täuschte er sich.
Zum ersten Mal gesehen hatte er sie schon viele Jahre zuvor in Lübeck, als er noch zur Schule ging. In einer Zeitung war das Gemälde Kaulbachs, das die fünf Pringsheim-Kinder in Pierrot-Kostümen zeigte, abgebildet. Es hatte ihm so gut gefallen, dass er es aufhob.
Nur ein Jahr vor dem Schicksalsjahr 1905 hatte der aus Lübeck stammende Thomas Mann die Villa der Pringsheims in der Arcisstraße 12 zum ersten Mal betreten. In der Literaturszene war er kein Unbekannter mehr. Bereits als Sechsundzwanzigjähriger hatte er sich mit dem 1901 veröffentlichten Roman Buddenbrooks einen Namen als Schriftsteller gemacht. Darin hatte er seine Familiengeschichte und das sie umgebende Beziehungsgeflecht dergestalt verarbeitet, dass er sich die Feindschaft seiner Heimatstadt zuzog.
Thomas Mann wurde 1875 geboren. Sein Vater, Thomas Johann Heinrich, Kaufmann und Senator für Wirtschaft und Finanzen, hatte den Familienbetrieb heruntergewirtschaftet, was allerdings erst nach seinem Tod – er starb 1891 sehr plötzlich – bekannt wurde. Die Mutter Julia war eine geborene da Silva-Bruhns, ihre Mutter stammte aus Brasilien. Nach dem Tod ihres Gatten zog Julia Mann mit ihren jüngeren Kindern – Julia, Carla und Viktor – 1893 nach München. Die beiden älteren Söhne, Thomas und Heinrich, folgten später.
München übte am Ende des 19. Jahrhunderts eine enorme Anziehungskraft auf Künstler aus. Gefördert durch das großzügige Mäzenatentum des Prinzregenten Luitpold, genoss die Kunst hohes Ansehen in der Stadt. Das politische Klima galt als vergleichsweise liberal, kritische Zeitungen siedelten sich an, allen voran die Jugend. Diese, 1896 von Georg Hirth gegründete „Münchner illustrierte Wochenschrift für Kunst und Leben“, die ursprünglich „Leben“ heißen sollte, wurde schon bald zum wichtigsten Sprachrohr der vielfältigen Münchner Kunst- und Literaturszene. Sie war Teil und Namensgeberin einer Bewegung, die ganz Europa erfasst hatte: Art nouveau in Frankreich, Modern Style in England, Sezession in Österreich und Jugenstil in Deutschland. Die Jugend enthielt nicht nur kritisch-satirische Artikel, die mit der Obrigkeit, allen voran Kaiser Wilhelm II., hart ins Gericht gingen, Althergebrachtes und die „Vergreisung“ der Gesellschaft ablehnten. Auf den Titelbildern wurden Frauen auf ganz neue Art und Weise präsentiert, zum Beispiel als wilde reitende Amazonen oder elegante Golfspielerinnen, die gerade zum Schlag ausholen.
Einer der einflussreichsten Philosophen dieser Epoche war Friedrich Nietzsche. Seine „Umwertung aller Werte“ betraf auch die Abkehr vom Alter als Inbegriff von Erfahrung und Reife hin zur Jugend. Vom „Leben“ sprach man in der Aufbruchstimmung der Jahrhundertwende emphatisch und mit viel Pathos. Die Bewegung bildete einen Gegenpol zur Religion: Der Blick sollte auf das Diesseits gerichtet, die Jenseitsvertröstung aufgehoben werden. Was zählte, war die unmittelbare Gegenwart, der Augenblick. „Ich weiß, ich werde nicht sehr lange leben. Aber ist das denn traurig? Ist ein Fest schöner, weil es länger ist? Und mein Leben ist ein Fest, ein kurzes, intensives Fest“, notierte die Malerin Paula Modersohn-Becker am 26. Juli 1900 in ihrem Tagebuch. Es war das Lebensgefühl einer ganzen Generation!
Überschwänglich feierte die Schwabinger Boheme das Leben: Der Dichter Karl Wolfskehl schrieb über München, sie sei neben Paris die einzige Geisteshauptstadt „mit nach allen Seiten offenen Toren, alles aufnehmend, allverstehend und allbildend“. Dem schloss sich Thomas Mann in seiner Novelle „Gladius Dei“ an, deren erster Satz den berühmten Ausspruch enthält: „München leuchtete!“
Zur Jugend gesellte sich der Simplicissimus, die von Albert Langen und Thomas Theodor Heine gegründete satirische Wochenzeitschrift. Die erste Ausgabe erschien am 4. April 1896. Die künstlerische Gestaltung lag bei Olaf Gulbransson und Thomas Theodor Heine, der auch das Wappentier entwarf: eine zähnefletschende rote Bulldogge auf schwarzem Grund. Beiträger und Mitarbeiter waren neben Thomas und Heinrich Mann unter anderem Frank Wedekind, Rainer Maria Rilke, Max Halbe, Ludwig Thoma, George Grosz, Heinrich Zille und Hugo von Hofmannsthal. Der „Simplicissimus“ stellte die herrschende Ordnung infrage und attackierte die bürgerliche Moral, die wilhelminische Politik, die Kirche, das Militär, die Beamten. Des Öfteren wurden ganze Ausgaben konfisziert, das Blatt war in Österreich-Ungarn verboten, Albert Langen, Thomas Theodor Heine und Frank Wedekind wurden der Majestätsbeleidigung angeklagt und saßen zeitweise im Gefängnis. Und noch eine weitere wichtige Zeitungsgründung erfolgte 1899 in München: Rudolf Alexander Schröder, Alfred Walter Heymel und Otto Julius Bierbaum riefen Die Insel ins Leben, aus der später der Insel Verlag hervorging. Der ehrgeizige Schriftsteller Thomas Mann war also in mehrfacher Beziehung am richtigen Platz und manifestierte das noch mit seiner Heirat.
Trotz frauenbewegter Großmutter war für Katia die weibliche Unterordnung unter den Willen ihres Mannes selbstverständlich. Und auch dass ein Sohn mehr gilt als eine Tochter. Daher war die Enttäuschung groß, als ihr erstes Kind ein Mädchen ist. „Ich war immer verärgert, wenn ich ein Mädchen bekam, warum, weiß ich nicht“, gesteht sie unumwunden in ihren „ungeschriebenen Memoiren“. Ihre Erstgeborene nannte sie nach ihrem Lieblingsbruder Erik.
Thomas Mann schrieb seinem Bruder Heinrich im November 1905 ohne Umschweife, wie enttäuscht er sei, eine Tochter bekommen zu haben. Ein Sohn sei für ihn „poesievoller, mehr als Fortsetzung und Wiederbeginn meiner selbst“. Die Großmutter seiner Frau, Hedwig Dohm, reagiert auf seine Klagen mit den Worten, er sei ein „verdammter alter Anti-Feminist“. Damals wusste noch niemand, dass die unerwünschte Tochter einmal sein „kühnes und herrliches“ Lieblingskind werden würde.
Doch zunächst bestimmte die Bevorzugung des männlichen Geschlechts weiterhin das Frauenbild der Familie Mann. Rückblickend berichtete die jüngste Tochter Elisabeth dem Filmregisseur Heinrich Breloer bei den Dreharbeiten zu seinem Film über „Die Manns“, sie habe von jeher gewusst, dass sie als Frau im Musikbetrieb niemals Erfolg haben, also nie eine große Konzertpianistin werden würde, sondern dass es nur für den Hausgebrauch reichte. Die Eltern hätten ihr und ihren Geschwistern nicht bloß beigebracht, dass es Mädchen in der Kunst nie so weit bringen würden wie Jungen, es sei für sie selbstverständlich gewesen. Gerade das habe sich fest in ihr eingeschrieben.
Ein Jahr nachdem Erika das Licht der Welt erblickt hatte, folgte endlich der ersehnte Sohn: Am 18. November 1906 wurde Klaus geboren. Erika und Klaus waren nahezu von Anfang an unzertrennlich, bezeichneten sich zeitweise sogar als Zwillinge. Dabei waren sie grundverschieden und die Geschlechtsrollen sofort vertauscht. Auf diese Weise ergänzten sie sich hervorragend. Was die oder der eine nicht hatte oder konnte, übernahm der oder die andere. Erika war mutig, sportlich, rauflustig, extrovertiert, während Klaus ängstlich und zurückhaltend agierte. Sie habe ausgesehen wie ein „magerer, dunkel hübscher Zigeunerjunge“, berichtete Klaus Mann und ergänzte bewundernd, „sie konnte wie zwei Buben turnen und raufen“. Scheinbar hatte Katia dieser Tatsache früh Rechnung getragen, indem sie Erika in einen blauen und Klaus in einen roten Leinenkittel steckte, also die klassische geschlechtsspezifische Farbzuordnung vertauschte. Sie hatte diese bestickten Kleidungsstücke in den Münchener Werkstätten erworben. Erika berichtet rückblickend, sie habe den kleinen Bruder immer als selbstverständliche und notwendige Ergänzung zu sich selbst gesehen. Gleich nachdem sie sich an ihr Zwillingsdasein gewöhnt hatte, entwickelte sie die Überzeugung, jedes Mädchen brauche einen Bruder. Einen „Eissi“ – so der von ihr erfundene Spitzname für den Bruder Klaus – müsse man doch haben. Als sie einmal mit Klaus ein gleichaltriges Mädchen traf, das allein, nur in Begleitung der Kinderfrau, unterwegs war, fragte sie sofort, wo denn „ihr Eissi“ sei. Sie konnte sich ein Leben ohne Eissi nicht vorstellen.
1908 ließ Thomas Mann ein Landhaus in Bad Tölz bauen, indem die Familie bis 1917 jedes Jahr den Sommer verbrachte. Im nahe gelegenen Klammerweiher lernten Erika und Klaus schwimmen und erfuhren dabei, wie nahe Spaß und Ernst, Vergnügen und Trauer, Leben und Tod beieinanderliegen. Sie wurden an diesem Ort zum ersten Mal direkt mit dem Tod konfrontiert. Ein Bäckerlehrling ertrank in dem Weiher, in dem sie ihre ersten Schwimmversuche absolviert hatten, und wurde in der Leichenhalle umgeben von Blumen und Kerzen offen aufgebahrt. Erika und Klaus durften ihn in Begleitung ihrer Kinderfrau anschauen. Ein Ereignis, das die beiden vorlauten Kinder zum Schweigen brachte. Sie spürten, dass hier etwas Elementares geschehen war, das sich ihrer bisherigen Erfahrung entzog. Der Junge wirkte wie ein verwunschener Prinz. Erst als die Kinderfrau zum Aufbruch mahnte, konnten sie sich von dem Bild des Toten lösen.
Die Mann-Kinder liebten ihr Tölzer Domizil. Das etwas außerhalb der Stadt gelegene Haus am Hang mit seinem riesigen Garten voller alter Bäume war Schauplatz von Klaus Manns „Kindernovelle“. Hier konnten Erika und Klaus nicht nur ihrer Fantasie freien Lauf lassen, sondern auch ihre Ideen in Spiele und Inszenierungen umsetzen. Haus und Garten wurden im Gro-Schi-Spiel zu einem Ozeandampfer. Die Besatzung war vor Ort und bestand aus den Eltern, den beiden kleinen Geschwistern, dem Kindermädchen und dem Hund. Sie hatten verschiedene Abenteuer auf hoher See zu bestehen, unter anderem den Angriff des Reiches der Finsternis, das den Namen Klie-klie trug.
Im Erfinden von Bezeichnungen und Namen waren Klaus und vor allem Erika unermüdlich. Bekannt sind die Familienspitznamen „Mielein“ für die Mutter, „Zauberer“ für den Vater, „Eissi“ für Klaus, „Offi und Ofey“ für die Großeltern. Später werden auch die Freundinnen und Freunde nicht verschont bleiben. Allein für Therese Giehse tauchen immer wieder neue Benennungen auf – abhängig vom jeweiligen Stand der Beziehung. Im schlimmsten Fall würden sie sehr verletzend sein.
Prinzessin von Lügenland
1910 bezogen Thomas und Katia Mann mit ihren Kindern in München eine neue Wohnung, die den Ansprüchen der schnell wachsenden Familie – Golo wurde 1909, Monika 1910 geboren – gerecht wurde: Genauer gesagt, handelte es sich um zwei Vierzimmerwohnungen in der Mauerkircherstr. 13, die miteinander verbunden waren. Ab 1914 wohnten sie dann, wiederum von Katias Eltern unterstützt, in der imposanten Herzogpark-Villa in der Poschingerstraße, die ein Jahr zuvor gebaut worden war und drei Etagen umfasste. Es war genau die richtige Umgebung für Erika, Klaus und ihre Freunde: wild, einsam, unbeaufsichtigt. „Vorsicht, die Mannkinder!“, lautete eine Warnung in der Umgebung, weil es die Herzogparkbande oft toll trieb. Zu dieser gefürchteten Bande gehörten neben Erika und Klaus die Töchter des Dirigenten Bruno Walter und seiner Frau Elsa, Gretel und Lotte, sowie Richard Hallgarten. „Wir mystifizierten, logen, täuschten mit Glanz und mit einer Leichtigkeit, die beneidenswert war, wir waren eingespielt aufeinander, ein tolldreistes Ensemble, nie klaffte ein Riss in unseren Netzen“, charakterisiert Erika Mann „die böse und einfallsreiche Horde“.
Erika und Klaus wuchsen in dem Bewusstsein auf, etwas Besonderes zu sein – mit den damit verbundenen Implikationen Chance und Bürde. Der Wermutstropfen lag darin, dass sie nicht um ihrer selbst willen außergewöhnlich waren, sondern wegen der Berühmtheit ihres Vaters. „Er war anders als andere Väter“, resümiert Erika. Morgens sei er nicht wie andere Väter zur Arbeit in ein Geschäft, in ein Büro oder in eine Fabrik gegangen, sondern in sein häusliches Arbeitszimmer, das „heilig“ war, – „ein Raum, den man nur betrat, wenn man eingeladen wurde“. Von seinem Fleiß und seiner Disziplin waren sie beeindruckt. Besonders davon, dass er täglich arbeitete, obwohl ihn niemand dazu zwang und er keinen Vorgesetzten hatte. Erika und Klaus kamen zu dem Schluss, dass er offenbar „von innen heraus“ schreiben und nachdenken musste. Dazu benötigte er unbedingte Ruhe und konnte „fuchsteufelswild“ werden, wenn die Kinder das vergaßen und ihn störten. Was sie sonst taten, ob sie ungezogen oder faul waren oder schlechte Zensuren heimbrachten, bekam er erst mit, wenn die Mutter ihn davon unterrichtete, die Kinder „verpetzte“. Das tat sie nur in äußersten Notfällen. Erika und Klaus nutzten die Situation auf ihre Weise aus. Besonders Erika lotete die Grenzen aus und testete, wie weit sie gehen konnte. Dabei entwickelte sie die Gewohnheit, zu lügen, Geschichten zu erfinden, zu fabulieren. Manchmal wurde ihr das sogar selbst zum Verhängnis, doch sie machte trotzdem weiter, bis es ihrem Vater eines Tages zu viel wurde und er ernst mit ihr redete. Da war sie sieben Jahre alt. Nach seiner Standpauke, in der er ihr empfahl, sich einmal vorzustellen, alle anderen Menschen lögen ebenfalls, wurde sie nachdenklich. Darauf war sie noch gar nicht gekommen. „Wir würden uns gegenseitig gar nicht mehr zuhören, weil es zu langweilig wäre“, schloss der Vater seine Strafpredigt. Obwohl sie seinen Appell anfangs nicht ernst genommen hatte, hörte sie „von Stund an“ mit dem Lügen auf – zunächst: „Als wir größer waren, mit vierzehn oder fünfzehn, logen wir wieder lustig.“
Mit der Kabarettnummer „Prinz vom Lügenland“ sollte sie später in der Pfeffermühle größten Erfolg ernten.
Ich bin der Prinz von Lügenland,
Ich lüg, dass sich die Bäume biegen, –
Du lieber Gott, wie kann ich lügen,
Lüg alle Lügner an die Wand
Selbstbewusst verkündete sie:
Ich lüge so erfindungsreich
Das Blau herunter von den Himmeln.
Bei mir daheim im Lügenland
Darf keiner mehr die Wahrheit reden, –
Ein buntes Netz von Lügenfäden
Hält unser großes Reich umspannt.
Später waren es nicht mehr nur die Lügen, die ihre Umgebung irritierten, sondern die Übertreibungen und Ausschmückungen, all die schillernden Produkte ihrer lebhaften Fantasie – ganz im Sinne des Thomas Bernhard’schen Ausspruchs, Schriftsteller seien Übertreibungskünstler. Besonders eindringlich erzählt auch die Schriftstellerin und Psychoanalytikerin Lou Andreas-Salomé, wie sie als Kind vom Vorwurf einer Gleichaltrigen „Du lügst ja“ zum Verstummen gebracht wurde. Dabei hatte sie nur die gemeinsam erlebte Begebenheit in eine spannende Geschichte kleiden wollen, damit sie bei den Zuhörern besser ankam. So etwa ist auch Erika Manns Erzählweise zu betrachten. Sie kreierte Familienlegenden, die sie immer mehr ausschmückte, und entwickelte ein großes Faible für Dramaturgie, Timing und Stilisierungen.
Schon früh erkannte Erika, dass in der Familie Mann die Kinder nicht so sehr um ihrer selbst wirklich wichtig waren, sondern vor allem in Hinblick auf die Funktion, die sie für das väterliche Werk erfüllten. Rückblickend beteuerten fast alle Kinder der Mann-Familie, so gut wie nie mit ihrem Vater geredet zu haben. Monika Mann bestand sogar vehement darauf, niemals mit ihrem Vater ernsthaft unter vier Augen gesprochen zu haben. Die Erkenntnis der eigenen Bedeutungslosigkeit muss eine bittere Erfahrung gewesen sein, aus der Erika spezifische Verhaltensweisen wie zum Beispiel das Übertreiben und Lügen entwickelte. Sie strampelte sich von Anfang an ab, um Aufmerksamkeit zu erheischen, nicht übersehen zu werden. Und sie hatte damit Erfolg: Sie eroberte sich eine Sonderrolle innerhalb der Geschwisterschar und verteidigte diese mit Nachdruck. „Die Eri muss die Suppe salzen“, lautete ein geflügeltes Wort innerhalb der Familie Mann.
Der Vater nahm sie wahr und bewunderte sie sogar – jedenfalls zeitweise – und machte sie mit seinem Weltbild vertraut. Dabei wandte er eigenartige Erziehungsmethoden an, um sie auf das Leben vorzubereiten. Während Therese durch das Verhalten ihres Religionslehrers und dessen Auswirkung auf ihre Mitschüler lernte, dass es in der Welt nicht gerecht zugeht und mit dieser Erkenntnis allein dastand, wurde Erika in derselben Sache von ihrem Vater eine Lektion erteilt, die jedoch zu Missverständnissen führte: Die Familie Mann saß am Esstisch. Das Mahl war beendet, eine Feige (oder Dattel, wie es bei Klaus Mann nachzulesen ist), die der Vater übrig gelassen hatte, lag noch auf dem Tisch, zusammen mit einer großen Portion Zucker. Anstatt sie in vier Teile zu teilen und seinen vier Kindern jeweils ein Stück zu geben, reichte er Erika die ganze Frucht mit den Worten, es sei wichtig, Kinder so früh wie möglich an Ungerechtigkeit zu gewöhnen. Bei Erika kam diese Lehre jedoch nicht an, sie wertete die Geschichte vielmehr als eigenen Triumph: Der Vater hatte sie auserwählt. Das war für sie das Entscheidende.


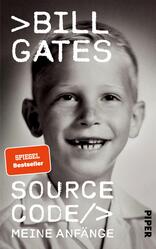
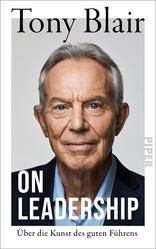

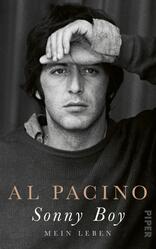




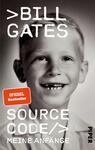
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.