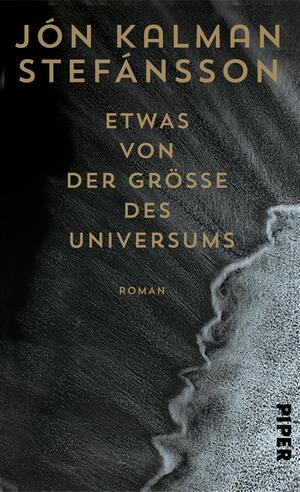
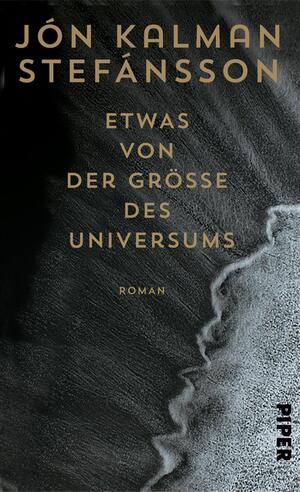
Etwas von der Größe des Universums Etwas von der Größe des Universums - eBook-Ausgabe
Roman
— Isländische Familiensaga„An diesem Buch ist nichts eitel, zynisch, konstruiert, großkotzig. Es ist ein Buch, das dem Leser sagt: Solange wir leben, ist es nicht zu spät.“ Elke Heidenreich - LiteraturSPIEGEL
Etwas von der Größe des Universums — Inhalt
Die Geschichte einer Familie, eine groß angelegte Saga über Glück und Unglück, Liebe und Tod, über Leidenschaft und Gewalt
Am Beginn der Geschichte steht der Tod, doch in Wahrheit zelebriert dieser Roman das Leben: über mehrere Generationen hinweg wird von Ari und seiner Familie erzählt; von der Leidenschaft zwischen Mann und Frau, von verbotener Liebe, Gewalt, Kummer, Betrug und Bedrückung. In Aris Familie werden Glück und Unglück eben gleichermaßen von einer Generation in die nächste gereicht. Am vorläufigen Ende dieser Reihe steht Ari selbst, auf dem Weg zu seinem Vater, mit dem er noch eine Rechnung offen hat, bevor dieser stirbt.
„Diese Prosa donnert und funkelt wie das Meer an einem isländischen Sommertag.“ Independent
Jon Kalman Stefánsson vermag diese raue Schönheit des Lebens, die auch der isländischen Landschaft eingeschrieben ist, in seiner archaischen und ergreifenden und dann doch wieder vollkommen heutigen und humorvollen Prosa einzufangen wie kaum eine anderer Autor seiner Generation.
Leseprobe zu „Etwas von der Größe des Universums“
Vorspiel
Halten wir Folgendes fest, bevor wir weitergehen, weiter und tiefer hinein in das uns Unbegreifliche, über das wir keine Kontrolle haben, das uns aber anzieht, das wir fürchten und vermissen, halten wir also fest, damit wir wenigstens etwas in der Hand haben: Wir befinden uns in Keflavík. Diesem seltsamen Ort abseits der Straße mit ein paar Tausend Einwohnern, einem leeren Hafen, Arbeitslosigkeit, Autohändlern, mobilen Hamburgerbuden und einem so flachen Umland, dass es aus der Luft aussieht wie gestocktes Meer. An stillen Morgen aber geht die [...]
Vorspiel
Halten wir Folgendes fest, bevor wir weitergehen, weiter und tiefer hinein in das uns Unbegreifliche, über das wir keine Kontrolle haben, das uns aber anzieht, das wir fürchten und vermissen, halten wir also fest, damit wir wenigstens etwas in der Hand haben: Wir befinden uns in Keflavík. Diesem seltsamen Ort abseits der Straße mit ein paar Tausend Einwohnern, einem leeren Hafen, Arbeitslosigkeit, Autohändlern, mobilen Hamburgerbuden und einem so flachen Umland, dass es aus der Luft aussieht wie gestocktes Meer. An stillen Morgen aber geht die Sonne auf wie eine lautlose Vulkaneruption. Wir sehen, wie hinter weit entfernten Bergen das Feuer entsteht, wie wenn etwas Großes aus der Tiefe heraufzieht, eine Kraft, die den Himmel anheben und alles verändern kann, wir sehen, wie die dunkle Tinktur der Nacht vor dieser Kraft zurückweicht. Und dann geht die Sonne auf. Zuerst wie ein Ausbruch, der die Sterne am Himmel, diese freundlichen Hunde, auslöscht. Dann steigt sie weiter hinauf, erhebt sich majestätisch über die feuerversengte Reykjanes-Halbinsel. Steigt langsam höher, und wir leben.
Keflavík
– Heute –
Das Schicksal setzt sich langsam in Bewegung,es schneit auf die leeren Straßen von Keflavík,auf Arbeitslosigkeit und Reklametafeln
Ari und meine Tante glaubten nicht sonderlich an von altersher Überkommenes, was vielleicht nur eine höfliche Umschreibung für Aberglauben und Unwissenheit darstellt, sofern es sich nicht im Gegenteil um ein Wissen handelt, das uns in diesem schwierigen Land am Leben gehalten hat, auf dieser großen, einsamen Insel. Das Leben hatte nur selten Mitleid mit unserer Tante, die Menschen nicht und das Schicksal ebenso wenig, und sie schrieb in ihrem Leben nur ein einziges Gedicht. Es handelte von ihrer Tochter Lára, die nach einer schweren Krankheit mit nur acht Jahren gestorben ist. Trotz ihrer Jugend schien die Kleine zu wissen, was auf sie zukam, sie war unglaublich stark und tapfer, doch zuletzt brach sie zusammen; sie erwachte aus ihrem Dahindämmern, riss die Augen auf, griff nach ihrer Mutter und fragte ängstlich: Mama, glaubst du, sterben tut weh? Mama, werde ich dann mutterseelenallein sein? Und unsere Tante, immer nur Lilla genannt, lächelte und sagte: Nein, mein Zuckerstückchen, wir werden immer zusammen sein, ich lasse dich nie allein. Es kostete sie große Kraft, zu lügen, dabei zu lächeln und dieses Lächeln vor der Tochter beizubehalten, damit sie in diesen letzten Stunden ihres Lebens etwas Schönes sah und darum glaubte, der Tod sei lediglich ein kleiner Seitenschritt, ein augenblickskurzes Innehalten vor dem Glück, und dass sie nicht zu fürchten brauchte, der Tod könnte stattdessen ein harter, grausamer alter Mann sein, der in dem dunklen Berg oberhalb des Orts hauste. Ihr Lächeln konnte Lilla durchhalten, aber an den Tränen, die ihr dabei aus den Augen liefen, war nichts zu ändern. Sie hielt Lára in den Armen und fühlte, wie das junge Leben erlosch, sie hielt sie mit der ganzen Kraft der Liebe, die unermesslich ist und viel älter als die siebenhundert Jahre alte Lava, die sie durch das Fenster ihres Hauses in Grindavík sah. Sie hielt ihre Tochter fest, doch auf der anderen Seite zog noch viel fester der Tod, und am Ende zieht er alles an sich, Blumen und Sonnensysteme, Bettler und Präsidenten. Lilla spürte das, sie fühlte, dass die Liebe, die Tränen, die Verzweiflung nicht halfen, dass es in der Nähe des Todes keine Gerechtigkeit gab, nur das Ende, und da schrieb sie ihr Gedicht, konnte sich dessen nicht erwehren, eine unaufhaltsame Kraft trieb sie dazu, während sie den ausgezehrten, acht Jahre jungen Körper hielt; längst hatte sie ihr eigenes Leben zum Tausch angeboten, ihr Glück, ihre Gesundheit, ihre Erinnerungen, alles, aber sie war mit allem abgewiesen worden. Es war alles umsonst, und das Einzige, was Lilla zu tun blieb, das Einzige, was sie noch für ihre Tochter tun konnte, war, sie zu halten, während ihr die Tränen herabliefen, ein Gebet nach dem anderen zu sprechen, so aufrichtig und rein, dass es unbegreiflich ist, dass nichts geschah; sie bewirkten nichts, vielleicht gibt es wirklich keinen Funken, keine Spur von Gerechtigkeit auf dieser Welt. Und da, oder vielleicht deswegen, verfasste sie das Gedicht auf ihre Tochter. Dass sie ein acht Jahre altes Mädchen mit lockig blondem Haar, klarer Stirn, hellblauen Augen, einem lustigen Knubbelnäschen und einem Mund darunter sei, der so lachen konnte, dass alles Übel der Welt davor zu einem dunklen Stein zusammenschrumpfte, der sich einfach wegwerfen ließ.
Lillas jüngerer Bruder war ein Dichter, ihre Schwester auch, aber Lilla hatte nie dichten können, ebenso wenig wie ihr älterer Bruder, Aris und mein Großvater, nicht eine Zeile hatte sie geschrieben, bis zu dem Zeitpunkt nicht, an dem alles zusammenbrach. Ein Gedicht, zwei Strophen, dann ging die Welt unter.
Ein Jahr später hatte Lillas Mann sie verlassen. Sie schien nicht mehr leben zu wollen, bekam keine Kinder mehr, ließ ihn nicht mehr an sich heran, er durfte kaum noch um sie sein, sie erst recht nicht anfassen. Er bezichtigte sie einer fanatischen Trauer, so drückte er sich aus, fanatische Trauer. Ich hätte es wissen müssen, sagte er wütend, er spuckte die Worte regelrecht aus. Ich bin mehrfach vor deiner Familie gewarnt worden, wurzellose, fanatische, unzuverlässige und nervlich zerrüttete Künstlernaturen. Ich will noch weiterleben. Ist das ein Verbrechen? Ist das etwa Verrat? Du bringst mich wirklich um mit deiner Trauer.
Und dann hatte er die große geballte Faust auf den Tisch geknallt, allerdings mit glänzenden Augen, als hätte er plötzlich mit den Tränen zu kämpfen. Später wurde er ein reicher Reeder im Fischereiwesen, landesweit bekannt, auch in der Geschichte Grindavíks wird er erwähnt, nicht aber Lilla, denn so ist es, wir erinnern uns an Reichtum, aber nicht an Sorge und Trauer. Sie zog nach Reykjavík zurück. Mit all ihrem Hab und Gut in einem Koffer: Wäsche zum Wechseln, vier Bücher, die Schnupftabakdose ihres Vaters, der am Tag vor ihrer Konfirmation ums Leben gekommen war, nachdem er voll wie eine Haubitze ins Reykjavíker Hafenbecken gefallen war, lachend im kalten Wasser geplanscht hatte und spät oder noch später erst von seinen kichernden Saufkumpanen herausgefischt worden war, weil Lillas Vater, Aris und mein Großvater, im Wasser wie eine groteske Qualle oder ein missgebildeter Fisch aussah, so spät, dass er sich etwas holte, eine Lungenentzündung bekam und starb. Nichts weiter im Koffer als das: Wechselwäsche, vier Bücher, eine Schnupftabakdose, ein Bild von Lára, zwei Kleidchen von ihr, ihre Puppe, vier Bilder und das Gedicht, das Lilla noch mit der Maschine abtippen und unter das Foto kleben würde. Und dann noch die Selbstvorwürfe, dass sie Lára im Stich ließ, indem sie weiterlebte, anstatt mit ihr zu sterben.
Das Bild und das Gedicht waren immer das Erste, was sie aufhängte, wenn sie in ein neues Zuhause zog, ein neues Kellerloch, ein neues Mansardenzimmer, ein neues Kabuff, und das tat sie häufig, in gut vierzig Jahren zog sie sechsundzwanzigmal um. Als wäre sie auf der Flucht, sie hielt es nirgendwo länger als zwei Jahre aus, und als Erstes hängte sie nach einem Umzug immer das kleine Foto von einem siebenjährigen lächelnden Mädchen vor einer Hauswand in Grindavík auf, aus den Jahren, in denen noch die Sonne geschienen hatte. Das Bild hing immer über ihrem kleinen grünen Sofa, das Gedicht darunter und die vier Zeichnungen drumherum. Mit der Zeit wurden die Bilder und das Gedicht zu dem Einzigen, das die Welt noch daran erinnerte, dass es einmal ihre Tochter auf Erden gegeben hatte. Ari und ich lernten das Gedicht schon früh auswendig, ganz von uns aus und ohne uns etwas dabei zu denken. Wir haben einfach so oft auf den Sesseln vor der Couch gesessen, heißen Kakao getrunken, Kekse dazu gemümmelt und uns von Lillas Gutmütigkeit bemuttern lassen, und dabei ist das Gedicht irgendwie in uns eingesickert. Lilla hat das nur aus Zufall mitbekommen, als sie schon alt und gebrechlich war und die Kontrolle über sich zu verlieren begann; die sonst so beherrschte Frau fing an zu zittern, wiegte sich dann vor und zurück, als wollte sie sich auf diese Weise beruhigen, brach dann aber doch vor uns in hemmungsloses Weinen aus, als wäre dieses Gedicht das Einzige, das verhinderte, dass ihre Tochter in Vergessenheit geriet. Als wäre Lára so lange im Jenseits nicht in Gefahr, wie es das Gedicht noch gab und jemand es auswendig konnte. Als würde dadurch jemand auf sie aufpassen, wenn das Dunkel voller Bedrohungen war – als wäre das Gedicht eine Art Botschaft, die den namenlosen Abstand zwischen Leben und Tod überwinden und bis zu der Achtjährigen durchdringen konnte, die auf ihre Mama wartete, die sie jenseits von allem, was wir wissen, erreichen und berühren und ihr sagen würde: Alles ist gut, deine Mama kommt bald, bald stirbt sie auch, und dann geht ihr wieder zusammen Blümchen pflücken.
Sechsundzwanzigmal zog sie um, aus dem Keller auf den Dachboden, vom Speicher wieder in den Keller, und bevor sie sich in einer neuen Behausung zum ersten Mal schlafen legte, zählte sie immer die Fenster, eins, zwei, drei, vier, fünf, denn dann würde in Erfüllung gehen, was sie in der Nacht träumte. Es war ein alter Aberglaube, alter Ballast, und es war so ziemlich das Einzige, was sie an derlei mit sich herumschleppte, aber daran wollte sie glauben, dass Träume über eine Kraft verfügten, von der weder das Wachsein noch die Logik etwas wussten, und wer weiß, vielleicht würde sie eines Morgens neben dem Lächeln ihrer Tochter aufwachen, die noch immer acht Jahre alt war, obwohl inzwischen Jahrzehnte vergangen waren, denn Tote altern nicht, in der Ewigkeit vergeht keine Zeit, denn dort richtet ihre rücksichtslose Macht nichts aus. Aus irgendeinem Grund haben Ari und ich diesen Glauben von ihr übernommen, die Fenster abzuzählen, wenn wir zum ersten Mal irgendwo übernachten. Ich zähle die Fenster in dem kleinen zweistöckigen Holzhaus des Onkels in Keflavík. Dazu muss ich eigens nach draußen gehen, in den Schneefall, so dicht, dass Keflavík darin ganz verschwunden ist. Völlig weiß komme ich wieder herein, von einer Lage Schnee bedeckt, die wir Engelskleid nennen, wie gesegnet, aber die Katzen des Onkels fauchen mich an wie zwei Giftschlangen. Ich gehe schlafen, breite erst noch eine Decke über den Onkel, der in seinem Lehnstuhl eingeschlafen ist, während die Hljómar sangen „Himmlisch ist es, zu leben“, was natürlich eine kühne Behauptung ist. Ich decke ihn zu, stoße mir zweimal den Kopf an den Flugzeugmodellen, die an dünnen Fäden von der Decke hängen, Kampfflugzeuge der Amerikaner. Ich habe die Fenster gezählt, der Schnee auf mir ist geschmolzen, ich schließe sorgfältig die Zimmertür, damit mir die Katzen nicht im Schlaf die Augen auskratzen, liege dann im Bett, das mich an mein altes, schmales Konfirmationsbett erinnert, und schlafe ein. Im Schlaf höre ich das Meer, es ist da draußen im Schneefall, nicht weit vom Haus, das größte Musikinstrument auf Erden, die Geschwister Schicksal und Tod sind ebenso in seinem Klang enthalten wie ihre Widersacher Trost und Wut. Ich sinke langsam in die Welt des Schlafs, und das Rauschen des Meeres mischt sich in meine Träume. Das Meer, das einmal die Heimat von Aris Großvater Oddur war, er schaute aufs Meer und fühlte sich frei. Das Letzte, was ich höre, bevor mich der Schlaf ereilt und die Träume mich umfangen, ist, wie der Onkel oben in seinem Zimmer über mir im Schlaf redet und dann fröhlich auflacht.
Ich schlafe.
Wie Ari im Flughotel. Leichte Aufgabe für ihn, die Fenster zu zählen, es sind nur zwei, sie rahmen beträchtlichen Schneefall ein, alles andere ist weg, die Einwohner von Keflavík können sich eine Weile von der Welt erholen, es gibt sie nicht mehr. Nur Luft und Schnee sind um sie her. Nur Schneeflocken, dieses Weiß vom Himmel. Botschaften, Küsse, die auf unserer Stirn schmelzen. Alles andere ist verschwunden, die Tankstelle, die Geschäfte gegenüber, das Kino, die Hafenstraße, die Hringbraut, nur ein kurzes Stück weiter weg, die Arbeitslosigkeit, der leere Hafen, der Weihnachtsschmuck, die Reklameschilder. Da ist nur der Schnee, er rieselt ohne Unterlass die ganze Nacht herab und verbindet die Erde mit dem Himmel, was wahrscheinlich wichtiger ist, als uns bewusst ist, denn alte Quellen, viel ältere als die, die uns Fenster zählen und damit unsere Träume wahr werden lassen, viel älter noch, aus Zeiten, in denen es noch keine Fensterscheiben gab, nicht einmal Häuser, derartige Quellen behaupten, in solchen Nächten, stillen mit dichtem Schneefall, bestehe kein Unterschied zwischen Himmel und Erde mehr, und dadurch könnten die Toten mit uns noch Lebenden Verbindung aufnehmen. Die Schneeflocken werden zu Botschaften der Toten: Ich liebe dich noch immer. Du lieber Gott, wie sehr ich dich vermisse! Mir geht es so lala, ach, eigentlich ganz gut, danke. Es gibt richtig guten Kaffee hier, und die Aussicht macht dich jahrelang sprachlos. Mögest du in der Hölle schmoren! Vergeude dein Leben nicht mit banalem Mist, probier etwas Wichtiges, Großes! Den Versuch ist es allemal wert, und du bist schön, solange du es versuchst. Denk dran, dich morgen früh warm anzuziehen, du darfst dich nicht erkälten.
Ari hört nichts davon, er schläft.
Er ist endlich eingeschlafen, nachdem er den Artikel von Sigga gelesen hat, der dem Brief seiner Stiefmutter beilag, ein Artikel über Gewalt von Männern gegen Frauen, eine Gewalt, die sich der Mann selbst anmaßt – und dann Sigrúns Bericht, wie sie selbst vergewaltigt worden ist. Ari und ich hatten gesehen, wie Kári sie vom Ball hinaus zu seinem Lada geführt hatte, und wir sahen zu, wie er sie vergewaltigte. Sie war knapp sechzehn, er über dreißig, Vater von zwei Kindern. Wir aber hatten die Situation komplett missverstanden. Wir sahen, wie der Wagen zu schaukeln begann und Káris weiße Hinterbacken im Rückfenster auftauchten, weiß und behaart wie zwei kleine Teufel. Nachdem er alles gelesen hatte, weinte Ari. Nicht sofort. Erst saß er wie gelähmt da, dann stapfte er wütend durch sein Hotelzimmer, bebend vor Zorn, Selbstverachtung und Ohnmachtsgefühlen, warf sich aufs Bett, starrte vor sich hin, fluchte, fuhr sich übers Gesicht und stellte fest, dass es nass war von Tränen. Fast verwundert dachte er: Ich weine. Er putzte sich die Zähne. Weinte. Las Sigrúns Geschichte noch einmal. Er gab ihren Namen in die Suchmaske ein und fischte vier Bilder aus diesem Meer. Auf denen war sie um einiges älter als fünfzehn, aber das machte nichts, denn Ari erinnerte sich noch genauestens, wie sie sich bewegt hatte, damals im Schlachthaus von Búðardalur, dem verschlafenen Nest, in dem nur wenige Bäume wachsen, die Wäsche auf der Leine heftig flattert, die Einwohner sich im Schlaf wälzen, viel passiert dort nicht. Sigrún bewegte sich auf eine Weise, dass wir gar nicht anders konnten, als uns in sie zu verlieben. Ari träumte von einem Leben mit ihr, manchmal brachten wir sie zum Lachen, und alles begann in uns zu hüpfen. Dann aber stieg sie zu Kári ins Auto, der ihr die Hose auszog und sich in sie hineindrängte, der sie vergewaltigte, während wir in einem blauen Land Rover dicht dabeisaßen, zusahen, wie der Lada schaukelte, dazu Brimkló hörten und uns selbst bemitleideten. Ari lag im Bett, sah die Tüte mit den Süßigkeiten, die Whiskyflasche auf dem Brief der Stiefmutter, den er noch nicht zu Ende gelesen hatte, das hatte er vor dem Einschlafen tun wollen, konnte es da aber nicht. Er war kaputt, unendlich müde, brauchte aber trotzdem lange, um in den Schlaf zu finden. Er zog die Vorhänge nicht zu, weil er es beruhigend fand, den herabschwebenden Flocken zuzusehen, er besaß keine Vorstellung davon, dass Schneeflocken vielleicht Worte der Toten sind: Deck dich gut zu, damit dir nicht kalt wird. Sein Herz klopfte, die Nerven zitterten, doch der Schneefall besänftigte ihn am Ende. Nach zwei Jahren in Dänemark war er nach Island heimgekehrt, hatte entdeckt, dass die Gletscher Riesenblumen für den Himmel sind; dann hatte er sich bei der Einreise am Zoll über das alte Schulpult bücken müssen, damit sein Cousin und ehemaliges Vorbild Ásmundur ihm den dicken Zeigefinger in den Enddarm einführen konnte. Jetzt schläft er. Die Whiskyflasche auf dem Brief der Stiefmutter, Oddurs Urkunde daneben wie eine wichtige Nachricht, die er erst noch auswerten muss.
Aris letzte Gedanken vor dem Einschlafen galten Lilla. Wahrscheinlich weil er dachte: zwei Fenster, eins, zwei, ich habe sie gezählt, jetzt werden die Träume in Erfüllung gehen. Was aber, wenn ich etwas Schlimmes träume, wenn jemand im Traum stirbt, wenn ich einen Albtraum habe, in dem meine Kinder ums Leben kommen? Ach Lilla, dachte er in der ersten Welle des Schlafs, und da erschien sie vor ihm, klein, still, obwohl sie als junger Mensch temperamentvoll gewesen war, aber die Trauer machte sie ruhig, so kannten wir sie, immer still, gutmütig, besonnen, nur manchmal funkelten ihre Augen, als verlangten sie nach mehr Leben, mehr Glück. Sie hatte die wärmste Hand, die Ari je untergekommen war, als wäre sie in der Lage, mit dieser Hand jeden zu trösten, nur sich selbst konnte sie nie vergeben, dass sie weiterlebte, nachdem ihre Tochter gestorben war, dass sie ihre Tochter in den Klauen des Todes allein gelassen, nicht fest genug dagegengehalten, nicht innig genug geliebt hatte. Was ist das nur für ein Mensch, der sein Kind nicht retten kann? Sie erschien Ari im Einschlafen, strich ihm mit ihrer warmen, schwieligen Hand über die Stirn, beruhigte und tröstete ihn, summte ihn in den Schlaf, ihre Augen gutmütig, aber traurig, weil die Toten zum Schweigen verdammt sind und deswegen auf uns bauen müssen.
Es schneit über Keflavík.
Es schneit auf Arbeitslosigkeit, leere Straßen, ein kleines zweistöckiges Holzhaus und das Hotel, das auf den Trümmern von Skúli Millions Kühlhaus errichtet worden ist, schneit auf diesen Ort voller Erinnerungen, auf Aris und meine Spuren, es schneit auf die Siedlung, in der Aris Vater Jakob wohnt, es ist nicht sicher, ob auch er schläft, vielleicht ist er wach, hört Musik, denkt über sein zu Ende gehendes Leben nach, das sich dem Tor zur Dunkelheit nähert. Er wurde im Osten geboren, in Neskaupstaður, und lag dort einmal halb tot am Ufer, noch kein Jahr alt; seine Mutter Margrét hatte ihn abgelegt und war ins Meer gewatet. Er ist wach und denkt über sein Leben nach, oder tut das gerade nicht, vermeidet es, in diese Richtung zu denken. Er kann nicht schlafen oder wagt es nicht, hat Angst vor dem Schlaf, in dem wir so schutzlos ausgeliefert sind, eine offene Wunde, in der all unsere Schutzmauern brechen.
Norðfjörður
– Damals –
Wie ist es nur möglich, eine solche Windstille zu schaffen? Ist das vielleicht die höchste aller Fähigkeiten, der Gipfel der Schöpfung?
Es sind Jahre vergangen.
Vielleicht nicht sehr viele, aber doch einige, und die Zeit ändert alles, schnell und langsam, manche sind gestorben, andere wurden geboren. Wir befinden uns in der Zeit zwischen den Weltkriegen, einer Epoche von einundzwanzig Jahren, in der sich der Mensch Ideen zu eigen macht, die sogar den Teufel erblassen lassen. Es ist eine Handvoll Jahre her, seit der völlig nackte Oddur mit einem bekleideten Tryggvi auf den Armen aus dem Boot gestiegen ist, es war in einer Novembernacht mit Frost und Sternen, Tryggvi war über Bord gesprungen und hatte zum Mond schwimmen wollen, er kühlte bereits aus und drohte zu versinken, als Oddur ihn doch noch hatte ins Boot ziehen können; er jagte zum Land, nackt am Steuer, weil er Tryggvi in jeden Faden gehüllt hatte, den er selbst am Leib trug, und schleppte ihn dann vom Boot in den Ort, wir haben dir schon davon erzählt, aber manches muss man wiederholen, weil so vieles in Vergessenheit gerät. Beide waren so knülle von französischem Cognac, dass sie keinen klaren Gedanken mehr fassen konnten. Außerdem war Tryggvi durch die Kälte der See dem Tod näher als dem Leben und hätte durchaus da unter den Sternen sein Leben aushauchen können, auch Oddur war durch und durch ausgekühlt und brabbelte dummes Zeug, hatte völlig den Überblick verloren, als Áslaug, die von den Vatnsleysuströnd kam und auf Abenteuersuche im Norðfjörður war, die beiden fand.
Ich habe dich bewusstlos in den Armen von jemandem erblickt, erzählte sie Tryggvi später, den ich erst für einen Meergeist hielt, der aus der Tiefe gestiegen war, um mir zu bringen, was ich suchte.
Sie erzählte Tryggvi und später ihren Töchtern häufig die Geschichte, wie sie aus einem merkwürdigen Traum erwacht und im Halbschlaf zum Austreten vor die Tür gegangen war und die beiden da entdeckt hatte. Sie wurde nie müde, das noch einmal zum Besten zu geben, zuletzt noch, als sie als alte Frau im Keflavíker Krankenhaus lag und der Tod sie holte, einmal schaffte sie es noch, als wollte sie die Geschichte, wie es mit ihnen angefangen hatte, hier im Leben zurücklassen. Sie hatte Tryggvi dann zu sich ins Haus getragen, war eine kräftige Frau, hatte ihn ausgezogen und mit ihrem Körper gewärmt, dabei war so langsam die Lust erwacht, dann die Liebe, und das Endergebnis war das Glück gewesen.
Seitdem aber sind Jahre vergangen, die beiden Schwäger sind zum Fischen ausgelaufen, hundert Kilometer von zu Hause entfernt, draußen vor dem Vatnajökull, haben die Leine ausgeworfen und eine wohlverdiente Ruhepause vor sich.
Ruhiges Wetter, kein Wind, als hätte der liebe Gott vergessen, sich um das Wetter zu kümmern. Oder als wäre er schlichtweg baff über sein Schöpfungswerk, vor allem über den Gletscher, der weiß das Land überragt, das Meer und die Fischer auf der Sleipnir. Aber wie ist es überhaupt möglich, eine solche Windstille zu schaffen? Ist das vielleicht die höchste aller Fähigkeiten, der Gipfel der Schöpfung, das zu erschaffen, was es kaum gibt und was nichts tut, nichts berührt und doch alles verändert? Die Welt in wunderbare Stille verwandelt und obendrein tief in diesen Seeleuten aus dem Norðfjörður eine Saite anschlägt, die hier vor dem Hornafjörður Dorsch aus der unsichtbaren Tiefe ziehen, denn für die Zeit des tiefsten Winters müssen die Boote von dort hierher verlegen. Wochenlang liegen sie hier, weit von zu Hause, weit von ihrem geliebten Norðfjörður, der wohl der schönste Fjord der ganzen Insel und damit der ganzen Welt sein muss, aber was tun wir nicht alles für den verdammten Fisch, vom Dorsch erst gar nicht zu reden. Wenn der verschwände, könnten wir einpacken und uns gleich eine Kugel durch den Kopf schießen. Nun, sie haben die Leine ausgelegt, wobei ihnen einigermaßen warm geworden ist, doch während sie nun grinsend Tryggvi zuhören, kommt die Kälte wieder angekrochen, sie möchten sich gern ausruhen, während die Leine ausgebracht ist und den Fisch anlockt. Drei, vier Stunden später holen sie sie wieder ein, warten darauf, dass Rúnar, der Smut, das Essen fertig hat, und danach können sie sich hinlegen und eine Mütze wertvollen Schlafs nehmen. In der Zwischenzeit treten sie von einem Fuß auf den andern, die Füße werden kalt, aber die Flaute ist so total und die Stille so tief, dass man einen leisen Knall vernimmt, wenn an Land, also kilometerweit entfernt, jemand einen fliegen lässt – jedenfalls wenn man Tryggvi glaubt. Er ist in Fahrt, erzählt und erzählt, die anderen hören zu, Oddur hat soeben damit gedroht, Tryggvi über Bord zu werfen und ihn wieder einzuholen wie einen Dorsch und ihn auch so zu verarbeiten, wenn er nicht endlich mal die Klappe hält. Þórður hört, wie sein Vater Tryggvi verwünscht und diese Drohung ausstößt, aber er sieht auch das halb unter dem Bart verborgene Lächeln.
Oddur hat seinen ältesten Sohn vor einigen Wochen als Vollmatrosen angeheuert. Als Matrose war Þórður vorher ein knappes Jahr mit dem alten Guðmundur gefahren, dem ältesten Kapitän im Norðfjörður, einem nicht tot zu kriegenden Kraftprotz mit einem mächtigen Körper, der letzten Herbst noch mit seiner Mannschaft dem verfluchten segensreichen Dorsch nachgestellt hatte.
Jetzt beißt gerade ein großer an, hatte der Alte gedröhnt mit seiner Bassstimme, die kleine Steine auf dem Grund zwanzig Meter unter ihnen erzittern ließ. Teufel noch mal, das nenne ich einen Fang, rief er, als die Winde stockte und knirschte, als würde sie sich über zu viel Gewicht beschweren und als wäre es ungerecht, dass immer sie den ganzen Fisch heraufholen musste. Guðmundur sprang an die Winde, nahm die Leine in seine Pranken, weil er sich schlecht an die Technik gewöhnen konnte, er war so aufgewachsen und verließ sich am liebsten auf seine Muskelkraft; also spannte er die Schultern an, diese Scheunentorflügel, und wandte seine gesamte Kraft auf, um den Riesenfisch aus der Tiefe zu holen, der sich aber nicht als Dorsch oder Heilbutt herausstellte, wie die Männer zuerst annahmen, sondern als der Tod persönlich, den der Alte da zu sich heraufzog. Sein Herz brach, als er den Tod eine Daumenbreite über das Dollbord gehievt hatte, sodass seine Augen sichtbar wurden, zwei tiefe, dunkle Gräber. Das waren die letzten Atemzüge des starken alten Guðmundur. Etwa um die gleiche Zeit zog einer der Männer aus Oddurs Besatzung nach Seyðisfjörður um – natürlich eine unbegreifliche Dummheit an sich, aus dem schönsten aller Fjorde in einen bedeutend schlechteren zu wechseln, aber manchen ist eben nicht zu helfen. Der Tod und dieser Umzug bildeten jedoch in diesem Fall ein glückliches Zusammentreffen, und Oddur holte seinen Jungen zu sich an Bord. Gerade sechzehn Jahre alt. Noch nicht ganz ausgehärtet, und trotzdem wurde er anderen guten Seemännern vorgezogen; Oddur hätte sich leicht unter allen guten Fischern aus dem Norðfjörður oder von weiter weg den besten aussuchen können; es galt als Auszeichnung, bei Oddur anheuern zu dürfen, dem man Fangglück nachsagte und den man für seine Charakterfestigkeit schätzte, die allerdings auch in Härte umschlagen konnte.
Zwischen Vater und Sohn war das kein Thema, und wenn man genauer darüber nachdenkt, haben sie wahrscheinlich nie über anderes miteinander geredet als über den Fisch, das Meer, die Berge, die Fliegen auf dem Fensterbrett und wie wichtig es ist, im Leben etwas zu taugen. Daher wusste Þórður so genau, als hätte man es ihm Buchstabe für Buchstabe eingetrichtert, dass er sich nichts herausnehmen und nie die Beherrschung verlieren durfte und auf keinen Fall hinter den reiferen Vollmatrosen zurückbleiben durfte, ja, sie eher noch übertreffen musste, und genau das wollte er auch, der Ehrgeiz brannte in ihm. Sie sind auf See, hundert Kilometer von zu Hause, und Margrét weiß, dass Oddur seinen Sohn unter Beobachtung hat. Nicht unterstützend, sondern eher fordernd. Und sie kann nichts tun. Der Abstand zwischen der Welt und dem Meer ist zu groß. Als der alte Guðmundur gestorben war und dessen Schwiegersohn sein Boot übernahm und es in den Reyðarfjörður holte, hatte sie mit einem Gedanken gespielt, der fast ein Traum war, dass nämlich Þórður an Land Arbeit finden könnte; dann hätte er zu ihrer aller Freude öfter zu Hause sein und Bücher lesen können, sich vielleicht sogar auf weitere Schulbildung vorbereiten, doch da hatte Oddur seine überraschende Entscheidung bekannt gegeben, seinen Sohn als Matrosen an Bord zu nehmen.
Sie hatten im Bett gelegen, es war in einer Nacht etwa zur Winterszeit, aber hell, weil Mondschein den Fjord erleuchtete und sie beide vom Einschlafen abhielt. Sie lagen nebeneinander, und eins führte zum anderen, wie es sein soll: Ihre linke Hand ging auf Wanderschaft. Sie tauchte unter seine Decke, streichelte seinen Körper, den sie vor vielen Jahren im Logis von Sleipnir SU-382 zum ersten Mal erkundet hatte. Doch seitdem waren sie älter geworden, auch halsstarriger, sie hatten ihre schwierigen Zeiten miteinander gehabt, mehr als genug, aber es war noch immer schön, so beieinanderzuliegen, und die Nacht kam, und der Mondschein war vollauf damit beschäftigt, die Welt zu verändern. Da war es schön, die Linke auf Erkundungstour zu schicken, den muskulösen Arm zu streicheln, den kräftigen Oberschenkel, sein Glied, und zu fühlen, wie es in der Hand anschwoll und sich aufrichtete. Kurz darauf waren sie wieder jung.
Es war sicher zwei Uhr in der Nacht, sie lagen ein bisschen dösig nebeneinander, und sie spürte ein warmes Glücksgefühl und sank langsam in den Schlaf. Oddur schaute an die Decke und sagte ruhig, wie beiläufig, dass er Þórður einstellen werde anstelle von Guðjón, dem Trottel, der nach Seyðisfjörður gezogen sei.
Ist nicht riskant, sagte er. Hatte sich entschieden, ohne ihr etwas zu sagen. Nicht riskant, sagte er und meinte, er könne sich auf den Jungen verlassen. Meinte, er sei jetzt erwachsen, ein Mann. Mit anderen Worten: Es wird jetzt uns zwei geben und auf der anderen Seite dich. Dann ergänzte er noch: Er kommt mit uns in den Hornafjörður, das wird eine gute Schule für ihn.
Margrét hatte eben noch Oddurs heißen Samen in sich gespürt, hatte seinen Kopf umfasst, ihn gierig geküsst, aber nun fühlte sie, wie sich ihr Herz verhärtete, zu Stein wurde. Oddur hatte seine Entscheidung gefällt, ohne sie einzuweihen, als ob er auf einmal mehr über Þórður zu bestimmen hätte als sie und der Junge von nun an in eine Welt gehörte, zu der sie nie Zugang haben würde. Dabei war er doch noch so jung, ja, sicher, groß und kräftig für sein Alter, aber doch noch ein Kind. Ihr Kind. Ihr Liebling. Mit einem sanften Gemüt und einem warmen, spöttischen Funkeln in den lebhaften, graublauen Augen. Von seinen Geschwistern vergöttert. Gunnar Tryggvi, sein jüngerer Bruder, ein acht Jahre alter Dreikäsehoch, ahmte Þórðurs Gang nach und versuchte, ebenfalls nachdenklich zu Boden zu blicken. Und Elín, die Jüngste, wollte abends nicht einschlafen, bevor Þórður ihr nicht eine Geschichte erzählte, die er irgendwo gelesen oder sich gerade ausgedacht hatte. Wenn es irgendwo auf dieser Welt Güte gibt, hatte Margrét einmal, ganz warm vor Mutterliebe, in ihr Tagebuch geschrieben, dann steckt sie sicher in Þórður. Was mag einmal aus ihm werden, so gut und stark, aber auch sensibel, wie er ist, und mit all seinen guten Anlagen. Welche Laufbahn mag er einschlagen? Ob er überhaupt jemals eine einschlagen darf? Wird er in Frieden vor den Bergen hier aufwachsen dürfen – und vor seinem Vater?
Gut ein Jahr vorher hatte der Schulleiter Margrét aufgesucht. Sie lag gerade auf den Knien und putzte, Elín hing quengelnd an ihr, wollte auf ihren Rücken klettern, sie wäre doch ein prima Pferd, und da stand plötzlich der Lehrer in der Tür. Er hatte geklopft, aber Margrét konnte ihn über die Schrubbgeräusche und Elíns Gequengel hinweg nicht hören, darum trat er einfach ein, wünschte einen guten Tag und kam gleich zur Sache, als wollte er es hinter sich bringen und das Haus so schnell wie möglich wieder verlassen. Er räusperte sich und schlug vor, dass Þórður weiter zur Schule ging.
Ein solches Talent darf man nicht vergeuden, sagte er, und Margrét, noch auf den Knien und überhaupt nicht zurechtgemacht, mit rot geschwollenen Händen und verschwitzt, außerdem erbost, weil er einfach so eingetreten war, erwiderte scharf und fast hitzig und eigentlich gegen ihr besseres Wissen, ob das Leben der Fischer dann also Vergeudung sei.
Der Lehrer – Þorkell war sein Name – hatte das Schulwesen im Norðfjörður, eigentlich bei null anfangend, stark verbessert; er war mit einem eisernen Willen ausgestattet, konnte aber auch gut mit Menschen umgehen, was wohl eine der wichtigsten Charaktereigenschaften überhaupt ist.
Das Leben der Fischer Vergeudung?
Þorkell blickte auf Margrét hinab. Acht Jahre hatte sie in Kanada gelebt, dort eine größere Welt mit mehr Möglichkeiten als hier zwischen den Bergen kennengelernt. Es ist ein Segen, aber auch ein Fluch, mehr und weiter zu sehen als die meisten um einen herum, eine größere Welt vor Augen zu haben als die, die unmittelbar vor einem liegt. Þorkell dreht seinen Hut in der Hand, öffnet den Mund, zögert aber. Er weiß so einiges über Margrét, kennt die Geschichten, die über sie im Umlauf sind, über ihr extremes Verhalten, das sie von anderen absondert, ihr Oszillieren zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt, dass sie entweder im Bett liegt oder herumtanzt und dass sie sich bei einigen Zusammenkünften zu Fragen der Arbeiterbewegung hervorgetan hat und über ein hitzigeres Temperament und eine schärfere Zunge verfügt als viele andere – aber hatte sie nicht auch etwas Geheimnisvolles an sich, als wollte sie sich nicht ganz zeigen und Teile ihrer Persönlichkeit vor der Umwelt verbergen? Als wüsste sie mehr als die meisten, durchschaute alles und würde trotzdem schweigen? Vielleicht aus Hochmut? Man sagt, sie hielt sich für etwas Besseres. Es gibt Geschichten über sie, dass sie halb nackt einem anderen Mann nachgelaufen sei, um ihn zu umarmen, dass sie barfuß mit ihrem Säugling ins Meer gewatet sei, dass sie tagelang im Bett liege und derweil den Haushalt verkommen lasse, Oddur habe Besseres verdient. Þorkell dreht den Hut. Er kennt das alles, er ist von hier, drei Jahre jünger als Margrét, zwei Jahre jünger als Oddur, vor dem er sein Leben lang einen mit Angst gemischten Respekt empfunden hat, er war der unbestrittene Anführer, als sie Jungen waren, und schien mit zehn, elf Jahren schon erwachsen zu sein. Þorkell dreht den Hut in der Hand, Margrét liegt auf den Knien und putzt, hat damit nicht aufgehört, obwohl er so unangemeldet hereingeplatzt ist und jetzt da steht. Er lächelt Elín an, die so verlegen wird, dass sie sich zwei Finger in den Mund steckt und die Augen zumacht. Er weiß, dass er lauter hätte anklopfen und rufen sollen, nicht einfach so hereinspazieren. Þorkell schaut ihre rot geschwollenen Hände an. Er ist verheiratet, hat drei Kinder, liebt seine Frau, aber Margrét ist das Schönste, was er je gesehen hat, und so war es, seit er von Schulen in Reykjavík und Edinburgh heimgekehrt ist. Er ist in die Welt hinausgezogen und wiedergekommen, wie er es immer vorgehabt hat, er wollte nirgendwo anders leben. Er kam zurück, und wenig später – es war an einem düsteren Regentag, an einem grauen, kalten Tag, unten im Tal regnete es, oben auf den Bergen fielen Schneeregen und Schnee, die Gipfel färbten sich weiß und verwandelten sich in Eisblumen – hatte er gerade über seinen Papieren gesessen, als ihm plötzlich übel wurde und er vor die Tür gehen musste, um frische Luft zu schnappen, und da war er unten an der Pier auf Margrét gestoßen, die darauf wartete, dass die Sleipnir, Oddurs Schiff, einlaufen würde. Die Welt war noch so jung, dass sie ihren Mann jedes Mal am Kai erwartete. Sie hatte das Schiff kommen gesehen und war losgelaufen, ohne einen Mantel überzuziehen, gerade an ihren Schal hatte sie noch gedacht, der um ihre schmalen Schultern lag, als sie dann völlig durchnässt und warm vor Liebe am Kai stand, ihre Haare wie Bäche über Stirn und Wangen, kerzengerade und voller Würde. So hatte er sie gesehen und an eine Leopardin denken müssen, die er in London im Zoo gesehen hatte, stolz, aber unruhig in ihrem Käfig. Er stand etwas oberhalb der Pier, völlig in Bann geschlagen und ganz von der Gewissheit und der traurigen Einsicht erfüllt, dass dieser Anblick zur Folge hatte, dass er niemals vollkommen glücklich sein würde.
„Ein ebenso feinsinniges wie versponnenes und detailverliebtes Buch, das alle Licht- und Schattenseiten der menschlichen Existenz beleuchtet und Humor samt Lakonie nicht vergisst.“
„Jón Kalman Stefánsson ist wieder einmal ein großer Wurf gelungen.“
„Auf berührende Art und Weise erzählt Jón K. Stefánsson von den Träumen, Ängsten und Hoffnungen seiner Figuren. Es geht um die Liebe, vertane Gelegenheiten und zweite Chancen. Stefánsson kehrt das Innenleben seiner Figuren nach außen, erzählt mit leisen Tönen von deren Glück und Kummer und berührt dabei existentielle Fragen des Lebens.“
„Jón Kalman Stefánssons großartiger, sprachgewaltiger Familienroman“
„Etwas von der Größe des Universums ist ein dunkles, aber schimmerndes Buch. Ein Buch, welches einem viel Kraft und Ruhe geben kann.“
„Die Handlung fließt oft monoton dahin wie der Ozean an einem windstillen Tag. Unter der Oberfläche aber entfaltet sich eine emotionale Tiefe und Wucht, die dem Vergleich mit der aufgepeitschten See standhält. Bestes Beispiel für diese eigentümlich fesselnde Art zu schreiben ist Stefánssons zehntes Buch ›Etwas von der Größe des Universums‹.“
„Jon Kalman Stefánsson vermag die raue Schönheit des Lebens, die auch der isländischen Landschaft eingeschrieben ist, in seiner archaischen und ergreifenden und dann doch wieder vollkommen heutigen und humorvollen Prosa einzufangen wie kaum eine anderer Autor seiner Generation.“
„Menschliche Schicksale beschreibt Jón Kalman zugleich groß und klein, in ihrer ganzen Unlogik und Widersprüchlichkeit, und wie sie untergehen in der Zeit. Vergänglichkeit ist das eigentliche Thema von ›Etwas von der Größe des Universums‹. Kaum ein Autor schreibt so schön über Vergänglichkeit wie Jón Kalman Stefánsson.“
„An diesem Buch ist nichts eitel, zynisch, konstruiert, großkotzig. Es ist ein Buch, das dem Leser sagt: Solange wir leben, ist es nicht zu spät.“ Elke Heidenreich
„Das Buch hat etwas von der Größe der Weltliteratur. Das liegt vor allem an der Feinsinnigkeit, mit der sich die Figuren immer detaillierter zusammensetzen, ohne dass je völlige Klarheit über ihre Motivation erlangt werden könne.“
„Jón Kalman Stefánssons Prosa besitzt einen ganz eigenen Duktus, ihre Dichte und ihre Wucht setzen dem Lesen einigen Widerstand entgegen. Die kurzen und präzisen Sätze warten nur darauf, sich ausweiten und vor Bedeutung explodieren zu können. Stefánssons Sprache verbindet Sinnlichkeit und Abstraktion, Lyrismus und Rauheit, satte Bildoptik und philosophische Reflexion.“
„Jón Kalman Stefánsson liefert atemberaubende Prosa.“














DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.