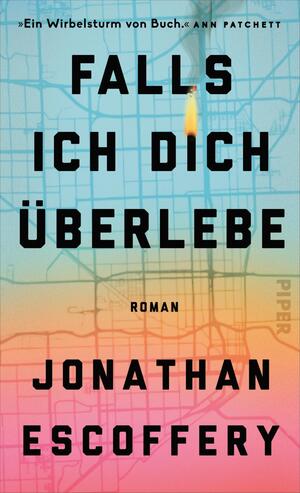
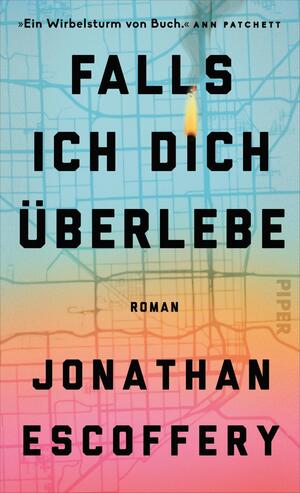
Falls ich dich überlebe Falls ich dich überlebe - eBook-Ausgabe
Roman
— Shortlist Booker Prize 2023„Rasant, rau und spannend.“ - Ruhr Nachrichten
Falls ich dich überlebe — Inhalt
„Ein atemberaubendes Debüt.“ New Yorker
„Ein Wirbelsturm von einem Buch. Hiermit beginnt Jonathan Escofferys Karriere. Seinem Schaffen sind keine Grenzen gesetzt.“ Ann Patchett
Selbst innerhalb seiner Familie ist Trelawny ein Außenseiter. Als Einziger ist er in Miami geboren. Seine Eltern, Topper und Sanya, sowie sein Bruder Delano sind vor der Gewalt auf Jamaica hierher geflohen. Die Vereinigten Staaten sind für sie nie wirklich ein Zuhause geworden. Sie alle kämpfen darum, irgendwie einen Fuß auf den Boden zu bekommen – gegen Ausgrenzung und Armut, gegen Heimatlosigkeit und Rassismus. Und insgeheim weiß Trelawny, wenn überhaupt, hat nur er die Chance auf ein besseres Leben. Auf ein Leben in einer Gesellschaft, die es ihm und seiner Familie unendlich schwer macht.
„Escoffery ist ein begnadeter Erzähler, der über eine reiche Sprache verfügt und alle Details perfekt wählt. [...] Am wichtigsten vielleicht: Er hat einen entwaffnenden, erbarmungslosen Sinn für Humor.“ The New York Times
„Wenn ich gegenüber Nicht-Jamaikanern das Wort Jamaika erwähne, denkt niemand an CIA-Agenten, Strohpuppen-Premierminister oder historische Kontinuitäten. Stattdessen assoziieren die Leute wild herum, als hätte ich sie mit einer Rap-Chiffre konfrontiert: Bob Marley, irie, ganja, arme Leute, Sandalen, 'ey Mann! Im günstigsten Fall glauben sie, die Geschichte Jamaikas hätte in dem Moment ihren Anfang genommen, als sie ihren Pauschalurlaub buchten.“
„Eins der erfrischendsten Debüts seit Langem.“ BuzzFeed
Leseprobe zu „Falls ich dich überlebe“
Im Fluss
Am Anfang steht die Frage Was bist du?, sie ertönt außerhalb eures Vorgartens, du warst damals neun – vielleicht jünger. Diese Frage wird dir immer wieder gestellt, auf der Junior High und auf der Highschool, anschließend draußen in der Welt, in Strip-Clubs und Food Courts, am Telefon und bei diversen Aushilfsjobs. Man fragt fordernd. Verlangt eine sofortige Antwort. Die Frage bringt dich auf deinen präpubertären Füßen ins Wanken, einerseits, weil du sie nicht begreifst, andererseits, weil du selbst dann keine Antwort hättest, wenn du sie [...]
Im Fluss
Am Anfang steht die Frage Was bist du?, sie ertönt außerhalb eures Vorgartens, du warst damals neun – vielleicht jünger. Diese Frage wird dir immer wieder gestellt, auf der Junior High und auf der Highschool, anschließend draußen in der Welt, in Strip-Clubs und Food Courts, am Telefon und bei diversen Aushilfsjobs. Man fragt fordernd. Verlangt eine sofortige Antwort. Die Frage bringt dich auf deinen präpubertären Füßen ins Wanken, einerseits, weil du sie nicht begreifst, andererseits, weil du selbst dann keine Antwort hättest, wenn du sie begreifen würdest.
Oder steht Welche Sprache spricht deine Mutter? am Anfang? Gut möglich, dass diese Frage der Ursprung ist. Nicht weil es die erste wäre, die man dir stellt, sondern weil du wenigstens ansatzweise auf sie gefasst bist.
Diese Frage nervt dich sofort.
„Wieso redet deine Mutter so komisch?“, will euer Nachbar wissen.
Deine Mutter ruft von der Veranda, sie hat dich von diesem Ausguck mit Blick auf den abschüssigen Vorgarten gerufen, seit dir erlaubt wurde, mit den Nachbarskindern zu spielen. Sie ruft dich, weil du reinkommen sollst, nur findest du dieses Ritual inzwischen peinlich.
Vielleicht hast du gehofft, niemand würde es bemerken. Vielleicht hast du es selbst nie bemerkt. Vielleicht entgegnest du lahm: „Wie meinen Sie das: ›Welche Sprache‹?“ Vielleicht denkst du das auch nur. Am Ende murmelst du: „Englisch. Sie spricht Englisch.“ Und dann schleichst du mit gesenktem Kopf ins Haus.
In diesem Moment ist dir deine Mutter zum ersten Mal peinlich, und zugleich schämst du dich, weil du sie nicht verteidigt hast. Du bist feige, hältst nicht zu ihr, aber als Fremder zu gelten, ist noch schlimmer. Wenn du während deiner bisherigen paar Lebensjahre etwas gelernt hast, dann das.
Wir sind in Amerika, und wir schreiben die Achtziger. In der Schule, im Unterricht schwörst du der einzig wahren Fahne die Treue, den Stars and Stripes. Die morgendliche Hymne lautet Greatest Country on Earth. Sie ist ein Mantra, das euch täglich eingetrichtert wird, ein fester Bestandteil des Unterrichts – so unumstößlich, wie zwei plus zwei vier ergibt –, und was sich einprägt, nachdem du die Worte im Stillen oft genug wiederholt hast, ist die unausgesprochene Tatsache, dass alle anderen Nationen weniger wert sind, wenngleich diese anderen Nationen im Unterricht fast nie erwähnt werden.
Du glaubst daran.
Diese Botschaft lässt sich leicht verinnerlichen, nur ist dein Bruder, Delano, sind deine Eltern und fast alle Verwandten Jamaikaner. Als deine Cousine von Kingston nach Miami ins Cutler-Ridge-Viertel zieht, zu dir in die dritte Klasse kommt und den Treueeid auf die Fahne verweigert, gehst du auf Abstand. Im Stillen bist du froh, dass ihr unterschiedliche Nachnamen habt.
Wärst du besser informiert gewesen, als du zum ersten Mal gefragt wurdest, was du bist, dann hättest du sagen können: Amerikaner.
Du wurdest in den Vereinigten Staaten geboren, hast Dokumente, die das beweisen. Auf diese Tatsache, an der niemand rütteln kann, auf diesen in Stein gemeißelten Status, bist du stolz. Am vierten Juli schmetterst du Lee Greenwoods God Bless the U. S. A., und nachdem du in deinem neunten Sommer zwei Wochen auf der Heimatinsel deiner Eltern verbracht hast, singst du es noch inbrünstiger. Du findest das Leben auf der Insel in jeder Hinsicht nervig, auch was den allgemeinen Mangel an Klimaanlagen betrifft. Du magst Burger und Hotdogs lieber als irgendein Zeug mit Curry oder Jerk-Fleisch.
Als ihr wieder zu Hause seid, werfen dir deine Eltern vor, deine Sprechweise, vor allem aber dein Verhalten sei das eines typischen Yankees. Sollten sie unter Yankee einen Amerikaner verstehen, dann würde dich das nicht stören, im Gegenteil. „Ich spreche Englisch“, erwiderst du.
Das Patwah deiner Eltern, von anderen als unverständliches Kauderwelsch empfunden, klingt für dich ganz normal, nur dass es immer öfter mit Ermahnungen gespickt ist. Etwa, wenn deine Mutter auf Patwah meckert: „Auf den Boden kleckern, das könnt ihr, aber nicht aufwischen, wie?“
Und dein Bruder sagt: „Ich war’s nicht, Mummy.“
Und du sagst: „Ich habe das nicht getan, Mom.“
Und darauf sie: „Ja, und wer dann? Muss wohl ein Duppy gewesen sein.“
Der Duppy wird der Sündenbock für alle Ereignisse, die sich nicht erklären lassen, ob drinnen oder draußen. Der Duppy hat die Vase deiner Mutter zerdeppert und danach versucht, die Scherben zu kitten. Der Duppy hat das Zeugnis deines Bruders unter der Matratze versteckt. Der Duppy hat von deinem Vater Besitz ergriffen, er schleift ihn nach Feierabend in Bars und lässt ihn erst am nächsten Morgen heimkehren.
Und weil es schwierig ist, einen Duppy oder Geist, ja selbst einen erwachsenen Mann zur Ordnung zu rufen, müssen dein Bruder und du die Strafen ausbaden.
Als in der Schule das Erdkunde-Projekt angekündigt wird, bei dem jeder ein Land vorstellen soll, suchst du dir die Mongolei aus. Dir dämmert erst, dass Jamaika auch keine üble Wahl gewesen wäre, als sich eine Mitschülerin für die winzige Insel entscheidet.
Das Projekt beinhaltet die Zubereitung eines landestypischen Gerichts. Ihr seid in der vierten Klasse. Eure Mütter übernehmen das Kochen. Als sie sich am Tag der Präsentation versammeln, mit dunklen Ringen unter den Augen, weil sie sich bis spät in die Nacht mit ausländischen Rezepten herumschlagen mussten, fehlt ihnen die Kraft für Nettigkeiten, sie nicken einander nur schwach zu.
Als deine Klassenkameradin mit ihrer Präsentation Jamaikas beginnt, saugt deine Mutter so scharf Luft ein – ein Geräusch, das klingt, als würde man einen ultrastarken Klettverschluss öffnen –, dass einige Eltern zu ihr herumfahren. „Wenn du dich für zu Hause entschieden hättest“, flüstert sie dir zu, „hätte ich Reste mitbringen können.“
Am Career Day steht dein Vater vor der Klasse und stellt sich als Generalunternehmer vor. Oben auf der Tafel hängt ein Alphabet aus ausgeschnitten Großbuchstaben, es wölbt sich über seinen welligen, schwarzen Haaren. Er zieht dreißig Zentimeter seines Maßbands mit dem Daumen heraus und lässt es wieder in die Hülle schnellen. Das Klacken, mit dem es zurückschießt, sichert ihm die ungeteilte Aufmerksamkeit der Klasse. Dein Vater wiederholt den Vorgang mehrmals, dann macht er endlich den Mund auf. Deine Mitschüler und Mitschülerinnen halten erwartungsvoll den Atem an.
Seine Erklärung, Bäder zu renovieren, Verputz und PVC inklusive, erfolgt in breitestem Patwah, was hinten im Klassenraum für lautes Kichern sorgt. Dein Vater dehnt die Vokale, er spricht das „Th“ aus wie ein „D“, seine Wörter sind ebenso eigenwillig wie schlicht, sein Satzbau ist ungewöhnlich.
Deine Lehrerin ermahnt die Klasse, still zu sein, aber während sie deinem Vater lauscht, legt sich ihr Gesicht in erheiterte Falten, sie nickt im Takt des Patwah mit dem Kopf. Du behältst ihre Wangen im Blick, denn die Farbe, die diese annehmen, lässt Rückschlüsse auf das Ausmaß des Desasters zu. Bleibt es bei dem hellen Rosa – ein leichtes Erröten, ein rosiger Hauch, ein Ballettschuh-Ton – ist es halb so wild, dann wird sie die Sache mit der Zeit vergessen. Als ihre Röte zusehends tiefer wird, so tief, dass sie an Violett grenzt, wird dir klar, dass es eine Katastrophe ist.
Du fragst dich, warum du nicht darauf bestanden hast, dass deine Mutter vor die Klasse tritt. Sie kann ihre Aussprache den amerikanischen Hörgewohnheiten besser anpassen, das muss sie täglich bei der Arbeit tun.
Anfang der Woche hast du sie gebeten, etwas mehr über ihren Job als Sekretärin zu erzählen. Deine Mutter sitzt auf der Bettkante und erklärt, sie sei im Büro eines Unternehmens tätig, das Flugzeugturbinen in alle Welt verschiffe. Der Saum ihres Nachthemds schimmert, als sie quer durchs Zimmer springt, um den Globus von deinem Bücherregal zu holen. „Hierhin, siehst du? Und dahin. Und dorthin.“ Sie kniet vor deinem Bett, zeigt auf Deutschland, dann auf Brasilien, danach auf die hawaiianische Inselgruppe und singt: „Wir liefern in alle Winkel der Welt“, wobei sie Zeige- und Mittelfinger über Ozeane und sattgrüne Kontinente tanzen lässt, um anschließend gegen deine Nase zu tippen.
„Wir?“, fragst du. „Du fährst ja nicht dorthin, oder?“
Deine Mutter blinzelt zweimal, dann stellt sie den Globus wieder aufs Regal. „Eines Tages“, sagt sie. „Eines Tages, wenn ihr alle groß seid.“ Und sie fügt hinzu: „Du solltest deinen Vater bitten, von seiner Arbeit zu erzählen. Sie finden ihn bestimmt spannender als mich.“
Im Geschichtsunterricht der fünften Klasse wird die Gründung der Vereinigten Staaten behandelt. Ihr erfahrt auch etwas über ein Thema, das schlicht Sklaverei genannt wird. Diese wird knapp und verwässert behandelt. Unter dem Strich heißt es: Menschen, die eigentlich herzensgut waren, haben einen schlimmen Fehler begangen. Es heißt: Das ist ewig lange her. Es heißt: Der ehrliche Abe und Harriet Tubman und Martin Luther King haben diese scheußliche Sache geradegebogen. Es heißt: Heute sind alle gleich.
Während dieser Unterrichtsstunde wird deine Klasse von einem Unbehagen erfasst; ihr findet alle, dass es eine schreckliche Sache war. Ihr ahnt dunkel, dass manche Mitschüler und Mitschülerinnen möglicherweise von jenen Menschen abstammen, die diese Schandtaten begangen haben, manche von den Opfern. Und ihr ahnt noch dunkler, dass einige von beiden Gruppen zugleich abstammen. Fühlst du dich von diesem Land, das du so liebst, etwa ungerecht behandelt?
Der transatlantische Sklavenhandel ist für dich nichts Neues, denn dein Vater verdammt das Land deiner Geburt bei jeder Gelegenheit. In seiner Version der Unterrichtsstunde erzählt er dir selbstbewusst: „Darum sind die Schwarzen Menschen so, diese Idioten. Keine zwei Sekunden aus der Sklaverei befreit, und schon müssen sie zivilisiert tun? Ich sage dir, Junge, Weiße sind böse, vergiss das nie.“ Sein Vortrag gipfelt in den Worten, in Jamaika sei die Sklaverei Jahrhunderte früher abgeschafft worden als in Amerika, womit er, wie du später herausfindest, Jahrhunderte danebenliegt.
Schwarze beider Nationen, die er für unehrenhaft hält, bezeichnet er mit einem jamaikanischen Wort: Butu. Wenn man etwas anstellt, das ihm zur Schande gereichen könnte, sagt er stets: „Du führst dich manchmal auf wie ein Butu.“
„Was bin ich?“, hast du deine Mutter mehrfach gefragt. Die Frage wurde dir so oft gestellt, dass du begonnen hast, Antworten zu suchen.
Ihre Antwort klingt einstudiert, ist aber nicht so eindeutig wie erhofft. Deine Mutter erläutert, du seiest eine bunte Mischung. Sie zählt Länder auf, mehrere Länder, denen sie Urgroß-Diese und Urgroß-Jene zuordnet. Deine Mutter versieht diese Vorfahren selten mit Namen, du bringst sie also leicht durcheinander. „Unser Nachname kommt aus Italien“, sagt sie, „über England.“ Sie zählt überwiegend europäische Länder auf, und obwohl sie Afrika stets hinzufügt, als wäre es ein Nachtrag oder ein einzelnes Land, spricht sie nie von der Hautfarbe.
Du willst eine Antwort, die aus einem Wort besteht.
„Bin ich Schwarz?“, fragst du. Darum geht es dir. Die Frage der Hautfarbe ist in deine Welt eingebrochen, abrupt und gewaltsam, und du befürchtest am meisten, andere könnten etwas in dir sehen, das dir selbst nicht bewusst ist.
Wenn Kinder diese Frage stellen, nimmst du an, ihre beschränkten Kenntnisse seien mangelnder Lebenserfahrung geschuldet. Aber nun wollen auch Erwachsene eine Antwort hören. Manche Lehrer glotzen dich nur an, andere fragen, wie es kommt, dass du so gut Englisch sprichst.
In der Überzeugung, sie könnten zwischen deiner Sprache und deinen Eltern unterscheiden, antwortest du zunächst: „Ich bin Amerikaner.“ Diese Antwort verwirrt sie noch tiefer. Später wird dir klar, dass sie etwas ganz anderes meinen, zumal, wenn es sich um Lehrer handelt, die deinen Eltern nie begegnet sind.
„Sind wir Schwarz?“, fragst du deine Mutter.
Sie ist plötzlich fahrig. Sie erschaudert am ganzen Körper, die helle, fleckige Haut erzittert, und sie führt die Genealogie der Familie rasch zu Ende, bis zu den letzten ungesicherten Details. „Die Mutter des Vaters deines Vaters war Jüdin. Die Mutter deiner Großmutter war Irin“, doziert sie. „Der Vater deiner Großmutter“, sie senkt ihre Stimme zum Flüstern, „war angeblich ein Araber.“
Du starrst sie verständnislos an und meinst: „Du hast meine Frage nicht beantwortet.“
In ihrer Aufregung wird sie zornig. „Puh. Eine so dumme Frage habe ich noch nie gehört, seit ich in Amerika bin. Wenn sie dir gestellt wird“, meint sie, „dann sagst du, du bist ein bisschen dies und ein bisschen das.“
Du spürst, ihre Antwort ist endgültig. Und anders als erhofft, hat sie wieder nicht mit einem Wort geantwortet, kein schlichtes Ja oder Nein.
Den wenigen eindeutig Schwarzen Kids auf der Schule bist du ein Rätsel. Sie gehören zu den Ersten, die von dir verlangen, dich zu bekennen. „Bist du Schwarz?“, wollen sie wissen, als würde sich Zugehörigkeit über Hautfarbe definieren.
Deine Haut ist von einem relativ hellen Braun. Bei deinen Eltern ist es genauso. Auch bei ihren Eltern. Deine Urgroßeltern sind auf den Fotos im Familienalbum nur in Schwarz-Weiß oder in Sepiatönen abgebildet, ihre Hautfarbe ist uneindeutig. Manche wirken, als könnten sie bei Die Jeffersons einen Gastauftritt haben, andere, als kämen sie eher für All in the Family infrage. Außerhalb deiner Familie ähneln dir deine engsten Schulfreunde, Jose und Luis, am meisten. Aber wenn sie zwischen Englisch und Spanisch wechseln, fühlst du dich ausgeschlossen. Und wenn sie, eure Lieblingsrocksongs schmetternd, ihre Haare mit ruckartigen Bewegungen vor- und zurückschütteln, wird dir schmerzhaft bewusst, dass du deine Haare nicht schütteln kannst, weil sie sowohl zu kurz als auch zu kräftig sind.
Zu allem Überfluss teilt dir Julie, deine Nachbarin, mit, ihr dürftet – nach fünfjähriger Freundschaft – nicht mehr miteinander spielen. „Weil deine Familie nicht an Gott glaubt.“
„Natürlich glauben wir an Gott“, erwiderst du überzeugt.
Sie entgegnet schulterzuckend: „›Jamaikaner tun das nicht‹, sagt mein Dad.“
Eines Tages ermahnt eure Mutter deinen Bruder und dich: „Schleppt mir ja kein Mädchen mit krausen Haaren an.“ Um sie zu verteidigen – oder noch tiefer zu blamieren –, soll gesagt sein, dass ihre Liste unerwünschter Mädchen so lang ist, dass ihr euch fragt, ob ihr überhaupt je ein Mädchen anschleppen dürft. „Schleppt mir ja keine Chinesin an“, ermahnt sie euch, als ihr auf der Middle School seid. Beim Anblick deiner kraushaarigen, kaffeebraunen panamaischen Abschlussball-Partnerin verbarrikadiert sie sich im Schlafzimmer. Das Mädchen verschlägt ihr schlicht die Sprache. Und nach dem Uniabschluss wird sie dich anflehen: „Bitte, kein weißes Mädchen, das musst du mir versprechen.“
Du bist in der Fünften, und die erste Ermahnung verwirrt dich. Was kennzeichnet krause Haare in den Augen deiner Mutter? Du betrachtest ihre Haare – fein wie die Gitarrensaiten-Haare von Jose und Luis –, danach deinen üppig gelockten Schopf. Verrückt, wie kraus deine Haare sind. Wer, fragst du dich, wird dich je zu Hause anschleppen?
Der Duppy kehrt zurück, er veranstaltet noch mehr Unsinn als früher. Er versteckt deinen Vater in einer Bar, bei einem Saufgelage, in einer Dimension, die unerreichbar ist für deine Mutter. Bevor er wiederauftaucht, voller J’ouvert-Schminke, wird er von eurer Mutter als vermisst gemeldet. Sie ruft bei der Polizei an, und du hockst mit deinem Bruder dicht genug daneben, um hören zu können, wie der Beamte fragt: „Ma’am, ich verstehe kein Wort. Spricht bei Ihnen auch jemand Englisch?“
Sie reicht dir das Telefon, beginnt zu schluchzen. Der Mann bittet dich um eine Beschreibung deines Vaters.
„Eins dreiundachtzig“, antwortest du. „Mager.“
„Schwarz oder weiß?“, will der Mann wissen.
Du schaust deinen Bruder an. „Nicht weiß“, sagst du.
„Also Schwarz.“
„Braun“, sagt dein Bruder.
„Ist dein Vater oft verschwunden?“
„Wie oft ist oft?“
Die körperlose Stimme erklärt: „Überhaupt mal.“
„Oh“, sagst du. „Dann viel zu oft.“
An dem Tag, als du in die Sechste kommen sollst, reißt ein Hurrikan namens Andrew euer Hausdach auf, als wäre es der Deckel einer Suppendose von Campbell, und schüttet eine Portion des Atlantiks in Schlafzimmer und Wohnzimmer – also in alle Zimmer –, lässt Teppiche, Trockenwände und Hartfaserplatten aufquellen, tränkt alles mit salzigem Meerwasser. Er löst die rotbraunen Glasfaserplatten von Wänden und Decken und verteilt die Innereien des Hauses auf dem Rasen. Der Hurrikan zertrümmert das Haus eurer Nachbarn und parkt einen Schleppkahn ganz hinten in der Straße.
Also verlasst ihr Miami-Dade und sucht Zuflucht in Broward County, wo sich der Arbeitgeber deiner Mutter vorübergehend eingerichtet hat.
Auf der neuen Schule freundest du dich wieder mit braunhäutigen Jungs an. Wie du erfährst, sind es Puerto Ricaner. Einer, Osvaldo, nimmt dich unter seine Obhut. Du sitzt mit seiner Truppe in der Mensa, und während sie Spanisch sprechen, starrst du dein Tablett mit den Fächern für Erbsen und Möhren an. Wenn du ganz still bist, nehmen sie dich bei diesen Gelegenheiten nicht wahr – dann bist du unsichtbar. Und wenn dich niemand wahrnimmt, merkt auch niemand, dass tú no entiendes, dass du nicht dazugehörst. Osvaldo scheint aufgefallen zu sein, dass du kein Spanisch sprichst, doch er sieht darüber hinweg, schaltet auf Englisch um.
Kann sein, dass sie nichts merken, weil du deinen Kopf inzwischen kahl rasierst, deine verräterisch drahtigen Locken kappst, kann sein, dass du diesen Jungs ähnelst, obwohl ein bisschen mehr Afrika durch deine Adern fließt; oder sie nehmen an, du hättest kapiert, dass man sich auf dieser Schule und in eurem Alter an Seinesgleichen hält. Jedenfalls dämmert dir zu spät, dass sie dich für einen Puerto Ricaner halten.
Sie reißen Witze über Weiße: „Weiße stinken wie Cockerspaniel. Aber nur, wenn sie nass sind.“
Sie lachen über Schwarze: „Warum stinken Schwarze so schlimm? Damit sie auch von Blinden gehasst werden können.“
Schließlich will einer beim Mittagessen verächtlich von dir wissen, warum sich deine Eltern nie die Mühe gemacht haben, dir Spanisch beizubringen. Du glaubst, Osvaldo würde eingreifen, aber auch er wartet auf eine Antwort.
„Weil sie kein Spanisch sprechen“, sagst du.
Die Jungen tauschen verwirrte Blicke. „Auch nicht? Haben sie’s nicht von deinen Großeltern gelernt?“
„Meine sehr jamaikanischen Eltern sprechen nur Englisch“, stellst du klar.
„Halt mal“, sagt Osvaldo. „Du bist also Schwarz?“
Problematisch ist nicht nur, dass du dich zu erkennen gegeben hast, sondern auch, dass diese Gruppe eine andere Gruppe befehdet. Beide reklamieren bestimmte Abschnitte des Schulhofs für sich und geraten manchmal unter einer nahen Überführung aneinander. Du bist noch so neu auf dieser Schule, dass du nicht weißt, was Sache ist, aber wie es der Zufall will, sind die Rivalen zwei Inseln weiter zu Hause: auf Jamaika. Diese Information ist das Abschiedsgeschenk Osvaldos. Ab jetzt bist du unerwünscht an diesem Tisch.
Die Jamaikaner, von denen einige in deiner Jahrgangsstufe sind, ähneln weder deiner Familie noch euren Freunden von der Insel, die gelegentlich zu Besuch kommen. Und ihre skeptischen Mienen sagen dir, dass du niemandem ähnelst, den sie als Freund gelten lassen. Du fragst dich, ob es zwei Sorten Jamaikaner gibt.
Der Unterschied geht aus den Bezeichnungen hervor, mit denen du von ihnen und ihren amerikanischen Pendants belegt wirst: Heller Schwarzer, brauner Weißer. Manchmal nennen sie dich schlicht Spanier. Nachdem du aus der Enklave der Braunhäutigen geschasst wurdest, klammerst du dich in deiner Einsamkeit panisch an deine Verletzlichkeit.
Dein Bruder, Delano, der dir vier Jahre Erfahrung voraushat und merkt, dass du immer tiefer in diesem Schwellenzustand versackst, stellt die Sache schließlich klar: „Du bist Schwarz, Trelawney. In Jamaika war es anders, aber hier ist das nun mal so. Hier gibt’s nur Entweder-oder.“
Und mit einem Grinsen fügt er hinzu: „Sorry, dass ich deine Illusionen zerstören muss.“
Du versuchst, mit deinen jamaikanischen Klassenkameraden Freundschaft zu schließen. Das bringt ständige Demütigungen mit sich, darunter Kreuzverhöre zu jamaikanischen Städten („Jeder kennt Kingston. Das zählt nicht.“), zu deinem Patwah („Weißt du, was ein batty boy ist, batty boy?“) und zu den jamaikanischen Tänzen, die du beherrschst („Du kannst den Bogle? Lass mal sehen!“). Bis du kapierst, dass sie dich nie akzeptieren werden, zumal nach deiner Zeit bei den Puerto Ricanern. Beide Gruppen wetteifern darum, dir im Flur ein Bein zu stellen oder das Essenstablett aus deiner Hand zu schlagen.
In der Mittagspause verziehst du dich in die Science-Fiction- und Dystopie-Abteilung der Bücherei, der einzige Ort, an dem du dich sicher fühlst. Diese doppelte Verbannung führt dir eines klar vor Augen: Wenn du irgendwas bist, dann ein schwarzes Schaf.
Dein Bruder beginnt, an den Wochenenden mit eurem Vater nach Miami zurückzufahren, die abgenutzte, lederne Werkzeugtasche über der Schulter wie den Gürtel eines Meisters im Schwergewicht. Seine Bizepse wachsen und straffen sich über Nacht, als hätte man mit einem Schuhlöffel Tennisbälle unter seine Haut gehebelt. Und in seinen Schultern scheinen Softbälle aufzuquellen. Seine Haut wird dunkler, sie nimmt unter dem Bart, der auf seinen Wangen sprießt, einen Terrakottaton an, seine Wangenknochen werden in der Sonne aschgrau.
„Dachdeckerarbeiten“, erklärt er. „Fiese Sonne, verstehst du?“ Das sagt er grinsend auf Patwah, und als er mit einem Daumen über die Barthaare auf seinem Kinn streicht, strafft sich die Haut über den Knöcheln.
Unter Anleitung eures Vaters leistet er Aufbauarbeit: der Wiederaufbau des Hauses, des Lebens, das der Hurrikan Andrew in Trümmer gelegt hat. Er bastelt an seiner Männlichkeit.
Sie verschwinden am Freitagabend und kehren am Sonntag zurück. Angeblich schlafen sie in einem Zelt, das sie in den Trümmern der Küche oder des Wohnzimmers aufschlagen, je nachdem, wo sie gerade arbeiten.
Du bittest deinen Vater, dich mitzunehmen, dir zu erlauben, beim Wiederaufbau zu helfen.
„Das ist kein Kinderkram, Junge“, sagt er. Seine Entscheidung ist unumstößlich.
Am Wochenende sitzt du vor deiner Sega-Konsole und schlägst alles Mögliche tot: Vampire und Außerirdische und die Zeit.
Als dein Bruder eines Sonntagabends euer Zimmer betritt, stinkt er. Die vom Schweiß hinterlassene Salzkruste ist so dick, dass man sie von seinen Armen kratzen könnte. Würde man seine Klamotten ausklopfen, dann würde einen die Gipswolke, die dabei entstände, komplett einnebeln. Sein warmer Atem riecht nach Bier, nach Eintopf. Er klettert ins obere Etagenbett und klappt dort zusammen, ein brauner Stiefel ragt über die Bettkante. Du fragst dich, ob er es morgen zum Unterricht schafft, sagst aber nichts.
Du fragst bloß: „Wann seid ihr fertig?“ Das fragst du an jedem Sonntagabend. Und die vage, beschwichtigende Antwort lautet stets: „Bald.“
Dies deutest du sehr optimistisch und wiederholst es vor deinen Lehrern, vor allen, die es hören wollen. „Dauert nicht mehr lange“, sagst du. „Hier sind meine Hausaufgaben. Sie können Sie gern benoten, aber es wäre möglich, dass ich am nächsten Montag nicht wiederkomme. Ich kann jeden Tag verschwinden.“
Und wenn du am Montag doch in die Schule zurückkehrst, heißt es immer: „Na, noch eine Woche bei uns, Miami?“
Du starrst die Tafel an und faltest deinen Blick nach innen, um den Ausdruck deiner Augen, deinen Tonfall zu verbergen. „Ist bald so weit“, erwiderst du monoton.
Beim nächsten Mal wird die Frage Wie lange noch? von deinem Bruder mit den gegähnten Worten beantwortet: „Wir sind fast fertig. Wird echt schön, Bruderherz. Besser als zuvor. Stabiler.“
„Hoffentlich bald. Ich gehör’ hier nicht hin.“
„Fakt ist“, sagt Delano und dämpft ein Rülpsen hinter der geballten Faust, „dass du nicht zurückgehst. Nicht dahin.“
„Nicht dahin? Was soll das heißen?“
Er schweigt eine Weile, will vielleicht warten, bis er nüchterner ist, und als er begreift, dass er sich verplappert hat, fügt er hinzu: „Dad hat es mir an diesem Wochenende gesagt. Du und Mom, ihr kommt nicht mit uns.“
Am Tag des Umzugs verabschiedet sich dein Vater mit einem festen Händedruck und sagt: „Bald, ja?“ Seine Miene deutet an, dass er bei dieser Gelegenheit mehr sagen müsste, nur fällt ihm gerade nichts ein.
Deine Mom kann sich kaum von Delano losreißen, und als sie ihn aus ihrer Umarmung entlässt, stürmt sie in die Wohnung, ohne euren Vater eines weiteren Blickes zu würdigen. Dein Bruder verabschiedet sich mit einem Faustgruß von dir. „Auf bald, Alter“, sagt er und schenkt dir ein Lächeln. Es ist eine Geste. Alles halb so schlimm, soll diese Geste besagen, obwohl es katastrophal ist, wie ihr wisst.
Eine Woche, bevor du in die Siebte kommst, zieht deine Mutter mit dir wieder ins Miami-Dade-County, nach Kendall, wo niemand Amerikaner ist. Du könntest als Gringo gelten, sogar als Schwarzer Amerikaner, aber mit der Solidarität unter den Stars and Stripes ist es vorbei.
In der Schule verspotten dich Schwarze Mädchen in den Fluren als rehbraun. Die Jungs machen sich darüber lustig, wie du redest, sie nennen es weiß. Du willst nicht weiß sein, natürlich nicht, du lehnst es ab. Du schwörst Schwarz die Treue. Hörst die Musik, trägst die ausgebeulten Klamotten.
Die beliebtesten Kids an deiner überwiegend lateinamerikanischen Middle School sind Schwarze. Niemand, so die allgemeine Meinung, ist so charismatisch wie sie, niemand ist so sportlich wie sie, ihnen geht alles am Arsch vorbei. Du willst an diesem Schwarzsein teilhaben, an dieser geheimnisvollen Anziehungskraft. Du imitierst diese Jungs. Du ahmst nach, wie sie reden, wie sie gehen. Auf dem Heimweg von der Schule beginnst du zu schlurfen und zu humpeln und danach zu hoppeln und zu humpeln, dann zu hoppeln und danach zu humpeln. Dein neuer Gang trägt nicht zu deiner Integration bei, sondern erweckt den Eindruck, du hättest irgendwelche Probleme, aber weil niemand damit punkten kann, ein behindertes Kind zu mobben, hoppelst du weiter. Du entwickelst die Angewohnheit, Wörter zu dehnen und Konsonanten auszulassen, ganze Silben zu verschlucken, denn Scheiß auf die Schwarzen, wenn sie dich nich’ woll’n.
Die Vorteile sind simpel: Wenn du eine Mitgliedskarte hast, kommt dir niemand mehr dumm. Die Gangs im Viertel, meist Latinos aus der Vorstadt-Mittelschicht, sind den Schwarzen zahlenmäßig weit überlegen, hüten sich aber vor ihnen, weil sie Brüder, Cousins und Onkel in Overtown und Liberty City und im Knast haben, alle berühmt dafür, Menschen getötet zu haben. Dir wird klar, dass es dein Leben retten könnte, Schwarz zu sein.
Nur stellst du dich zu blöd an.
Wenn du dummen Scheiß machst, ist das peinlich. Wenn sie dummen Scheiß machen, ist das ansteckend.
Sie reden sich nur mit Nigga und Dog an. Dann greifen die Lationos Nigga und Dog auf. Irgendwann sagen auch Weiße Nigga und Dog, wenngleich verhalten und manchmal erst, nachdem sie sich umgeschaut haben. Kann sein, dass du es anfangs ironisch meinst, aber du machst mit.
Du beginnst mit My bad und kicherst. Du findest es rasch natürlicher als Sorry. Jahre später bekommst du mit, wie es in Friends und in den Abendnachrichten benutzt wird.
Wenn dich jemand fragt: „Was bist du?“, lautet die simple Antwort jetzt: „Schwarz.“ Und man wird sie dir bald abkaufen.
Deine Mutter macht um siebzehn Uhr Feierabend und ist gegen neunzehn Uhr zu Hause. Der von Andrew erzwungene Umzug ihres Arbeitgebers nach Fort Lauderdale hat sich als dauerhaft und unumkehrbar erwiesen. Das Pendeln raubt ihr viel Lebenszeit, also hört sie unterwegs die Kassette Italienisch leicht gemacht! Seltsamerweise wird ihr amerikanischer Akzent dadurch stärker. Sie schläft abends vor dem Fernseher ein, hat kaum noch genug Kraft, um zu fragen: „Alles okay bei dir?“
„Alles okay“, antwortest du, egal wie es steht.
„Und deine Noten?“
„Sind okay.“
„Und deine Freunde? Schon Freunde gefunden?“
„Meine Freunde sind okay.“
Das Haus, das deine Mutter erworben hat, ist größer als das, in dem ihr als Familie gewohnt habt, aber viel kahler. Sie staffiert die Wohnbereiche an den Wochenenden mit Sesseln, Kunstwerken und Teppichen aus, aber die Zimmer wirken trotzdem leer. Ein drittes Schlafzimmer, deinem Bruder vorbehalten – sicher der eigentliche Grund für eure Rückkehr nach Miami-Dade –, wird so gut wie nie benutzt.
Obwohl sich das Familieneinkommen durch den Abschied deines Vaters halbiert hat, kann sie sich das Haus durch ein wundersames Darlehen mit flexiblen Raten leisten. „Es ist eine Investition“, sagt sie zu dir. „Im Moment ist ein Kauf ideal.“
„Warte“, sagst du. „Hast du das Haus jetzt gekauft, oder gehört es der Bank?“
„Ich habe es gekauft“, antwortet sie. „Und es gehört der Bank.“
Dein Vater kommt unregelmäßig vorbei und nimmt dich nur einmal zu dem Haus mit, das er mit deinem Bruder bewohnt. Unterwegs läuft Radio. Er ist ein Paradebeispiel für aktives Zuhören. Der Titel der Sendung lautet „Rassenkonflikte“.
Der Moderator sagt:
„Ich setze auf die Lateinamerikaner, denn diese Menschen haben ein bemerkenswertes Talent dafür gezeigt, an jeden gewünschten Ort zu gelangen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Grenzen und Hindernisse zu überwinden ist kein Problem – sie kommen überallhin. Sie halten lange ohne Wasser durch und sind bereit, Jobs anzunehmen, die andere verschmähen. Geschirrspülen, gärtnern …“
Dein Vater klatscht auf sein Knie und lacht heiser. „So ein Idiot“, sagt er, dann stellt er lauter. Er glättet seinen Schnurrbart mit zwei Fingern und reibt sich das Lächeln aus dem Gesicht, als er merkt, dass du ihn betrachtest.
„Die Schwarzen – und ich weiß, Sie werden mich für rassistisch halten – aber die Schwarzen haben keine Chance. Null. Und ich sage ihnen auch wieso. Sie können nicht schwimmen. Das ist erwiesen. Fast die Hälfte aller Ertrunkenen zwischen fünf und vierundzwanzig sind Schwarze, das besagt eine Studie in The American Journal of Public Opinion.“
„So ein Quatsch.“ Dein Vater stellt wieder leiser. Zehn Sekunden später lacht er und sagt zu sich selbst: „Aber gut, vielleicht hat der Mann nicht ganz unrecht.“
Als du das Haus deines Vaters betrittst, stellst du fest, dass der graublaue Teppich im Wohnzimmer strahlend weißen Fliesen gewichen ist. Die Fruchtsaftflecke und borstigen Stellen auf der Landkarte deiner Kindheit sind mit dem Teppich verschwunden. Am auffälligsten ist der Durchbruch zwischen der Küche und deinem alten Schlafzimmer. Sie haben es in eine Art Essbereich verwandelt. Der naturbelassene Esstisch wird von einem grün-weißen Gartenstuhl und einem weinroten Schreibtischstuhl flankiert. Das Haus ist tadellos sauber, abgesehen von den Kaffeebechern und den Zeitungen auf der unbehandelten Tischplatte.
Dein Bruder, im vorletzten Highschooljahr, lehnt mit bloßem Oberkörper am Plastikgeflecht des Gartenstuhls und überfliegt die Kleinanzeigen. Er ist so hager, dass sich die Rippen abzeichnen, ähnelt eurem Vater noch mehr.
Während du dich umschaust, betrachtet dein Vater missbilligend deine Klamotten; er horcht bei Wörtern auf, die du benutzt oder auch nicht benutzt. Du weißt nicht genau, welche es sind, obwohl du in seiner Gegenwart manchmal Slang verwendest. „Hängst du etwa mit den Schwarzen Kids ab, Junge?“, fragt er.
Du schaust zu deinem Bruder, der die muskulösen Schultern abwechselnd hochzieht und sinken lässt und weiter Stellenanzeigen einkringelt.
„Du wirst immer mehr zu einem Yankee-Butu“, sagt dein Vater.
„Du hast mich benutzt, um eine Greencard zu kriegen, also beschwer dich nicht“, entgegnest du. „Ich hab’s mir nicht ausgesucht, hier geboren zu werden.“ Du kennst deine Position auf dieser Welt inzwischen besser, wie du sie ändern könntest, weißt du allerdings nicht so genau.
Auf der Highschool fragen die Lehrer nicht mehr, wie es kommt, dass du so gut Englisch sprichst. Sie richten sowieso kaum noch Fragen an dich, außer einmal, als man dir vorwirft, plagiiert zu haben, weil dein naturwissenschaftlicher Aufsatz zu gebildet klinge. Du redest und kleidest dich wie ein Schwarzer, schreibst aber weiß, ein Widerspruch, den du erklären musst.
Dir dämmert, dass du von der Schule fliegen könntest, weil du dir die Redeweise der Schwarzen angeeignet hast.
Dein Lehrer, Mr Garcia, zwingt dich, den Aufsatz noch einmal zu schreiben, damit er so klingt, als hättest du ihn tatsächlich selbst verfasst. Also schreibst du alles neu: Niggas wollen wissen wieso Niggas krepieren, wenn Kugeln fliegen. Das ist so, sagt Newton, weil Scheiß, der in Bewegung ist, in Bewegung bleibt. Der Nigga war mal ein richtig schlauer Nigga.
Dein überarbeiteter Aufsatz beschert dir ein fettes Häkchen und eine Vier minus.
Als im Februar die Gräuel thematisiert werden, die in Amerika an den Schwarzen verübt wurden, nickst du, schaltest dann ab und denkst: Das ist nicht meine Geschichte. Damals waren meine Vorfahren nicht hier. Zugleich kultivierst du eine Verachtung für Amerika, was gar nicht nötig wäre, weil Amerika wie von selbst für Verachtung sorgt. In irgendeinem Winkel deines Gehirns ist dir klar, dass du diese Verachtung empfindest, weil du die amerikanische Geschichte für deine Geschichte hältst.
Du hoffst dennoch, jenseits von Amerika eine angenehmere Alternative zum unterdrückungsfixierten Narrativ der Menschen der afrikanischen Diaspora zu finden. Aber du entdeckst bestenfalls Schlupflöcher in der Definition dessen, was Schwarz ist, Begriffe wie Mischling oder Mulatte, semantische Fallschirme, die es dir erlauben könnten, der Klassifizierung als Schwarzer zu entrinnen. Du lehnst diese Begriffe ab und erfindest eigene: Halbafrikaner und Heller Schwarzer.
Wenn du Jungen mit deinem oder einem dunkleren Teint begegnest, mit krauseren Haaren, volleren Lippen und breiterer Nase, die sich an ihr puerto-ricanisches oder dominikanisches Erbe klammern, um behaupten zu können: Ich bin kein Schwarzer, ich komme aus der Dominikanischen Republik, dann beschimpfst du sie zusammen mit deinen Freunden als Verräter. Als Schwarze, die sich selbst hassen. Denn Schwarze, so deine Meinung, müssen stark und einig sein.
Eines Tages – die Medien haben über eine endlose Folge rassistischer Übergriffe berichtet – zieht eine Truppe afroamerikanischer Jungs mit Rufen wie chico und oye an dir vorbei, und du beobachtest sie, hältst Ausschau nach der Person, auf die sie es abgesehen haben, und denkst: Irgendjemand ist gleich fällig, ohne zu kapieren, dass sie dich im Visier haben. Ein Dutzend Hände rammen dich gegen einen Maschendrahtzaun, sie schubsen dich herum, als wollten sie das Schwarz aus deiner Haut schütteln, um sich mit vollem Recht an deinem Weiß austoben zu können.
Bevor jemand zuschlägt, schlendert Shells, ein gemeinsamer und eindeutig Schwarzer Freund vorbei und rettet dir den Arsch. „Nee, der ist cool“, sagt Shells unverbindlich. Aber es genügt.
Wie kommt es, dass dein Schwarzsein so wenig überzeugend ist?
Warum kann man nicht als Schwarz gelten, wenn man Spanisch spricht? Warum kann man nicht als Schwarz gelten, wenn man von einer Insel in der Karibik kommt?
Das würdest du gern wissen, ernsthaft, weil einige Jamaikaner aus deinem Umfeld seit geraumer Zeit Ähnliches behaupten. „Kulturell gesehen sind wir anders“, sagen sie. Du kennst diese Einstellung aus deiner Familie. Sie ist inzwischen so weit verbreitet, dass dir sogar afroamerikanische Freunde damit kommen.
Im Lagerhaus, wo du jobbst, fragt dich ein weißer Kollege, ob du ihm beim Wegniggern einer Palette helfen kannst.
„Findest du den Begriff in meinem Fall korrekt?“, fragst du.
„Kann dir doch egal sein. Du bist kein Schwarzer. Du bist Jamaikaner“, meint er. „Ein jamaikanischer Freund hat mir den Unterschied erklärt.“ Wäre schön, wenn sein Freund dir diesen Unterschied auch mal erklären könnte.
Schwarze Amerikaner sind die einzigen Schwarzen. Schwarzer als Afrikaner. Schwarz auf die (gesenkte Stimme) fiese Art.
Während du immer mehr darüber erfährst, was es bedeutet, ein Schwarzer in Amerika zu sein, beschließt du, dich doch noch mit deinem jamaikanischen Erbe zu befassen.
Du beginnst mit simplen Dingen.
Auf einmal magst du alles mit Curry und Jerk-Fleisch. Deine Flagge, bis dahin rot, weiß und blau, leuchtet jetzt in Gold, Grün und Schwarz. Du stopfst deine Schubladen mit Bandanas und Armbändern in den jamaikanischen Nationalfarben voll. Deine Ein-Wort-Antwort lautet jetzt Jamaikaner, denn du findest sie offener, allumfassender.
Außerdem: Wenn du Amerikaner ergänzt hast, weil die Antwort Schwarz nicht zufriedenstellte, schüttelten die Fragenden stets den Kopf und sagten: „Nein, du Idiot. Woher kommen deine Eltern? Das meine ich.“
Jamaika ist die Lösung. Präziser geht’s nicht.
Trotzdem entgegnet die Hälfte der Leute, deren Frage Was bist du? mit Jamaikaner beantwortet wird: „Du klingst aber nicht jamaikanisch. Wenn du Jamaikaner bist, wieso hast du dann keinen Akzent?“
Du steigst tief ein. Nicht Shaggy-Mr.-Lover-Lover-Tralala-Radio-tief. Eher Capleton-More-Fire-Mixx-96-Underground-Radio-tief. Panyard-Warehouse-Tanzclub-tief. Du stehst nicht auf Rap, außer Kool Herc, ein Yardie, war als erster Hip-Hop-tief. Oder die Mom von B. I. G. wäre Jamaika-tief. Und so tief wie er war kei-
ner.
Du bist kein Rasta, quasselst aber Prinzipien-tief. Du betest nicht zu Selassie, bist aber Marcus-Garvey-tief. Du brüllst Zur-Hölle-mit-Bush, giltst aber nur als Colin-Powell-tief.
Bully-Beef-tief. Samstags-mach-ich-Chocho-Suppe-tief. Du isst Marie-Patties-und-Sangos-tief, also isst du in der Colonial, also bist du Akee-und-Klippfisch-tief. Fisch-und-Festival-tief. Johnnycake-und-Fritters-tief.
Du bist Ich-weiß-von-Seaga-gegen-Manley-tief, du bist JLP-gegen-PNP-tief, wie in Red-Stripe-gegen-Heineken-tief. Du bist Tanz-auf-den-Tischen-Bayside-Hut-Rhythmus-tief.
Tief wie: Wieso-machen-die-Wayans-das-mit-uns?-tief. Tief wie: Du-bibberst-mit-Srewface-in-Marked-for-Death-tief.
Wenn du in Miami bist, sagen wir in der Dolphin Mall, und von einer Kassiererin auf Spanisch angesprochen wirst, erwiderst du: „Sorry, ich kann kein Spanisch“, und lässt deine Standarderklärung für das Defizit vom Stapel, und bist beinahe beleidigt, als sie meint: „Sie sehen aber nicht jamaikanisch aus.“
„Und wie sehen Jamaikaner aus?“
Daraufhin streicht sie mit dem Zeigefinger über ihr Handgelenk, als wollte sie Dreck abwischen, und sagt: „Schwarz.“
„Eigentlich“, versichert sie, „kannst du nur aus der Dominikanischen Republik sein.“
Dann ziehst du um, weil du aufs College gehst, und was dich dort am tiefsten schockiert, ist die Tatsache, dass es im Mittleren Westen absolut niemanden interessiert, ob du aus Puerto Rico oder aus der Dominikanischen Republik bist. Dort bist du schlicht und einfach Schwarz. Niemand fragt dich: „Was bist du?“
Stattdessen wollen deine Kommilitonen wissen, wie du Katrina überlebt hast. Du antwortest, du hättest vor dreizehn Jahren den Hurrikan Andrew überstanden – Andrew sei für Miami, was Katrina für New Orleans sei. Daraufhin blinzeln sie irritiert und verlieren das Interesse.
In den Seminaren wollen die Leute etwas über die Sichtweise der Schwarzen erfahren. In ihren Augen blitzt Enttäuschung auf, wenn du sagst: „Da seid ihr bei mir an der falschen Adresse.“ Dies, glaubst du, ist immer die passende Antwort, egal, wem die Frage gilt. Ob es ein fester Bestandteil des Schwarzseins ist, zu bestreiten, dass man Erfahrungen gemacht hat, die als „typisch für Schwarze“ gelten?
Du fragst dich, wie es wäre, wenn ein richtiger Schwarzer einen Studienplatz bekäme. Du stellst dir vor, wie deine Mitstudierenden um ihr Leben rennen. Du malst dir aus, wie sie sich ihm nackt und bleich vor die tiefschwarzen Füße werfen. Du fragst dich, ob man hier weitere Schwarze zulassen wird. Und im Laufe der Jahre stellst du fest, dass keine weiteren erscheinen.
Im Mittleren Westen giltst du unweigerlich als Schwarz; trotzdem erstaunt es dich, wie hell deine Haut im Winter ist. Du betrachtest deine Haare stundenlang im Spiegel, deine offenen Locken, nicht mehr platt gedrückt von der Luftfeuchtigkeit Miamis. Einzelne ragen auf, andere verbinden sich zu welligen, flusigen Büscheln, wieder andere bilden stabile Spiralen. Nicht mal deine Haare können sich darauf einigen, was sie sind.
In den Fluren des literaturwissenschaftlichen Seminars unterstellt dir ein koreanischer Freund, eine Dauerwelle zu haben. Weiße Mitstudierende zupfen während eines Seminars an deinen Haaren und entschuldigen sich dafür, sie zupfen in einer Bar daran, ohne sich zu entschuldigen. Du hast stets geglaubt, es wären Klischees, hast gedacht, es wäre ein stark überzeichneter Mythos. Du schämst dich für die Menschheit.
Eines Nachts wankst du aus einer Kellerbar und sackst in ein Taxi. Du bittest den somalischen Fahrer: „Bringen Sie mich zu einem Ort mit Schwarzen.“ Er nickt und fährt dich zu einem Hip-Hop-Club in der Innenstadt. Schon am Eingang spürst du die Vibrationen der Bässe und platzt fast vor Glück. Beim Umschauen bemerkst du zu deiner Verblüffung die zahlreichen zweifarbigen Paare im Publikum, sehr Schwarze Männer, an sehr helle Frauen geschmiegt.
Im Mittleren Westen lautet die Frage nicht, ob man Schwarz ist, sondern ob man wahrhaft weiß ist. Deine chinesisch-amerikanische Freundin Caitlyn vertraut dir an, sie fühle sich als Weiße.
„Und wie fühlt es sich an, eine Weiße zu sein?“, willst du von ihr wissen. „Wahrscheinlich so, als würde man barfuß über einen flauschigen Teppich laufen, oder?“
„Ah, das hatte ich nicht bedacht“, sagt Caitlyn. „Die Weißen sind dir natürlich verhasst.“
„Wieso das? Ich bin immerhin extra in den Mittleren Westen gezogen, um sie kennenzulernen.“
„Ich mein ja nur, dass man stets von mir erwartet, die Welt aus dem Blickwinkel einer Minderheit zu betrachten. Als wäre ich so was wie eine Botschafterin des Chinesischseins. Die einzigen Chinesen, die ich kenne, sind meine Eltern. Und die sind ziemlich wohlhabend. Wahrscheinlich fühle ich mich zu privilegiert, um mich nicht als Weiße zu fühlen.“
„Klingt, als hättest du es nicht leicht.“
„Schon klar, wie das klingt, besonders für dich, aber das ändert nichts daran, wie ich mich fühle. Du kannst das sicher nicht nachvollziehen. Wie auch?“
„Hört sich an, als wolltest du nicht wie ein Abziehbild behandelt werden, sondern wie ein menschliches Wesen. Wie Weiße andere Weiße behandeln.“
Sie beißt sanft auf ihre Unterlippe, dann sagt sie: „Stimmt.“
„Und dem steht dein Aussehen im Weg.“
„Richtig!“, sagt sie.
„Dann versteh ich, wie du dich fühlst“, sagst du. „Nur heißt es nicht, dass du weiß bist.“
Du bist auf einer sogenannten Party. Du warst natürlich schon auf Partys, nur unterscheiden die hiesigen Studierenden zwischen Party und Tanzparty. Auf Tanzpartys darf getanzt werden. Auf Partys darf man verlegen rumstehen und das Studium erörtern, Bauch oder Brust mit roten Plastikbechern beschirmen oder sich zwischen diesen Bechern durchschlängeln, als würde man über rohe Eier balancieren.
Soweit du dich erinnerst, ist in Miami jede Party eine Tanzparty. In Sachen Small Talk hast du folglich einiges nachzuholen.
Im Wohnzimmer eures Gastgebers bahnst du dir den Weg zu einem fast geschlossenen Kreis von Frauen, die du aus Seminaren kennst. Sie reden mit Feuereifer abwechselnd über dies und das. Du hoffst auf ein Thema, zu dem du etwas beitragen kannst. Wie du studieren im Hauptfach alle Englisch, wie du stammt keine aus dem Mittleren Westen – ihr müsstet also gemeinsame Interessen und Erfahrungen haben.
Sie machen Platz, damit du ihren Kreis vervollständigen kannst, und reden eifrig weiter, würdigen dich aber keines Blickes. Eine von ihnen sagt: „Ja, ich kenne das, wenn die Leute hier hören, dass ich aus Mexiko bin, denken sie an die Maya. Dabei stammt meine Familie in direkter Linie von Spaniern ab. Ich bin kein Indio. Nicht dass das irgendwie schlecht wäre, aber es gibt einen deutlichen Unterschied.“
„Ich versteh dich gut“, sagt die andere schwarzhaarige Frau in der Runde. „Ich bin aus Argentinien. Wir sehen europäischer aus als andere Südamerikaner.“
„Ich weiß“, wirft eine brünette Frau ein. „Meine Mutter ist jüdisch, und deshalb werde ich hier plötzlich nicht mehr behandelt wie eine Weiße.“
„Oh, du bist eine Weiße.“ Die Mexikanerin legt der brünetten Frau mitfühlend eine Hand auf den Arm. „Keine Sorge.“
„Du ja auch“, sagt sie, indem sie die Geste erwidert.
„Ich bin weiß“, erklärt die Argentinierin mit bebender Stimme und blinzelt, um ihre Tränen zurückzuhalten.
„Natürlich, ist ja klar!“, bekräftigen die anderen beiden. „Wir sind alle weiß.“
„Wir sind weiß.“
„Wir sind weiß.“
„Wir sind weiß“, sagen sie.
Du bändelst mit zwei weißen Amerikanerinnen an, gleichzeitig und unverbindlich. Beide heißen Katie. Im Mittleren Westen heißt fast jede Frau Katie. Oder Caitlin. Oder Kathryn. Oder Kathleen. Diese zwei heißen jedenfalls Katie. Beide sind Mitte dreißig, und beide durchleben eine ähnliche Krise, die der eigentliche Grund dafür ist, dass sie sich mit dir eingelassen haben.
Sie klagen ständig, die Zeit, in der sie Kinder bekommen könnten, laufe ihnen davon. Sie erklären gedankenlos, aus wohlhabenderen Familien zu stammen als du (nicht dass sie sich jemals nach deiner Familie erkundigt hätten). Du findest das beleidigend, vor allem wenn du bedenkst, wie viel Geld von deinem Stipendium und dem Studentendarlehen du für Klamotten ausgibst und wie viel Zeit du in dein Erscheinungsbild investierst, siehst am Ende aber ein, dass sie recht haben. Zwar haben sie es nie offen gesagt, aber die beiden glauben, dir geistig überlegen zu sein. Du dagegen siehst besser aus, und sie finden, deine jugendliche Attraktivität mache ihr Geld und ihre Intelligenz mehr als wett.
Was du ihnen nicht erzählst, was du strikt verschweigst, ist die Tatsache, dass du nach dem Highschool-Abschluss jahrelang herumgeeiert bist und Aushilfsjobs gemacht hast, bevor du dich zu einer Collegebewerbung durchringen konntest, also einige Jahre älter bist, als sie glauben. Braunhäutige Jungs bleiben von Stirnfalten verschont, deshalb wurdest du nie gefragt, wieso du Anfängerseminare besuchst. Außerdem haben beide Katies deine Geschichte in ihrem Kopf längst vorformuliert, und wer bist du, dass du sie enttäuschst?
Was du an ihnen magst, ist, dass sie so bezaubert sind von deinem … deinem … ja, wovon genau?
Anfangs versuchen sie, die Sache locker zu sehen, aber nach kurzer Zeit rutschen ihnen Vergleiche zwischen dir und anderen Männern heraus, mit denen sie zusammen waren. Oder glaubten, zusammen zu sein. Diese Vergleiche sind als Kompliment gemeint.
Katie sagt: „Deine Haut ist viel glatter als die von den Typen, mit denen ich was hatte. Ich hätte nie damit gerechnet, dass sie so glatt ist. Sei froh, dass sie nicht aschgrau ist.“
„Wer hätte gedacht, dass deine Lippen so weich sind?“, sagt Katie. „Wie flauschige, kleine rosa Kissen. Ein Glück, dass sie nicht rissig und verkohlt aussehen.“
Katie behauptet sogar: „Deine Brustwarzen sind ein bisschen rosa! Ein bräunliches Rosa, aber Rosa. Echt unglaublich.“ Nach einer Weile beharren beide wiederholt auf der Feststellung: „Du siehst aus, als wärst du gemischt.“
„Bin ich ja auch.“
„Als hättest du nicht nur einen Hintergrund, meine ich.“
„Na ja, genau genommen …“
„Nein“, sagen sie, „als wäre ein Elternteil weiß.“
Eines Morgens, du sitzt im Diner, will dir eine Frau den Koran verkaufen. Als du ablehnst, verflucht sie dich, weil du dein arabisches Erbe verleugnest. Du schwörst, weder ein solches Erbe zu haben noch Muslim zu sein. Daraufhin zeigt sie auf dein Gesicht und sagt: „Natürlich bist du das. Schau dich doch an.“
Deine zwei Schwarzen Freunde im Mittleren Westen wollen hartnäckig wissen, was du mit deinen Haaren machst. Einer zeigt darauf und sagt: „So wachst du morgens doch bestimmt nicht auf.“
„Ich wasche sie ab und zu“, antwortest du.
Sie sind zuerst sauer auf dich, weil du nur mit weißen Frauen zusammen bist. Danach, weil du nur mit Asiatinnen zusammen bist. Sie sind sauer auf dich, weil du etwas mit ihrer haitianischen Freundin hast, und als du dich von ihr trennst, sind sie auch sauer. „Interessiert es irgendjemanden, wo du deinen verdammten Schwanz reinsteckst?“, meint Sheila, als du ihr davon erzählst. „Ich habe Gabriella geraten, die Finger von dir zu lassen“, ergänzt sie. „Du scheinst von allen beschissenen Farben des Spektrums kosten zu wollen.“
„Tauch deine Gabel mal wieder in Schwarze Liebe“, meint Neya und neigt ihren Kopf hin und her.
Du fragst dich, ob deine Beziehung mit Gabriella als Schwarze Liebe hätte gelten können. Dein Teint unterscheidet sich stärker von ihrem Teint als von dem der zwei Katies. Du hütest dich, das laut zu sagen.
Als Sheila und Neya in deinem Bücherregal ein Familienfoto entdecken, das auch deinen Vater zeigt, flippen sie total aus. „Oh, der hat ja gute Haare“, sagen sie. Und: „Na, kein Wunder. Ich dachte, dein Vater wäre Schwarz. Ich dachte, du wärst einfach hellhäutiger.“
Du würdest sie gern darauf aufmerksam machen, dass man die Formulierung gute Haare als abfällig auffassen könnte, und die Frage, welchen Ursprung der Stamm der einfach hellhäutigeren Leute habe, liegt dir auch auf der Zunge. Du würdest gern wissen, wieso dein Vater nicht Schwarz ist und ob seine Haare das einzige Kriterium dafür sind. Stattdessen entfährt dir: „Meine Mom hat glattere Haare. Warum sind seine so ›gut‹?“
Beide betrachten das Foto aus nächster Nähe, dann weichen sie lachend zurück. „Deine Mom hat keine glatten Haare“, sagt Sheila und und entlässt danach eine Kette von Kicherlauten.
Du studierst deine Mutter auf dem Foto – ihren Pony, das über die Schultern fallende Haar –, dann siehst du Neya an, deren Lachen zum Grinsen erstarrt ist. „Du hast recht, ihre Haare sind nicht richtig glatt“, sagt sie. „Sie hat eine Dauerwelle, ganz klar.“
Bei offiziellen Veranstaltungen im Mittleren Westen überrascht es dich trotz allem immer wieder, dass die einzigen Schwarzen die Bedienungen sind. Und du bist genauso überrascht, wenn Schwarze Angestellte dich stoppen und sagen: „Du siehst aus, als würdest du hier arbeiten.“
Schwarze Barkeeper bedienen dich erst, wenn du diese Worte zur Kenntnis nimmst. Sie sind sofort für deine Freunde und Kollegen da, in deinem Fall dagegen stehen sie untätig herum und lächeln schief, als hättest du einen Witz gemacht oder als wäre ihnen etwas Lustiges in den Sinn gekommen. Manchmal wischen sie mit einem feuchten Lappen über den Tresen, bevor sie deinem Blick begegnen. Manchmal schieben sie die Schaufel in die Eiswürfel im Gefrierschrank oder stapeln Cocktailservietten auf der Zapfanlage, obwohl der Turm aus weißen Papierquadraten schon bedenklich schief steht.
Wenn sie dich schließlich zur Kenntnis nehmen, mustern sie dich demonstrativ von Kopf bis Fuß. Und wenn du mit einer Frau da bist, tun sie das noch demonstrativer. „Du siehst aus, als würdest du hier arbeiten“, sagen sie. Wenn du deine Bestellung wiederholst, wenn du sagst: „Könnten wir zwei Whiskey Ginger haben, bitte?“, zeigen sie ihre Zähne, sehen dich eindringlich an und sagen extrem langsam und gedehnt: „Du siehst aus, als würdest du hier arbeiten.“
Dann nickst du. Entweder du nickst oder du bleibst durstig.
„Das war echt schräg“, könnte deine Begleitung auf dem Weg zum Tisch sagen. Sie könnte sich sogar dazu hinreißen lassen, dir zu erklären, was Mikroaggressionen sind.
Dann setzt ihr euch und vergesst die Demütigung, bis die Kellnerin an den Tisch kommt und den Gästen das Essen vorsetzt. Deinen Teller stellt sie zuletzt auf die weiße Leinendecke, was sicher der Etikette entspricht. Und wärst du unaufmerksam, wärst du gerade in ein Gespräch vertieft, dann würde sie dir wohl mitten im Satz auf die Schulter tippen und sagen: „Du siehst aus, als würdest du hier arbeiten.“
Du würdest ihre Worte sofort verstehen: Du siehst aus wie jemand, der hier dienert. Wie auch sonst? Seit du Miami verlassen hast, bist du von dem Gedanken besessen, dass hier niemand aussieht wie du. Wäre wunderbar, wenn ein paar Leute aus der Dominikanischen Republik in diese Stadt ziehen würden.
Wenigstens bleiben in Bussen oder an Straßenecken im Stadtzentrum betrunkene Schwarze stehen und sagen, während sie auf dich zeigen: „Wir sind Brüder, nicht vergessen.“
In Jamaika giltst du als braun. In deiner Peergroup sehen dir alle sehr ähnlich, unterschiedlich stark ausgeprägte afrikanische und europäische Züge, ergänzt durch einen indischen oder chinesischen Touch. Sie könnten zu deiner Familie gehören, reden auch so, du fühlst dich also sogar unter Fremden heimisch. Deine Peergroup weiß, dass dieser gemischte Typus in der Mittelschicht häufig ist, und auf deiner Exkursion ins Land deiner Eltern, finanziert durch ein Stipendium, mustert man dich weder fragend noch steckt man dich in eine Schublade, sondern akzeptiert dich.
Bis du den Mund aufmachst.
Dann heißt es: „Oh, ein Yankee. Aber deine Eltern sind Yardies, kann ich dir ansehen.“ Manche versichern, in deinen Adern fließe jamaikanisches Blut, egal wo du geboren seiest. Andere, vor allem Jüngere, finden es absurd, dass du mit Begriffen wie Jamaikaner oder jamaikanischer Amerikaner hantierst, um dich einzuordnen oder deine ethnische Zugehörigkeit zu definieren. „Aber was weißt du über Jamaika?“, fragen sie.
Die Mischung skeptischer Frauen und Männer zwischen Anfang und Mitte zwanzig ist dir besonders zugewandt, vielleicht, weil sie bedauern, dass du um eine anständige jamaikanische Erziehung betrogen wurdest, vielleicht auch, weil alle im Ausland Medizin oder Jura oder sonst etwas studieren und, nachdem sie lange fort waren, einen Fremden brauchen, der ihnen ins Bewusstsein ruft, dass sie Einheimische sind.
Auf jeden Fall haben sie dich überzeugt, dass deine Eltern dein Leben in dem Augenblick ruinierten, als sie die Insel verließen. Deine neuen Bekannten gehen mit dir zum Feiern und Fischessen an den Hellshire Beach, wo im türkisenen Wasser onyx- und karamellfarbige Körper glitzern. Sie führen dich ins National Stadium, damit du zusehen kannst, wie sich die derzeit schnellsten Läuferinnen und Läufer der Welt für die Olympischen Spiele qualifizieren. Sie beauftragen ihre Hausangestellten, Jerk-Pork, Bohnensuppe und gebackene Brotfrucht für dich zuzubereiten. Sie laden dich zu Bootsfahrten und in Nachtclubs ein, die Fiction oder Envy heißen. All das verbuchst du als Recherche und schiebst den Besuch in der Bibliothek der University of the West Indies bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag auf.
Die Eltern deiner Bekannten bestehen darauf, dass du die Töchter ihrer Geschwister und Freunde kennenlernst. Zum ersten Mal in deinem Leben ist eine Mutter – sind mehrere Mütter – der Ansicht, du wärst die passende Partie für ihre Tochter, und du stimmst zu. Du würdest am liebsten allen einen Antrag machen, um möglichst rasch für Zuwachs in der karamellbraunen Bevölkerung zu sorgen. Genau diese Mädchen, dämmert dir, haben deiner Mutter stets vorgeschwebt: diese multikulturellen Mosaike auf zwei Beinen, diese ethnisch ambivalenten Bräute.
Wo sonst werden Menschen wie ich in so großer Zahl produziert?, fragst du dich. Und: Wie sollte ich je wieder abreisen?
An alkoholreichen Abenden bemühst du dich um einen passablen jamaikanischen Akzent, was dir auch gelingt, wenn die Subwoofer wummern und dein Umfeld sturzbetrunken ist, aber die Jahre, die du in der Abgeschiedenheit des Mittleren Westens verbracht hast, fern der Musik, des Essens und der Menschen, die in Miami allgegenwärtig sind, haben zur Folge, dass du den Zungenschlag deiner Eltern zum Teil verlernt hast. Und wenn deine Bekannten hören, wie du dich bemühst, lächeln sie, wenden den Blick ab und tun so, als wärst du ihnen nicht peinlich.
Schließlich wirst du dir eingestehen, genug zu haben. Genug von den Versuchen, alle und jeden, vor allem jedoch dich selbst, von allem zu überzeugen.
Als du das Haus aufsuchst, in dem deine Großeltern bis zu ihrem Tod gelebt haben, das Haus, in dem du als Kind zu Besuch warst, wird dir bewusst, dass es viel kleiner ist als in deiner Erinnerung. Dir wird bewusst, dass alles relativ ist.
Eines Nachmittags, du hängst auf einem Liegestuhl auf der Veranda deiner Gastgeber ab, stellst du die Flasche Wray & Nephew lange genug weg, um zwei Bekannten die Frage zu stellen, die dich veranlasst hat, Jamaika zu besuchen, jene, über die du schreibst.
„Gibt es in eurem Freundeskreis Leute“, setzt du an, „die über ihre Wurzeln nachdenken? Also über ihre Vorfahren aus der Zeit vor Jamaikas Unabhängigkeit?“ Du denkst an die Liste europäischer Granden, die deine Mutter aufgestellt hat, dir fällt ein, dass deine Eltern das britische Schulsystem der Kolonialzeit, dem sie ihre Bildung verdanken, bis heute in den höchsten Tönen loben, du denkst an die Rastafari, die Äthiopien und Mama Afrika preisen. Dein eigentliches Interesse gilt aber den Zwanzig-plus-Jährigen aus der Mittelschicht. Du willst wissen, wie es dir ergangen wäre, wenn deine Familie nicht ausgewandert wäre. „Gibt’s unter euch Leute, die England oder Westafrika als Mutterland betrachten?“
„Ziemlich bekloppte Frage, oder?“, erwidert Zoë, brauner Teint und helle Augen. Du hast dich erschreckend schnell in Zoë verliebt. Während der letzten paar Nächte hast du dir mehrfach ausgemalt, deinem Vater einen Brief zu schreiben, in dem du ihn bittest, dir eine Art Mitgift zukommen zu lassen, irgendeine Form finanzieller Unterstützung, die es dir erlauben würde, in Kingston zu bleiben und um Zoë zu werben. Solltest du sie heiraten und auf der Insel bleiben, dann wäre deine Zeit in Amerika in zehn bis zwanzig Jahren vermutlich nur noch ein Fliegenschiss in der Familiengeschichte, ein schlechter Traum, der in Vergessenheit geriete. Daheim in Miami haben Delano und seine neue Frau schon begonnen, jamaikanische Vollblutbabys in die Welt zu setzen, die sich in späteren Jahren vielleicht – vielleicht aber auch nicht – mit ihrer Herkunft befassen werden.
Was Zoë betrifft, so flirtet sie auch, lacht aber schallend, wenn du wieder mal sehr langsam sprichst, die Vokale abschleifst oder hart auf den Konsonanten landest. „Ist Äfer-i-kah dein Heimatland?“, äfft sie dich auf Patwah nach. „Nur Yankees denken über so was nach. Weil sie keine Kultur haben. Sie sind verlorene Seelen.“
„Typisch“, erwiderst du. „Jamaikaner fühlen sich also … einfach jamaikanisch?“
Steven, Zoës Cousin, sagt zu ihr: „Kannst du vergessen, den Jungen. Die Weißen haben seinen Kopf geklaut, er ist hinüber.“ Und an dich gerichtet: „Bleib locker, Alter. Der Rum hier kriegt klein, was du zwischen den Ohren hast.“ Steven, Sohn der Freundin einer Freundin deiner Mutter, hätte dir Kingston zeigen sollen, hat dich aber sofort Zoë und ihren Freundinnen aufs Auge gedrückt. Dafür könntest du ihm glatt einen Kuss geben.
„Glaubst du, Franzosen fühlen sich nicht französisch?“, will Zoë wissen. „Glaubst du, Iren fühlen sich nicht irisch?“
„Das ist was anderes. Ihr seid ja nicht die ursprünglichen Bewohner dieser Insel.“
„Na und? Meinst du ernsthaft, innerhalb von Europa hätte es keine Migration gegeben? Man muss nur weit genug zurückgehen.“
„Ich meine den Kolonialismus, die massenhafte Versklavung.“
„Puh. Nur Yankees beißen sich daran fest“, sagt sie. „Genau das unterscheidet uns von euch.“
Du fragst dich, ob zwischen ahistorischem Denken und Zufriedenheit ein Zusammenhang besteht.
Es überrascht dich, wie nachsichtig du gegenüber Zoës politischen Ansichten bist. Vielleicht hat sie recht. Oder die Liebe macht dich blind. Als du ihr erzählst, du würdest gern Accompong besuchen, um den Maroons Tribut zu zollen, die sich dort erfolgreich gegen die britischen Sklavenhalter gewehrt haben, sagt sie: „Meinst du diese bettelarmen Lehmhüttenbewohner?“
Jetzt sagst du: „Die Armen, die wir auf der Straße sehen, die in Baracken wohnen und endlos weit mit dem Bus fahren müssen, um bei euch zu putzen, denken beim Anblick eurer schicken Autos, schicken Klamotten und schicken Häuser bestimmt nicht, dass es das eine Jamaika gibt. Sie leiden bis heute unter den Folgen des Kolonialismus, richtig?“
„Tja, weißt du, manche Leute haben halt keine Lust, hart zu arbeiten“, meint Zoë. „Klingt gemein, schon klar, aber …“
„Du willst also, dass braunhäutige Menschen in Häusern leben und Schwarze Menschen in Blechhütten.“
„Ist eine Frage der sozialen Schicht“, sagt Steven. „Hat nichts mit Rassismus zu tun. Wir sind alle Schwarz, Mann.“
Um deine Gastgeber nicht zu beleidigen, unterlässt du es, weiter nachzuhaken. Deine Frage nach den privaten Sicherheitsfirmen, die ganz Kingston mit ihrer Werbung zukleistern, bei einem Einbruch angeblich sofort zur Stelle sind und die Diebe über den Haufen schießen – du fragst dich, woher sie wissen, wer Hauseigentümer und wer Einbrecher ist –, beantwortet Steven ungerührt: „Sie knallen niemanden ab, der aussieht wie wir. Sie schießen nur, wenn du ein Schwarzer Schwarzer bist.“
Deine Rückkehr in den Mittleren Westen ist eine harte Landung, ein größerer Schock als deine ursprüngliche Ankunft. Du hast Anfälle von Einsamkeit, Unzufriedenheit. Du begreifst – zuerst belustigt, dann mit einer eisigen Verzweiflung, die sich vom Zwerchfell bis zur Magengrube ausbreitet –, dass du den Alltag in dieser Präriestadt in jeder Hinsicht verabscheust, von den Fleischverlosungen und Hurrikanwarnungen bis zu den Aufläufen mit Hack und Kroketten, von der passiven Aggression bis zum flächendeckenden Mangel an Klimaanlagen.
Du vermisst Jamaika und die Menschen dort. Du schreibst Zoë noch einige Wochen, aber im Laufe des Wintersemesters flaut dein Elan ab.
Eines Abends sprichst du mit Neya und Sheila über dein Gefühl der Isolation.
„Wie schmecken die Tränen hellhäutiger Typen?“, fragt Sheila. „Ob sie hydrieren?“
„Tja, wenn er mit einer Schwarzen Amerikanerin zusammen wäre …“, meint Neya.
„Und wo sollen die sein?“ Du schaust dich demonstrativ im Raum um. „In dieser Bar jedenfalls nicht. Im literaturwissenschaftlichen Seminar gibt es auch keine einzige.“
„Da haben wir das Problem Nummer eins“, sagt Sheila. „Welcher Schwarze Mann studiert schon Literaturwissenschaft? Künstler mit Collegeabschluss sind für uns absolut überflüssig. Wir müssen in unseren Communitys Wohlstand schaffen.“
„Und deshalb braucht die Welt noch jemanden mit einem Abschluss in Management?“, entgegnest du, eine Anspielung auf Sheilas Graduate-School-Ehrgeiz. „Oder, schlimmer“, sagst du, an Neya gewandt, „noch eine Anwältin?“
Ihr habt je drei Tequilas intus, auf dem Bartisch stehen jede Menge Biergläser, alle geleert. Du schaust nach links, zur Bar, suchst die Bedienung, um noch eine Runde zu bestellen.
Stattdessen bleiben deine Augen an deinem Spiegelbild hängen, zumindest scheint es für einen Moment so. Ein junger Mann mit extrem hellbraunem Teint sitzt auf einem Hocker an der Bar, und als du dich umwendest, sieht er zu dir. Er trägt die Haare kürzer als du, seine Augen sind heller. Im goldbraunen Gesicht wirken seine Lippen fast rosig.
Normalerweise würdest du wegschauen, in diesem Fall bleibt dein Blick aber kurz auf ihm haften. Dein ausgeprägtes Interesse daran, anhand der Gesichtszüge die Herkunft zu bestimmen und nach Parallelen zu dir selbst zu suchen, hat sich seit deinem Umzug in diese Stadt, in der es fast niemanden gibt wie dich, noch weiter intensiviert. Es ist so, als wärst du Mitglied eines Clubs, von dem du nichts erzählen darfst.
Der Typ kommt lächelnd zu eurem Tisch. Er stellt sich als Justin vor. Justin ist offenbar allein da. Vielleicht treibt ihn ein ähnliches Problem um.
„Setz dich doch, Justin“, sagst du. „Wir sprechen gerade über die Verantwortung der Schwarzen im einundzwanzigsten Jahrhundert.“
Justin sieht deine Freundinnen an, als wollte er sagen: Im Ernst? Du fragst dich, ob er sich beteiligen wird, ob es ihn überhaupt betrifft.
„Um genau zu sein“, sagt Sheila, „haben wir darüber gesprochen, ob die Schwarze Community noch einen Künstler braucht. Was würde uns das bringen?“
„Na ja“, sagt Justin. „Künstler sind Herolde. Sie sind unsere Spiegel, unser Licht.“ Er klingt bedächtig, aber vielleicht liegt das nur am anfänglichen Zögern. „Sie reflektieren unsere Realität, die vergangene, die gegenwärtige und die zukünftige. Ohne sie könnten wir nicht messen, ob wir Fortschritte gemacht haben. Wir wären wie Kinder, die im Dunkeln nacheinander greifen.“
Neya lacht.
„Irre“, sagt Sheila.
„Ein Dichter“, sagst du.
„Nein, nicht so ganz“, erwidert Justin. „Aber ich studiere im Hauptfach Musiktheater.“
„Kannst du uns vielleicht verraten, Mister Musiktheater“, fragt Sheila, „ob deine Musicals mehr Aussagekraft besitzen als eine Volkszählung oder ein Pew-Report?“
„Na ja.“ Justin beginnt wieder bedächtig. Er verengt die Augen, seine Kiefermuskeln spannen sich an. Er entlässt seinen Atem so langsam, als würde er Zigarettenrauch auspusten. Sein Kiefer entspannt sich. In seinem Gesicht tanzen die Schönheitsflecke, während er spricht. „Eine Volkszählung informiert uns über das Was, aber nicht über das Warum. Und wenn wir das Warum kennen würden – wenn wir etwa wüssten, dass sich das Wohlstandsgefälle diskriminierenden Praktiken bei der Vergabe von Wohnraum verdankt –, wäre die Botschaft noch immer nicht komplett, weil das menschliche Element fehlt, die Tatsache, dass Existenzen auf dem Spiel stehen.“
„Nicht zu vergessen die Repräsentation im weiteren Sinn“, sagst du. „Wenn ich keine Charaktere erschaffe, die aussehen wie ich, wer tut es dann? Sichtbarkeit ist wichtig. Andernfalls wäre es, als wären wir nicht vorhanden.“
„Korrekt“, sagt Justin.
„Mensch, ihr seid ja wie Zwillinge“, meint Neya.
„Du bist Schriftsteller?“, fragt Justin. „Könntest du dir einen Text anschauen, an dem ich gerade sitze? Eine zweite Meinung wäre nicht schlecht.“
Du bist in einem Café mit Justin verabredet, damit er dir die Story, das Stück oder Skript geben kann, an dem er arbeitet. Du weißt nicht genau, was es ist. Als ihr euch begrüßt, hat er den ausgedruckten Text dabei.
„Das ist der Text, den ich mir anschauen soll?“
Er bejaht, lässt das Manuskript aber auf dem Tisch unter seinen aufgestützten Armen liegen. „Danke, dass du das tust.“ Er schaut sich im Café um. „Hier war ich noch nie. Gute Wahl.“ Als er einen Finger über eine Ecke des Manuskripts zieht, entstehen Eselsohren. „Entschuldige. Bin wohl etwas nervös.“
„Wieso?“
Er zuckt die Schultern, senkt den Blick auf seine Hände. „Ehrlich gesagt habe ich so was noch nie gemacht.“
„Kein Grund, nervös zu sein“, sagst du. „Wenn man was rausgibt, kann das erst mal komisch sein, klar. Man muss Vertrauen haben. Man gibt sich eine Blöße. Wir machen uns alle Sorgen, was die Leute denken. Das ist normal. Nach dem ersten Mal wird’s einfacher. Man gewöhnt sich daran, und es dauert nicht lange, dann gefällt’s einem.“
„Ich hoffe mal“, sagt er und dreht den Silberring, den er am kleinen Finger trägt.
„Darf ich dich was fragen? Ich will nicht aufdringlich sein, aber es würde mich interessieren.“
„Klar. Wenn wir schon so weit sind.“ Justin lächelt.
„Welchen Hintergrund hast du?“
Er setzt sich etwas gerader hin. „In Sachen Bildung, meinst du?“
„Nein, ich meine: Woher kommen deine Eltern?“
„Komische Frage“, sagt Justin. „Sie sind von hier. Genau wie meine Großeltern.“
„Ethnisch gesehen, meine ich.“
Er betrachtet dich schweigend, schaut sich um, sieht dich wieder an. „Bist du ein Fetischist oder was?“
„Fetischist?“
„Wenn du einen bestimmten Typ hast, verstehe ich das, aber …“
„Typ?“
„Ich halte nicht viel von Exotifizierung.“
„Typ? Moment, warum sind wir hier?“
Ihr starrt einander an, darauf wartend, dass der jeweils andere für Klarheit sorgt.
„Ich bin bloß hier, weil ich mir deine Story anschauen will.“
„Und weil ich mir eine Blöße geben soll?“
„In kreativer Hinsicht, meinte ich damit.“
„Ich glaube, ich gehe.“
„Warte“, sagst du.
Er stemmt die Hände auf den Tisch, um sich aufzurichten, zögert aber kurz.
„Wir könnten doch befreundet sein?“
Er lacht. „Ich habe Freunde“, sagt er. „Außerdem musst du dir, glaub ich, über einiges klar werden.“
Im letzten Wintersemester vor deinem Bachelorabschluss zwingst du dich, das feuerrote Herbstlaub zu betrachten, den frischen, belebenden Wind zu genießen, der deine Hände und dein Gesicht streift, und dir einzureden: Das ist Magie. Wo ich herkomme, gibt’s das nicht – ich habe mich wirklich rausgewagt.
In den frostigen, eiskalten Nächten, die folgen, wärst du lieber in Miami, eingehüllt in stickige Wärme, umgeben von klebrig-heißer Luft. Aber du bist nicht in Miami. Also pustest du heißen Atem in deinen Schal, um dein Gesicht ein wenig aufzutauen. Du ziehst den Kopf ein und hebst die Stiefel, trottest stumm durch den Schnee.
Während eines Schneesturms in deinem letzten Semester – bevor das Licht in der Küche flackert und erlischt und das Handy tot ist – triffst du eine Entscheidung. Du rufst deine Mutter an. „Ich muss dir was erzählen“, sagst du, während der Wind am Wohnzimmerfenster rüttelt, dem ohne Sturmfenster. Du presst die freie Hand aufs linke Ohr und schreist ins Handy: „Im Sommer ziehe ich wieder nach Hause, direkt nach meinem Abschluss.“
„Ich muss dir auch was erzählen“, erwidert deine Mutter irritierend sanft. „Im Sommer ziehe ich wieder nach Hause, direkt nach deinem Abschluss.“
Der Fensterrahmen bebt, und du windest dich innerlich bei dem Gedanken, deine Mutter würde dich nachäffen, weil sie während deiner langen Abwesenheit senil geworden ist. „Du bist doch zu Hause“, sagst du.
„Nein“, entgegnet sie. „Kingston. Ich habe ein Jobangebot.“
„Du willst nach fast dreißig Jahren zurück?“
„Höchste Zeit“, sagt sie. „Für eine Schwarze Frau ist es hier zu mühsam.“
„Eine Schwarze Frau? Wer soll das sein?“
„Na, ich. Geht’s dir gut?“
Du beendest das Gespräch und rufst deinen Bruder an. „Mom behauptet, Schwarz zu sein, und will nach Jamaika ziehen. Ist sie inzwischen dement oder was?“
Dein Bruder lacht leise, was erneut bestätigt, dass ihn nicht besonders interessiert, was im Leben der anderen passiert. „Manchmal muss man sein, wie man nun mal ist.“
Du würdest gern sagen, er könne sich diese Plattitüde sonst wohin stecken – sagen: Ich habe mir das nicht ausgedacht. Das ist keine Wahnvorstellung. Und fast wäre dir rausgerutscht: Ist bestimmt super, im Land seiner Geburt willkommen zu sein, eine Heimat zu haben, wo man Zuflucht suchen kann. Aber du sagst: „Schlechte Verbindung. Ich rufe noch mal an.“
Dann sprichst du mit deinem Vater. „Ich kehre nach Miami zurück“, erzählst du ihm.
Er schweigt geraume Zeit, so lange, dass du aufs Display schaust, um sicherzugehen, dass er noch dran ist. „Trelawny … findest du diese Idee wirklich gut?“
„Du nicht?“
„Tja, was glaubst du denn? Gibt keine Jobs.“ Er spult eine Liste von Schlagworten ab, wahrscheinlich in den Abendnachrichten aufgeschnappt: Darlehenskrise, Zwangsvollstreckungen, Rezession, ökonomische Talfahrt. „Bleib, wo du bist“, sagt er.
„Ich habe dann meinen Abschluss. Damit finde ich sicher eine Stelle.“
„Abschluss? Du meinst in Englisch? Hier spricht keiner Englisch. Glaubst du ernsthaft, das würde dir einen Job einbringen?“
„Ich könnte für dich arbeiten.“
„Gibt keine Arbeit“, sagt er. „Die Leute können sich ihre Häuser nicht mehr leisten. Und bauen tun sie sowieso nicht. Das Haus deiner Mutter wurde auch zwangsversteigert.“
„Im Ernst?“ Du denkst an ihre flexible, von der Bank festgelegte Tilgungsrate.
„Wo willst du hier wohnen?“, fragt dein Vater.
Du suchst nach Worten. „Werde ich dann schon sehen.“ Du sagst: „Sorry, aber ich muss Schluss machen.“ Und erst danach wird dir klar, dass er dir auch jetzt, nach einem Jahrzehnt, nicht anbieten wird, bei ihm einzuziehen.
Ein paar Monate vor deinem Abschluss, bevor du deinen Dodge Raider belädst und die 1811 Meilen nach Miami zurücklegst, fasst du den Beschluss, einen DNA-Test machen zu lassen. Du spuckst in ein Röhrchen, verschickst es, wartest auf das Resultat. Sechs Wochen später wird dir in einer E-Mail mitgeteilt, die Ergebnisse lägen vor. Du loggst dich in deinen Account ein, und das Fenster, das aufploppt, gibt an, dass du zu 38 Prozent westafrikanischer Herkunft bist. Das ist der höchste Prozentsatz für eine einzelne Region (so riesig und vielfältig sie auch sein mag). Das leuchtet dir ein, kommt dir jedenfalls nicht grundfalsch vor, wenn du deine jamaikanischen Eltern und die Bevölkerungsgeschichte der Insel bedenkst.
Als du weiterklickst, um die komplette Auflistung deiner Ursprünge zu erhalten, liest du ganz oben auf der Seite, dass deine Vorfahren zu 59,9 Prozent europäischen Ursprungs sind (britisch, aber mit Einsprengseln aus diversen Ländern des Kontinents). Und zu einem Prozent, wie es unten auf der Seite heißt, nahöstlich. Alles andere lässt sich nicht exakt bestimmen.
„Heilige Scheiße“, sagt Katie, die neben dir auf dem Sofa sitzt. Sie rutscht ein Stückchen weg, um dich betrachten zu können. „Ich bin mit einem Weißen zusammen.“
Du, Schwarzer, bist überwiegend Europäer.
„Du bist trotzdem Schwarz“, meint Katie, nun wieder ernst.
Dies sind die allerersten belastbaren Fakten zu deiner ethnischen Zugehörigkeit, auch wenn sie dem, was du über deine Vorfahren weißt, recht nahekommen. Du weißt, das Konzept der Rasse ist eine Schimäre, ein soziales Konstrukt. Rasse kann wissenschaftlich nicht bestimmt werden, weil sie, biologisch gesehen, nicht existiert, und doch: Selbst, wenn das Ergebnis neunundneunzig Prozent europäisch und ein Prozent afrikanisch gelautet hätte, wärst du, sofern deine Haut irgendwie braun und dein Haar kraus wäre, nach amerikanischen Maßstäben ein Schwarzer und nichts anderes.
Du denkst an Anlässe, bei denen du ein Kästchen ankreuzen musst – bei einer Volkszählung, in einer Arztpraxis oder im Rahmen der Bewertung von Dozenten und Dozentinnen am Semesterende. In all diesen Fällen bittet dich eine Instanz, die dich, anders als ein Gegenüber, weder korrigieren noch dir widersprechen kann, jedenfalls nicht sofort, Auskunft über dein Selbstverständnis zu geben. Du kannst schwerlich Ein bisschen dies, ein bisschen das neben das Kästchen für Sonstiges kritzeln, und diese neuen Informationen bedeuten auch nicht, dass du sowohl Schwarz als auch Weiß ankreuzen darfst. Erstens basiert das Konzept des Weißseins darauf, jedes Sowohl-als-auch auszuschließen. Zweitens bist du nicht der Sohn eines Schwarzen und eines weißen Elternteils. Sondern der Sohn zweier Sonstiger.
Du bist braunhäutig, aber nicht auf eine beliebige, sondern auf eine ganz spezielle Art.
Schwarz ist umfassend genug, allgemein genug, um all deine europäischen Vorfahren einzuschließen, den ganzen Kontinent abzudecken: Deine französischen, deine italienischen, deine irischen, deine englischen und deine Schwarzen Anteile, dein Schwarz, du bist ein Schwarzer, warum also weiter dumme Fragen stellen?
Du hast dir wissenschaftliche Resultate erhofft, die es dir erleichtert hätten, dich für eine bestimmte Identität zu entscheiden oder anzuerkennen, dass du nicht einzuordnen bist. Die es dir ermöglicht hätten zu sagen: Das bin ich, egal, was ihr in mir seht. Zu sagen: Das bin ich, egal, in welcher Stadt oder in welchem Land ich lebe oder mit welchen Menschen ich mich umgebe. Stattdessen hat sich nichts geändert. Nicht mal ein DNA-Test kann dir helfen, die Frage Was bist du? unwiderlegbar mit einem Wort zu beantworten.
Liebe Leserin, lieber Leser,
Das erste und einzige Haus, das meine Eltern wirklich gemeinsam besaßen, nachdem sie von Jamaica nach Miami ausgewandert waren, war sehr klein. Doch als Kind fand ich eine Ecke, in der ich lesen konnte, und verlor mich in den weiten, flirrenden Welten, die von denjenigen Autoren geschaffen worden waren, die ich im örtlichen Buchladen gefunden hatte: Walden Books. Ich liebte Bücher dafür, dass sie mich davontrugen und die Grenzen der Wirklichkeit erweiterten. Wörter, gedruckt zwischen zwei Buchdeckeln, trugen mich in ferne Länder, nahmen mich mit auf Reisen, die mich für immer veränderten – sie wirkten magisch auf mich. Sie selbst brauchten nicht viel Raum, und doch spürte ich Vollkommenheit in diesen bewusstseinsverändernden Geschichten; sie lagen so wunderbar in meinen Händen. Später begann ich zu verstehen, dass große Literatur mir nicht nur half, der Wirklichkeit zu entkommen, sondern dass sie mir dabei helfen konnte, in mein Innerstes zu sehen, mich selbst und die Welt um mich herum besser zu verstehen, und – im besten Fall – auch die Erfahrungen anderer nachzuvollziehen.
Ich selbst schreibe, um unserer Welt einen Sinn zu geben und um Leserinnen und Lesern Geschichten zu erzählen, die ihren angemessenen Platz auf der Bühne der Literatur noch nicht bekommen haben. Mit „Falls ich dich überlebe“ wollte ich genau das Buch schreiben, dass mir noch gefehlt hat – das Buch, das mir geholfen hätte, meinen Platz in der Welt zu finden, als junger Mensch, aber auch heute.
Und obwohl ich mir die Geschichten und Ereignisse in diesem Buch ausgedacht habe, sind sie inspiriert von meiner Kindheit und Jugend in Miami, und von den Erfahrungen, die ich gemacht habe, nachdem ich meine Heimatstadt verlassen habe. Der Roman lotet aus, was „mixed Black identity“ und postmigrantische Identität bedeuten können, durch die Augen derer, die ihre härteren Seiten täglich erleben und aushalten müssen. Einige meiner frühen Leser sagten, dass die schmerzhaftesten Stellen nicht selten mit Humor verpackt daherkamen, und ich hoffe sehr, dass Sie das Buch auch zum Lachen bringen kann.
Aber vor allem hoffe ich, dass Sie ihnen diese Familie ans Herz wächst, so wie sie mir ans Herz gewachsen ist, und dass sie jeden einzelnen von ihnen richtig kennenlernen: Trelawny, der so hart darum kämpft, Teil dieser Familie zu sein und Teil seines Geburtslandes, das es ihm so schwer macht; Delano, der mit den Widersprüchen seiner Männlichkeit ringt und beinahe rücksichtslos um seine Kinder kämpft; Sanya, die derart desillusioniert ist von Amerika, dass sie immer weitersucht, nach einem Land, das sie Heimat nennen kann; und Topper, dessen Wunsch, dass irgendwas von ihm ihn selbst überdauert, zum Scheitern verurteilt scheint.
Ich hoffe, Sie finden ein wenig Zeit, um mein Buch zu lesen!
Mit den besten Wünschen
Jonathan Escoffery
„›Falls ich dich überlebe‹ wartet mit einem verblüffenden, langen nachhallenden Schluss auf.“
„Es hat eine Gewalt, das ist ein Strudel, der fast schon etwas biblisches hat. Es ist unglaublich zerstörerisch aber eben auch faszinierend. Man schaut zu und es tut weh, wenn er über diese ständige Entwurzelung erzählt.“
„Er macht mit seiner feinfühligen Erzählweise alles spürbar: das Brennen der Sonne, den Geruch der blühenden Bäume, die Rhythmen des Reggae - und die Bitterkeit der Enttäuschung.“
„Das Buch macht besonders stark, dass bei Jonathan Escoffery viel von seiner eigenen Geschichte mit einfließt und dass die Geschichten authentisch sind.“
„Die Dialoge kommen bei Escoffery zuweilen wie aus Hollywood daher: schneidig und auf den Punkt.“
„Rasant, rau und spannend.“
„Escofferys erzählerische Raffinesse, der dezidiert liebevolle Blick auf seine Figuren und die Komposition des Romans schaffen eine nuancierte Erzählwelt, offenbaren aber auch den strukturellen Rassismus in seiner absurdesten Form. Scheinbar mühelos platziert der Autor humorvolle Szenen, die eine wunderbare Leichtigkeit reinbringen. Ein elektrisierender Roman, der wichtig ist und gleichzeitig unterhält. Für mich jetzt schon ein Jahreshighlight, dem ich sehr viele weitere begeisterte Leser*innen wünsche!“
„Neben der Leichtigkeit, mit der es sich liest, hat mir auch gefallen, dass der Autor ohne jeglichen Kitsch auskommt. Die Probleme, in die sich die Familienmitglieder verwickeln, sind hautnah und real. Ein empfehlenswerter Roman für alle LeserInnen, die (wie ich) gerne mehr wissen möchten zum Leben der Immigranten in den USA.“
„Es ist sehr lustig und unterhaltsam geschrieben, aber gleichzeitig auch sehr gesellschaftskritisch.“
„Es liest sich sehr, sehr gut.“
„An Intensität und Zugkraft gewinnt das Ganze durch die abwechselnden Erzählweisen, an die sich Escoffery heranwagt: Mal stecken wir im Kopf des Vaters, mal des Bruders, mal des Cousins, dann wieder im Kopf Trelawnys.“
„So humorvoll und gleichzeitig ernst hat schon lange niemand mehr über ethnische Zugehörigkeiten geschrieben.“
„Escoffery zeigt den ganz normalen Alltagsrassismus ebenso präzise auf wie den strukturellen, überrascht mit den abwechselnden Erzählweisen von Vater, Bruder, Cousin oder eben Trelawny und bringt einem trotz aller Tragik immer wieder zum Schmunzeln. Ein herzerfrischendes Debüt!“

















DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.