
Four Dead Queens — Inhalt
„Sei schnell und noch schneller wieder weg“, das ist das Motto von Keralie Corrington, Taschendiebin aus Quadara. Im Regierungsbezirk von Quadara stiehlt sie dem Boten Varin Erinnerungschips – ein begehrtes Gut auf dem Schwarzmarkt. Allerdings muss sie feststellen, dass es sich keinesfalls um leere Chips handelt: Unfreiwillig wird sie Zeugin, wie Quadaras vier regierende Königinnen ermordet werden. Keralie und Varin werden zu Spielbällen einer weitreichenden Verschwörung geworden sind. Zusammen versuchen sie, den Strippenziehern zu entkommen und deren Pläne zu vereiteln.
Leseprobe zu „Four Dead Queens“
Kapitel 1
Keralie
Die Morgensonne ließ die goldene Palastkuppel erstrahlen und überflutete den Concord mit Licht. Während alle anderen innehielten und hochblickten, als wäre dies ein Zeichen der vier Königinnen höchstpersönlich, kauerten wir über ihnen wie Meeresgeier, bereit, auf sie hinabzustürzen und sie zu zerreißen.
„Wen suchen wir uns heute aus?“, fragte Mackiel. Er lehnte sich an den gewaltigen Bildschirm auf dem Gebäudedach, der den neuesten Königlichen Bericht zeigte. Er sah aus wie ein charmanter, gut gekleideter junger Mann aus Toria. Zumindest [...]
Kapitel 1
Keralie
Die Morgensonne ließ die goldene Palastkuppel erstrahlen und überflutete den Concord mit Licht. Während alle anderen innehielten und hochblickten, als wäre dies ein Zeichen der vier Königinnen höchstpersönlich, kauerten wir über ihnen wie Meeresgeier, bereit, auf sie hinabzustürzen und sie zu zerreißen.
„Wen suchen wir uns heute aus?“, fragte Mackiel. Er lehnte sich an den gewaltigen Bildschirm auf dem Gebäudedach, der den neuesten Königlichen Bericht zeigte. Er sah aus wie ein charmanter, gut gekleideter junger Mann aus Toria. Zumindest erweckte er nach außen hin diesen Eindruck.
„Immer diese Entscheidungen“, antwortete ich grinsend.
Er trat zu mir und legte mir einen Arm um die Schultern. „Wonach ist dir heute? Bist du ein unschuldiges junges Mädchen? Eine Jungfrau in Nöten? Eine widerspenstige Verführerin?“ Er spitzte die Lippen.
Lachend stieß ich ihn weg. „Was immer uns am meisten Geld einbringt.“ Normalerweise suchte ich mir mein Ziel selbst aus, aber Mackiel war an diesem Morgen gut gelaunt, und ich wollte ihm seine Laune nicht verderben. In letzter Zeit glitt er nur allzu leicht in Dunkelheit ab, obwohl ich tat, was ich konnte, um ihn im Licht zu halten.
Ich zuckte mit den Schultern. „Deine Entscheidung.“
Er hob die dunklen Brauen und neigte den Bowlerhut, bevor er den Blick wieder prüfend über die Menge wandern ließ. Die dunklen Kohlelinien, die seine tief liegenden Augen umrahmten, betonten das intensive Blau noch mehr. Ihm entging nichts. Ein vertrautes Lächeln umspielte seinen Mund.
Die Luft hier im Concord war frisch und kühl, ganz anders als der salzige Dunst mit dem immerwährenden Geruch von Algen, Fisch und verrottendem Holz, der unsere Heimatstadt am Hafen Torias einhüllte. Dies hier war Quadaras Hauptstadt und damit der kostspieligste Ort zum Leben. Er grenzte sowohl an Toria als auch an Eonia und Ludia. Nur Archia lag jenseits des Festlands.
Die Geschäfte im Erdgeschoss priesen beliebte Waren an, darunter auch eonistische Arzneien, Mode und Spielzeug aus Ludia sowie frische Lebensmittel und Pökelfleisch aus Archia, alles zusammengesammelt und feilgeboten von torianischen Händlern. Das Kreischen der Kinder, das Gemurmel der Geschäftsleute und der neueste geflüsterte Tratsch über die Königinnen hallten zwischen den gläsernen Ladenfronten.
Hinter den Gebäuden erhob sich eine undurchsichtige goldene Kuppel, die den Palast mitsamt aller vertraulichen Regierungsangelegenheiten einhüllte. Den Eingang zum Palast bildete ein altes Steingebäude, das man Haus der Eintracht nannte.
Während Mackiel nach einem Ziel Ausschau hielt, drückte er sich den Mittelfinger an die Lippen. Eine Beleidigung, die den Königinnen galt, die sich in ihrer Goldkuppel versteckten. Er sah mich an, tippte sich gegen den Mund und grinste.
„Der da“, sagte er, und sein Blick landete auf dem Rücken einer dunklen Gestalt, die gerade die Stufen vor dem Haus der Eintracht zum belebten Hauptplatz hinabschritt. „Hol mir sein Comm Case.“
Die Zielperson war eindeutig Eonist. Während wir Torianer uns gegen die beißende Kälte in mehrere Kleiderschichten gehüllt hatten, trug er einen eng anliegenden Dermasuit auf der Haut, ein eonistisches Material, das aus Millionen von Mikroorganismen bestand, die mithilfe ihrer Sekrete dafür sorgten, dass die Körpertemperatur des Trägers konstant blieb. Irgendwie eklig, aber mitten im Winter auch recht praktisch.
„Ein Bote?“ Ich warf Mackiel einen strengen Blick zu. Die Nachricht musste sehr wichtig sein, wenn ihr Überbringer aus dem Haus der Eintracht kam, dem einzigen Ort, an dem Torianer, Eonisten, Archianer und Ludisten gemeinsam Geschäfte machten.
Mackiel kratzte sich mit seinen mit Ringen geschmückten Fingern am Hals, eine nervöse Angewohnheit. „Zu schwer für dich?“
Ich schnaubte. „Quatsch.“ Ich war seine beste Diebin. Ich leerte Taschen mit kaum mehr als einer federleichten Berührung.
„Und vergiss nicht …“
„Sei schnell und noch schneller wieder weg.“
Er packte meinen Arm, bevor ich vom Dach verschwinden konnte. Sein Blick war ernst. Monate waren vergangen, seit er mich so angesehen hatte, als ob ich ihm etwas bedeuten würde. Fast hätte ich gelacht, aber es blieb mir irgendwo zwischen Brust und Kehle stecken.
„Lass dich nicht erwischen“, sagte er.
Ich grinste über seine Sorge. „Ich? Niemals!“ Damit kletterte ich vom Dach hinab und verschmolz mit der Menschenmenge.
Bevor ich jedoch sonderlich weit gekommen war, blieb plötzlich ein alter Mann vor mir stehen und drückte sich in einer Geste, die den vier Königinnen Respekt zollen sollte, vier Finger an die Lippen. Das war der angemessene Gruß, ganz im Gegensatz zu Mackiels Mittelfingerversion. Ich musste abrupt abbremsen, und die Stollen auf den Sohlen meiner Schuhe schabten über das abgetretene Kopfsteinpflaster. Trotzdem streifte ich mit der Wange die Schulter des Alten.
Verdammt! Was hatte dieser Palast nur an sich, dass man ihn mit einer derart stumpfsinnigen Verehrung begaffen musste? War ja nicht so, als könnte man durch das goldene Glas irgendwas sehen. Und selbst wenn. Die Königinnen interessierten sich nicht für uns. Jedenfalls ganz sicher nicht für jemanden wie mich.
Ich schlug dem Alten den Gehstock aus der Hand, und er stolperte zur Seite.
Mit ärgerlich verkniffener Miene drehte er sich zu mir um.
„Tut mir leid!“, sagte ich, klimperte mit den Wimpern und sah ihn treuherzig unter der breiten Krempe meines Huts hervor an. „Man hat mich geschubst.“
Seine Miene wurde weich. „Macht nichts, Liebes.“ Er tippte sich an den Hut. „Einen schönen Tag noch!“
Ich schenkte ihm ein Unschuldslächeln und versteckte dabei seine silberne Taschenuhr zwischen den Falten meines Rocks. Das hatte er jetzt davon.
Dann stellte ich mich auf die Zehenspitzen, um nach meiner Zielperson Ausschau zu halten. Da! Der Bote schien nicht viel älter zu sein als ich, etwa achtzehn. Sein Anzug schmiegte sich wie eine zweite Haut an ihn, von den Fingerspitzen bis hinauf zum Hals. Ich musste mich zwar tagtäglich mit Korsetts und steifen Röcken herumschlagen, aber diesen Anzug streifte man sich bestimmt auch nicht so ohne Weiteres über.
Trotzdem beneidete ich den Träger dieses Stücks um die Bewegungsfreiheit, die es ihm schenkte. Genau wie bei ihm waren auch meine Muskeln gut definiert vom vielen Rennen, Springen und Klettern. Für einen Torianer war es zwar nicht unüblich, in guter körperlicher Verfassung zu sein, aber meine Muskeln rührten, wie bei den meisten Torianern, nicht von regelmäßigen Segelfahrten nach Archia und vom Entladen der Güter an den Docks her. Ich war schon lange in die dunklere Seite Torias verstrickt. Unter den Schichten meiner bescheidenen Kleidung und den piksenden Korsetts erahnte niemand meine Durchtriebenheit. Meine Arbeit.
Am Fuß der Treppe vor dem Haus der Eintracht zögerte der Bote und rückte irgendetwas in seiner Tasche zurecht. Das war meine Chance. Der Alte vorhin hatte mich auf eine Idee gebracht.
Ich eilte auf die polierten Schieferstufen zu, die Augen voll vorgeblicher Bewunderung auf den Palast gerichtet, aber vielleicht sah ich auch einfach nur irgendwie dämlich aus, die vier Finger meiner Hand auf halbem Weg zum Mund. Als ich fast bei dem Boten war, blieb ich mit dem Zeh in einer Ritze zwischen zwei Schieferplatten hängen und stolperte nach vorn wie eine Stoffpuppe. Nicht sonderlich elegant, aber wirkungsvoll. Ich hatte auf die harte Tour gelernt, dass bloße Heuchelei schnell erkannt werden konnte. Und ich stürzte mich immer mit Leib und Seele in die Arbeit.
„Oh!“, rief ich, als ich gegen ihn krachte. Der durch und durch verdorbene Teil in mir freute sich über den dumpfen Aufprall, mit dem er auf den Steinplatten landete. Ich fiel auf ihn, wobei meine Hand zu seiner Tasche glitt.
Der Bote hatte sich rasch wieder gefasst, stieß mich beiseite und umklammerte seine Tasche fest. Vielleicht war dies nicht seine erste Begegnung mit Mackiels Dieben. Ich konnte mich gerade noch davon abhalten, Mackiel einen Blick zuzuwerfen, der ganz sicher eifrig vom Dach aus zusah.
Er sah immer zu.
Rasch wechselte ich die Taktik, rollte herum und schürfte mir dabei absichtlich das Knie auf dem Stein auf. Ich mimte ganz die torianische Unschuld, wimmerte und hob den Kopf, damit er mein Gesicht unter dem Hut erkennen konnte.
Er hatte dieses typisch eonistische Aussehen: Gleichmäßig geformte Augen, volle Lippen, hohe Wangenknochen und ein markantes Kinn. Das Aussehen, das sie für sich selbst konzipiert hatten. Schwarze Locken umrahmten sein gebräuntes Gesicht. Seine Haut war zart, aber widerstandsfähig. Ganz im Gegensatz zu meinem milchweißen Teint, der im Winterwind schuppig und in der brütenden Sommerhitze brennend rot wurde. Sein Blick ruhte auf mir. Seine Augen waren hell, beinahe farblos, nicht das übliche eonistische Braun, das vor der grellen Sonne schützte. Konnte er so besser im Dunkeln sehen?
„Ist alles in Ordnung?“, fragte er, wobei seine Miene jedoch nichts preisgab. Eonistische Gesichter wirkten im Allgemeinen wie eingefroren, wie so ziemlich alles in ihrem Quadranten.
Ich nickte. „Es tut mir so, so leid.“
„Schon gut.“ Doch er ließ die Tasche nicht los. Ich war mit meiner Scharade noch nicht am Ende.
Er sah von meinem Stiefel, der von dem Schaben über den Stein ganz abgewetzt war, zu meinem Knie, das ich umklammert hielt. „Ihr blutet ja“, rief er überrascht. Also hatte er dies hier tatsächlich für einen Trick gehalten, um an seine Habseligkeiten heranzukommen.
Ich sah auf meinen weißen Rock hinab. Ein roter Fleck war durch die Unterröcke gesickert und breitete sich nun auf Höhe meines Knies aus.
„Ach herrje!“ Ich wankte ein wenig und blickte in die grelle Wintersonne, bis meine Augen zu tränen begannen. Dann wandte ich mich wieder ihm zu.
„Hier.“ Er zog ein Taschentuch hervor und reichte es mir.
Ich biss mir auf die Lippe, um ein Grinsen zu unterdrücken. „Ich habe nicht darauf geachtet, wohin ich gehe. Der Palast hat mich abgelenkt.“
Der Blick dieser seltsam hellen Augen flackerte zu der goldenen Kuppel hinter uns. Seine Miene zeigte keinerlei Emotion. „Er ist schön“, sagte er schließlich. „Wenn die Sonne die Kuppel erleuchtet, dann sieht es aus, als wäre sie lebendig.“
Ich runzelte die Stirn. Schönheit war den Eonisten egal. Sie gehörte nicht zu den Werten ihrer Gesellschaft, was reichlich ironisch war, wenn man bedachte, wie gut aussehend sie allesamt waren.
Ich begann, meinen Rocksaum über das Knie hochzuschieben.
„Was macht Ihr denn da?“, fragte er hastig.
Ich verschluckte mich fast an meinem Lachen. „Ich wollte nur sehen, wie schlimm es ist.“ Ich tat so, als würde mir erst in diesem Moment wieder einfallen, woher er kam.
„Oh!“ Rasch zog ich den Rock wieder über meine Beine. „Wie unangebracht von mir.“ Intimität war den Eonisten ebenso fremd wie Gefühle.
„Schon gut.“ Aber er wandte das Gesicht ab.
„Könntet Ihr mir aufhelfen?“, fragte ich. „Ich glaube, ich habe mir den Knöchel verstaucht.“
Er streckte mir ungeschickt die Hände entgegen, beschloss dann aber, dass es sicherer wäre, meine bedeckten Ellbogen zu umfassen. Ich lehnte mich schwer gegen ihn, um sicherzustellen, dass er die Gewichtsverlagerung nicht wahrnahm, als ich eine Hand in seine Tasche gleiten ließ. Meine Finger schlossen sich um etwas Kühles und Glattes, das etwa so groß war wie meine Handfläche. Das Comm Case. Ich zog es heraus und schob es in die Geheimtasche meines Rocks. Sobald ich auf den Füßen stand, ließ er mich los, als hätte er soeben einen schon vor etwas längerer Zeit verstorbenen Fisch berührt.
„Glaubt Ihr, dass Ihr gehen könnt?“
Ich nickte, wankte aber zur Seite. Unerfahrene Taschendiebe verrieten sich oft, indem sie die Maske zu früh fallen ließen, nachdem sie hatten, was sie wollten. Außerdem tat mein Knie wirklich weh.
„Ich glaube nicht.“ Es klang schwach und atemlos.
„Wohin kann ich Euch bringen?“
„Dorthin.“ Ich deutete auf einen Stuhl und einen Tisch vor einem Café.
Er stützte mich am Ellbogen, während er mich dorthin führte. Dank seiner breiten Schultern teilte sich die Menge vor uns. Ich ließ mich auf den Stuhl fallen und drückte mir sein Taschentuch aufs Knie. „Danke!“ Ich senkte den Blick und hoffte, dass er nun verschwinden würde.
„Kommt Ihr zurecht? Ihr seid doch nicht allein hier, oder?“
Ich wusste, dass Mackiel uns im Auge behielt.
„Nein, ich bin nicht allein.“ Ich legte einen Hauch von Gereiztheit in meine Stimme. „Ich bin mit meinem Vater hier. Er hat da drüben etwas Geschäftliches zu erledigen.“ Ich winkte vage in Richtung der Läden.
Der Bote ging vor mir in die Hocke, damit er unter meine Hutkrempe sehen konnte. Ich wich etwas zurück. So aus der Nähe hatten seine Augen etwas Beunruhigendes. Sie waren beinahe wie Spiegel. Unter seinem Blick fühlte ich mich tatsächlich wie das Mädchen, das ich zu sein vorgab. Ein Mädchen, das mit ihrer Familie einen Tag im Concord genoss, um in den Vorzügen der anderen Quadranten zu schwelgen. Ein Mädchen mit einer intakten Familie. Ein Mädchen, das sein Glück nicht verloren hatte.
Der Moment verging.
Etwas flackerte in seiner Miene auf. „Seid Ihr sicher?“ War das echte Sorge?
Ich spürte das kühle Metall seines Comm Case an meinem Bein und Mackiels heißen Blick im Rücken.
Sei schnell und noch schneller wieder weg.
Ich musste mich zurückziehen. „Ich sollte mich jetzt etwas ausruhen. Ich komme schon zurecht.“
„Tja, dann“, sagte er und warf noch einen Blick auf das Haus der Eintracht. Seine Hand ruhte wieder auf der Tasche. Einem Boten wurde Unpünktlichkeit nicht gestattet. „Wenn wirklich alles in Ordnung ist …“ Er wartete darauf, dass ich ihn zurückhielt. Vielleicht hatte ich es mit meiner Zerbrechlichkeit doch etwas übertrieben.
„Ja, ich komme zurecht. Versprochen.“
Er nickte mir auf die für Eonisten typische steife Art zu und sagte dann: „Mögen die Königinnen ewig regieren. Gemeinsam und doch jede für sich.“ Die höfliche Standardverabschiedung auf interquadrantischer Ebene. Er wandte sich zum Gehen.
„Gemeinsam und doch jede für sich“, rezitierte ich, als er mir den Rücken zukehrte. Noch bevor er den ersten Schritt getan hatte, war ich schon aufgesprungen und in der Menge verschwunden.
Ich hielt das Comm Case fest umklammert, während ich davoneilte.
Kapitel 2
Iris - Königin von Archia
Regel eins
Um das fruchtbare Land Archias zu schützen, muss die Königin die bescheidene und arbeitsame Lebensweise der Bewohner wahren.
Iris rutschte auf dem ungemütlichen Thron herum und arrangierte ihre steifen Röcke neu. Die Mittagssonne fiel durch die Kuppeldecke und traf auf die goldene Scheibe darunter. Sie zeigte eine eingravierte Landkarte Quadaras, dicke Grate standen für die Mauern, die das Land unterteilten. Ein bernsteinfarbener Globus war in die Mitte der Scheibe eingelassen, brach das Sonnenlicht und warf die Strahlen gegen die Marmorwände des Thronsaals, woraufhin die vielen geschwungenen Worte aufleuchteten, die man in den Marmor gemeißelt hatte. Die Worte, die jede Königin und jeden Besucher daran erinnerten, wie der Austausch unter den Quadranten auszusehen hatte und an welche strengen Regeln sich die Königinnen halten mussten. Das Gesetz der Königinnen.
Die vier Königinnen saßen auf ihren Thronen im Kreis um die Goldscheibe herum. Die Quadranten blieben zwar getrennt, doch die Königinnen herrschten vom selben Hof aus.
Gemeinsam und doch jede für sich.
Jede von ihnen blickte auf ihren eigenen Bereich des runden Raums, dorthin, wo ein gemaltes Wappen verdeutlichte, wo ihr Quadrant lag.
Iris sah ihrem nächsten Besucher entgegen. Gerade trat er hinter dem Wandschirm hervor, der die Besucher des Hofs von den Königinnen trennte. Sie warf ihrer Schwesterkönigin Marguerite, die neben ihr saß, einen Blick zu. Marguerite hob amüsiert eine Braue, als sich der Mann so tief verbeugte, dass seine Nasenspitze den polierten Marmor zu seinen Füßen streifte. Er stand auf dem archianischen Wappen: eine ländliche Insel, eingefasst von Zweigen, Blättern und Blumen mit einem Hirsch auf einem Berg, dargestellt in kühnen goldenen Wirbeln.
Iris war nun dreißig, was bedeutete, dass sie ihre archianische Heimat seit zwölf Jahren nicht mehr gesehen hatte. Aber solange sie lebte, würde sie die frische Luft, die üppigen Wälder und die sanften Hügel nie vergessen.
Nachdem sich der Mann wiederaufgerichtet hatte, mied er ihren Blick. Schade, denn sie hatte wirklich hübsche Augen.
„Meine Königin.“ Die Stimme des Mannes bebte.
Gut. Iris kultivierte Furcht. Ein zeitaufwendiges, aber nützliches Bestreben.
Sie wusste, dass man Archia nur allzu leicht als den Quadranten mit dem geringsten Wert abtun konnte, da die Archianer größtenteils unter sich blieben und den Kanal, der sie vom Festland trennte, nur selten überquerten, weil sie Technologie im Allgemeinen misstrauten. Sie konzentrierten sich auf die harte Arbeit und ein gutes, wenn auch bescheidenes Leben.
„Sprich!“ Iris machte eine Geste zu dem Mann vor ihr. „Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit.“
Ein Schweißtropfen rann dem Mann über die Stirn und blieb an seiner Nasenspitze hängen. Er wischte ihn nicht fort. Iris zuckte mitfühlend mit der eigenen Nase – mehr Mitgefühl würde der Kerl heute nicht bekommen.
„Ich bin hergekommen, um Euch um Energie zu bitten“, sagte er. Sie runzelte die Stirn, und rasch fügte er eine Erklärung an. „Stromenergie – wir brauchen Elektrizität.“
Iris musste sich in Erinnerung rufen, dass er der archianische Gouverneur war, auch wenn dieser Titel in ihren Augen wenig bedeutete. Die Königinnen besaßen die eigentliche Macht. Sonst niemand.
Macht auszuüben war ein Spiel, und im Laufe der Jahre hatte Iris es perfektioniert.
„Ihr braucht Elektrizität?“ Sie beugte sich vor. „Nein.“
Während die anderen Quadranten über Elektrizität verfügten, nutzte man in Archia weiterhin nur das, was mit Herz und Handbetrieben wurde – ein traditioneller archianischer Leitspruch.
Endlich hob der Gouverneur zittrig die Hand, um sich den Schweiß von der Stirn zu wischen.
„Wenn wir Strom haben, dann können wir auch Maschinen einsetzen“, fuhr er erklärend fort. „Die Arbeiter haben Schwierigkeiten, den von Toria festgelegten jährlichen Abgabeplan zu erfüllen. Bitte bedenkt das, meine Königin.“
Sie lehnte sich zurück und ließ ein gehauchtes Lachen hören. „Ihr wisst es doch besser, als mich um so etwas zu bitten.“ Es stimmte, dass Quadaras Bevölkerung beständig wuchs, und ganz gleich, was sie auch versuchten, abgesehen von Archia gab es nirgendwo fruchtbaren Boden.
Quadaras geteilte Nation war ein Ökosystem, in dem jeder Quadrant seinen Part spielte. Archia sorgte für Getreide und natürliche Ressourcen, Eonia entwickelte Medizin und Technologie, Ludia war für Kunst, Mode und Unterhaltung zuständig, und Toria regelte Importe und Exporte zwischen den Quadranten. Das Gesetz der Königinnen hielt das System zusammen.
Auf Archia ruhte die Hoffnung des ganzen Landes. Weshalb Iris ihre Heimat beschützen musste, koste es, was es wolle. Sie konnte es nicht riskieren, dass die Böden durch zu intensive, maschinenbetriebene Bewirtschaftung ausgelaugt wurden. Wenn sie Archia zerstörten, dann würde ganz Quadara hungern.
Manche mochten Archia als primitiv betrachten, aber es war nicht schwach. Nicht, solange Iris herrschte.
Der Gouverneur schob die Unterlippe vor. „Ich weiß, dass wir die Technologien aus den anderen Quadranten nicht übernehmen sollen, aber …“
„Und warum genau langweilt Ihr mich dann mit dieser Unterhaltung?“
„Vielleicht solltest du ihm seine Bitte gestatten?“, warf Marguerite ein. Mit ihren vierzig Jahren war sie die älteste der Königinnen und auch diejenige unter ihnen, die am längsten regierte, was sie oft zur Stimme der Vernunft machte. Obwohl ihre letzte Besprechung des Tages abgesagt worden war, verfolgte sie das Geschehen weiterhin mit Interesse. Wie bei allen Torianern konnte ihre Neugier, was die anderen Kulturen betraf, einfach nicht gestillt werden.
Was für eine Zeitverschwendung für sie, dachte Iris. Sie warf ihrer Schwesterkönigin einen strengen Blick zu. „Das betrifft dich nicht, Marguerite.“ Allerdings klang es versöhnlich, denn es lag der torianischen Königin nun einmal im Blut, sich einzumischen.
Marguerite strich sich eine langsam ergrauende Locke ihres kastanienbraunen Haars hinters Ohr. „Du weißt doch sicher noch, dass ich Corra darum gebeten habe, ihre Ärzte damit zu beauftragen, einen Impfstoff zu entwickeln, damit sich die Blutseuche nicht noch weiter ausbreitet. Manchmal müssen wir die Regeln beugen, solange wir sie nicht brechen.“
Iris neigte den Kopf und betrachtete Corra mit ihrem geflochtenen schwarzen Haar, das sie nach eonistischer Art hochgesteckt hatte. Die goldene Krone schimmerte im Kontrast zu ihrer dunkelbraunen Haut. Doch die fünfundzwanzigjährige Königin erwiderte ihren Blick bei der Erwähnung ihrer Wissenschaftler nicht. Stessa dagegen, die Königin Ludias, hob den Kopf und verzog leicht das Gesicht, als würde Iris ihr auf die Nerven gehen. Vermutlich war es auch so, denn alles, was Iris sagte oder tat, schien die Sechzehnjährige zu verärgern.
„Das ist etwas ganz anderes“, sagte Iris an Marguerite gewandt, ohne auf Stessas Miene zu achten. „Die Seuche ist eine Bedrohung für dein gesamtes Volk. Der Impfstoff ist eine Ausnahme, er hat nichts in deinem Quadranten tief greifend verändert. Selbst wenn ich den Einsatz von Maschinen für eine begrenzte Zeit erlaube, wie sollen wir danach zu unseren Traditionen zurückkehren? Das kann ich nicht riskieren.“
Marguerite lächelte ihr verständnisvoll, aber amüsiert zu, als hielte sie Iris einfach nur für stur.
„Nein“, verkündete Iris und wandte sich wieder dem archianischen Gouverneur zu. „Die Elektrizität entstammt nicht unserem Quadranten, und deshalb werden wir sie auch niemals einsetzen. Wir werden uns nicht von Maschinen und ihrer Hexerei abhängig machen.“
Iris hatte gesehen, was die Technologie aus Eonia gemacht hatte, und sie würde nicht zulassen, dass in ihrem Quadranten dasselbe geschah. Da Eonia weit oben im Norden lag, wo die meisten Landstriche gefroren und unwirtlich waren, hatten die Menschen dort keine andere Wahl, als sich ausschließlich auf den technologischen Fortschritt und sogar genetische Veränderungen zu konzentrieren, um zu überleben. Im Tausch dagegen hatten sie jedoch einen Teil ihrer Menschlichkeit eingebüßt. Jedenfalls sah Iris das so. Unwillkürlich schaute sie wieder Corra an.
Der Blick des Gouverneurs zu den vier elektrischen Kronleuchtern, die in den vier Korridoren hingen, die zum zentralen Thronsaal führten, entging ihr nicht. Iris wusste, dass es den Eindruck machte, als würde sie selbst die Vorzüge aller vier Quadranten genießen, doch der Gouverneur wusste ja auch nicht, dass sie immer noch bei Kerzenlicht las und in den natürlichen heißen Quellen ihres Gartens badete, anstatt das heizbare Wassersystem des Palastes zu nutzen. Allerdings würde sie ihre Angewohnheiten bei der Körperpflege durchaus nicht mit ihm erörtern.
Als er nichts mehr sagte, hob Iris eine Braue und fragte: „Noch etwas?“
Der Gouverneur schüttelte den Kopf.
„Gut. Sollte irgendjemand meine Entscheidung anfechten wollen, dann wissen sie ja, wo ich zu finden bin. Der Palast steht meinem Volk immer offen.“
Damit erhob sie sich, stieg vom Podest und überließ den Thronsaal ihren Schwesterköniginnen.
Iris beschloss, den Rest des Tages in ihrem Palastgarten zu verbringen. Dort, wo sie aufgewachsen war, hatte sie zahllose Stunden in der makellosen Natur verbracht, die ihr Heim umgeben hatte. Dort hatte sie sich die Zeit ihrer Herrschaft ausgemalt und darüber nachgedacht, wie sie einen ganzen Quadranten regieren würde. Iris war oft allein gewesen, und sie hatte alles getan, um sich auf ihre Zeit als Königin vorzubereiten. Nie hätte sie jedoch erwartet, dass es einmal jemanden geben würde, der Einfluss auf ihre Herrschaft nehmen könnte.
Oder auf ihr Herz.
Der Garten war im archianischen Teil des Palastes angelegt und in vier Bereiche unterteilt worden, genau wie die Nation selbst. Er lag außerhalb der goldenen Kuppel auf einer Klippe, von der aus man auf den Kanal blicken konnte, auf dessen anderer Seite die Insel Archia lag. Vor langer Zeit hatte eine ihrer Vorfahrinnen einen Zugang zur Natur verlangt. Das Gesetz der Königinnen verbot den Königinnen, den Palast jemals zu verlassen, zu ihrer eigenen Sicherheit und um sie von äußeren Einflüssen fernzuhalten.
Iris würde niemals wieder einen Fuß in ihren Quadranten setzen, niemals wieder würde sie die Schönheit Archias in sich aufsaugen und die Hirsche und Rehe bewundern können, die durch die Berge streiften.
Sie ließ sich auf ihre hölzerne Sitzbank sinken, was diese ins Gras drückte, während sie vollständig unter Iris’ schwarzem Rock verschwand. Sie nahm die schwere Krone ab und legte sie auf den Tisch neben sich. Dann hob sie das Gesicht und genoss das Sonnenlicht auf ihrer blassen Haut. Die warmen Quellen sprudelten ganz in der Nähe und erinnerten sie an den sanften kleinen Bach nicht weit von ihrem früheren Zuhause entfernt.
Doch das hier würde ihr reichen müssen.
Wie es das Gesetz der Königinnen vorschrieb, war Iris von Pflegeeltern großgezogen worden, außerhalb des Palastes, in jener Region, über die sie eines Tages herrschen sollte. Sie war zwar in einem recht bescheidenen Steincottage herangewachsen, doch es hatte ihr nie an etwas gefehlt. Sie hatte einfach nicht gewusst, wonach sie sich hätte sehnen sollen. Dinge, die man nie gesehen und nie erfahren hatte, konnten einem nicht fehlen. Sie hatte alles über ihr Land, die Tiere und ihr Volk gelernt. Und über Quadaras dunkle Vergangenheit.
Archia war jahrhundertelang unberührt von den Problemen der Nation geblieben. Tatsächlich hatte man die fruchtbare Insel erst entdeckt, nachdem die Torianer ihre Schiffe gebaut hatten und gen Westen gesegelt waren. Der Rest der Nation hatte sich am Rande der Verzweiflung befunden, da ihre natürlichen Ressourcen so gut wie aufgebraucht waren. Und dann hatten sie Archia gefunden, reif zum Pflücken.
Die unterschiedlichen Regionen verfügten zwar jeweils über eigene Stärken und Mittel, doch es gab auch eine Schwachstelle, die sie alle vereinte. Neid.
Und so waren die Quadrantenkriege ausgebrochen. Sie hatten beinahe ein Jahrzehnt angehalten und Tausende von Leben gekostet. Jeder der anderen Quadranten hatte versucht, Archia zu erobern, aber das waren dumme Vorhaben gewesen. Die Eonisten waren mit der Aufzucht von Vieh nicht vertraut gewesen, die Torianer waren auf der Insel schnell unruhig geworden und hatten neue Länder entdecken wollen, und die Ludisten hatten sich ihre erlesene Kleidung nicht bei der Feldarbeit schmutzig machen wollen.
Dann hatten jene Königinnen, die Quadara gegründet hatten, die Mauern gebaut, die sich noch heute durchs Land zogen und die Regionen unterteilten, und damit die Quadrantenkriege beendet. Die Mauern hatten ihnen Raum zum Atmen gegeben und den Quadranten gestattet, sich unabhängig voneinander, aber zugleich harmonisch weiterzuentwickeln.
Archia war wieder sicher.
An ihrem achtzehnten Geburtstag hatte Iris ihre Heimat zum ersten Mal verlassen, nachdem man sie darüber informiert hatte, dass ihre Mutter gestorben war. Sie war in einem torianischen Schiff über den Kanal gesegelt und hatte den Palast betreten. Ohne Zögern hatte sie diese neue Welt und ihren Thron angenommen und darauf bestanden, Hof zu halten, nur Minuten nachdem man ihre Mutter unter dem Palast zur ewigen Ruhe gebettet hatte. In jener Nacht war sie bis zum frühen Morgen wach geblieben und hatte Bücher über archianische Geschichte und Diplomatie gelesen. Nichts konnte Iris erschüttern. Nicht einmal der Tod ihrer Mutter.
Sie öffnete ihre grünen Augen und sah zum leuchtend blauen Himmel empor. Sie genoss es, dem immerwährenden Gold der Kuppel zu entkommen. Im Palast war jeder Raum und alles darin beständig in ein goldenes Licht getaucht. Selbst nachts verschwammen die Gänge in einem dunklen Bernsteinton, als würde es die Finsternis nicht wagen, die Königinnen mit ihren tintenschwarzen Fingern zu berühren.
Während Iris zu den Wolken hinaufsah, dachte sie an ihren Vater. Nicht den Vater, dessen Blut sie teilte – ein Mann, dessen Identität ihre Mutter nie preisgegeben hatte. Sondern an jenen Mann, der sie in Archia großgezogen hatte. Als sie noch ein Kind gewesen war, hatte er ihr von den Königinnen über ihnen erzählt, von den verstorbenen Königinnen, die in einem Quadranten ohne Grenzen lebten und auf jene hinabblickten, die sie zurückgelassen hatten. Wann immer Iris einsam gewesen war, hatte sie zu den Wolken emporgeblickt und ihre schlimmsten Ängste und ihre seltsamsten Träume mit ihnen geteilt, in dem Wissen, dass ihre Geheimnisse bei ihnen sicher waren. Bei ihren treuesten Vertrauten.
Nachdem sie in den Palast gekommen war und die anderen Königinnen kennengelernt hatte, hatten sie jeden Abend zusammen verbracht. Oft waren sie über die „schickliche“ Zeit hinaus wach geblieben und hatten über ihre Kindheit, ihre Familien und ihre Quadranten gesprochen. Iris war nicht mehr allein.
Trotzdem hob sie oft den Blick zum Himmel, doch nun sprach sie mit ihrem längst verstorbenen Vater.
„Vater, ich bin hart geblieben“, sagte sie. „Das Gesetz der Königinnen steht an erster Stelle und wird es auch immer tun. Trotzdem gibt es gewisse Regeln, die uns Königinnen – die mich betreffen, die ich im Laufe der Jahre mehr und mehr als überflüssig betrachte.“ Schon allein diese Worte laut auszusprechen fühlte sich falsch an. Iris schüttelte den Kopf. Sie würde stärker sein müssen. Eine Frau mit stählernem Rückgrat. „Wir sind die Königinnen. Wir sollten jene Regeln ändern können, die unsere Quadranten und den Frieden, den wir wahren, nicht beeinflussen. Wir sollten wenigstens ein Mindestmaß an Kontrolle über unser eigenes Leben haben. Ich werde weiterhin für Archia und für alles, was wir haben, kämpfen, aber ich will mehr.“ Wieder schüttelte sie den Kopf und dachte an die Bitte des Gouverneurs. „Nicht mehr für Archia, sondern mehr für mich.“ Sie fand es grässlich, wie schwach das klang. „Ich habe einen Plan.“ Schwer stieß sie die Luft aus. „Ich habe zu viele Jahre geschwiegen. Aber damit ist jetzt Schluss. Morgen werden sich die Dinge verändern. Das Gesetz der Königinnen wird sich verändern. Morgen werde ich …“
Eine Biene stach sie in die Kehle. Ein schmerzhaftes Piken, gefolgt von einem dumpfen Schmerz.
Eigentlich waren sämtliche Bienen und Insekten mit einem Sprühmittel aus den königlichen Gärten entfernt worden. Noch so eine wunderbare eonistische Erfindung, dachte Iris ironisch. Sie hatte nichts dagegen einzuwenden, ihren Garten mit den Wesen zu teilen, die natürlicherweise hierhergehörten. Aber ihre Ratgeberin hatte darauf bestanden, dass es für Iris’ Sicherheit das Beste sei.
Ein Lächeln erschien auf ihrem Gesicht. Vielleicht hatte die Natur am Ende doch über die Technologie gesiegt und das Sprühmittel wirkungslos gemacht. Sie konnte es kaum erwarten, das an diesem Abend beim Essen Corra unter die Nase zu reiben.
Der Bienenstich schmerzte immer schlimmer, und nun konnte Iris nicht mehr schlucken. Speichel sammelte sich in ihrer Kehle. War es eine allergische Reaktion?
Sie hob die Hand an den Stich und berührte eine klaffende Wunde in ihrer Haut. Als sie die Finger zurückzog, waren sie dunkel von Blut. Ein Wehklagen kam ihr gurgelnd über die Lippen.
Eine Gestalt ragte über ihr auf, die Zähne vor Bosheit und Entzücken gebleckt. Ein schmales Messer blitzte im Sonnenlicht auf. Blut troff von der Klinge.
Wut stieg in Iris auf, während warmes Blut ihren Hals hinabrann. Sie riss die Arme hoch und stieß ihre Krone vom Tisch.
Das ist ein Skandal! Ich bin die archianische Königin!
Wie kann es jemand wagen, mir die Kehle durchzu…
Was hat dich dazu inspiriert „Four Dead Queens“ zu schreiben?
Das mag ein wenig klischeehaft klingen, aber ich hatte einen Traum darüber, in einer Pferdekutsche zu sitzen, an der ein futuristisches silbernes Auto vorbeigeflogen ist. Als ich aufgewacht bin, habe ich mich gefragt, was für eine Welt mit solch unterschiedlichen Technologien existieren könnte, und wie es die Menschen, die in ihr leben, beeinflussen würde. Abgesehen davon bin ich ein Riesenfan von Murder-Mysteries und ich wollte meine Liebe für das Phantastische mit einer Murder-Mystery im Stil von Agatha Christie kombinieren. Es war mir auch sehr wichtig, ein überwiegend weiblich geprägtes Figurenensemble zu schaffen, in welchem sich die Königinnen gegenseitig unterstützen.
„Four Dead Queens“ war dein Debüt. War es sehr schwer, Verleger davon zu überzeugen?
Nicht wirklich, aber es war ein langer Weg bis dorthin. Ich hatte schon vorher zwei Manuskripte geschrieben, für die ich keinen Verlag gefunden habe. Bei meinem ersten Manuskript gab es nur eine Agenturanfrage nach dem vollständigen Text, und mehr als einhundert Absagen. Für das zweite Manuskript haben 12 Agenturen den vollständigen Text angefragt, aber letzten Endes alle abgesagt. Obwohl ich positive Rückmeldungen von Agenten bekommen habe, hatten sie bereits zu ähnliche Titel im Angebot. Also habe ich mich dazu entschlossen, etwas zu schreiben, das, wie ich hoffte, einzigartig sein würde. Ich habe mir eine Liste geschrieben mit all den Dingen, die ich an YA, Belletristik im Allgemeinen, Filmen und im Fernsehen mochte. Einschließlich Murder-Mysterys, unerlaubter Liebe, Schwarzmärkte, königliche Machenschaften und Intrigen , verheerende Betrügereien und geheime Allianzen. Daraus wurde „Four Dead Queens“.
Packende Fantasy oder spannende Murder-Mystery. Wir würdest du das Genre deines Buches am besten beschreiben?
Gute Frage! Ich würde sagen, es ist eine Murder-Mystery, die in einer phantastischen Welt spielt. Es gibt keine Magie oder Questen oder Auserwählte – obwohl ich diese Art von Geschichten liebe! Die Murder-Mystery treibt die Handlung vor dem Hintergrund einer komplexen phantastischen Welt voran.
Was ist das Besondere daran, Bücher im Bereich „Young Adult“ zu schreiben?
YA lese und schreibe ich am liebsten. Ich liebe es, da die Geschichten so handlungsgetrieben sind mit komplexen Figuren, die einen förmlich aus dem Buch heraus anspringen. Bei YA werden Risiken eingegangen, Genres gemixt und Grenzen ausgetestet. Regeln und Einschränkungen werden gemacht, um gebrochen zu werden. Die Geschichten entfalten sich in einem halsbrecherischen Tempo, sind spannend und man kann sie nicht aus der Hand legen.
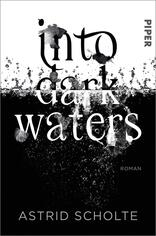

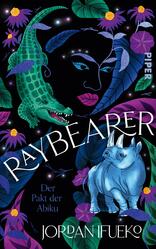


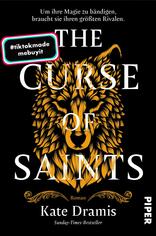


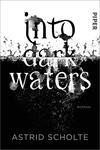


DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.