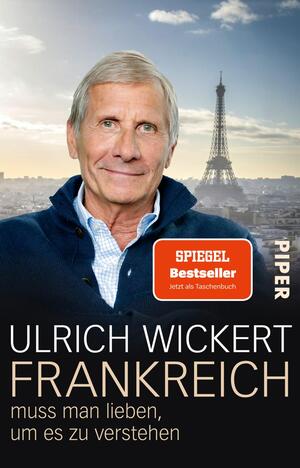
Frankreich muss man lieben, um es zu verstehen
Frankreich muss man lieben, um es zu verstehen — Inhalt
Frankreich ist mehr als nur der große Nachbar Deutschlands. Es ist ein Land, das sich vom Erbfeind zum vertrauten Partnerland gewandelt hat, das nach dem Brexit als Pfeiler Europas so wichtig ist wie nie zuvor. Und es ist seit jeher ein Sehnsuchtsland der Deutschen, die seine Eleganz und seinen Stil, die Küche und Kultur bewundern. Aber Frankreich steckt in der Krise: Der Niedergang der Wirtschaft, politische Skandale und Stagnation, der Aufstieg des rechtsradikalen Front National, soziale Spannungen und islamistische Attentate haben das Selbstbewusstsein der Grande Nation erschüttert.
Ulrich Wickert ist der bekannteste Frankreich-Experte Deutschlands, jahrelang berichtete er als Auslandskorrespondent aus Paris, lebt bis heute neben Hamburg auch in Südfrankreich. „Frankreich muss man lieben, um es zu verstehen“ ist das Resümee seiner lebenslangen Faszination und Auseinandersetzung mit einem Land, das uns so vertraut scheint, aber doch viele Geheimnisse birgt.
Leseprobe zu „Frankreich muss man lieben, um es zu verstehen“
Wechselnde Identitäten
„Bevor er Frankreich schlechtmacht, soll er erst einmal hier arbeiten“, sagte Babette mit kräftiger Stimme. Sie drehte sich um, bückte sich und holte die Zeitungen hervor, die sie wie immer für mich zurückgelegt hatte. Wenn ich spätnachmittags hier in dem kleinen Dörfchen in Südfrankreich an ihren Kiosk kam, waren die Zeitungen vom Tage häufig schon ausverkauft.
Der tägliche Besuch wird stets mit einem kleinen Schwatz verbunden, sei es über die Familie, das Wetter oder auch mal über die Politik. Das Gespräch schafft [...]
Wechselnde Identitäten
„Bevor er Frankreich schlechtmacht, soll er erst einmal hier arbeiten“, sagte Babette mit kräftiger Stimme. Sie drehte sich um, bückte sich und holte die Zeitungen hervor, die sie wie immer für mich zurückgelegt hatte. Wenn ich spätnachmittags hier in dem kleinen Dörfchen in Südfrankreich an ihren Kiosk kam, waren die Zeitungen vom Tage häufig schon ausverkauft.
Der tägliche Besuch wird stets mit einem kleinen Schwatz verbunden, sei es über die Familie, das Wetter oder auch mal über die Politik. Das Gespräch schafft zwischenmenschliche Wärme. Wer vor mir dran ist, hält ebenfalls seinen Schwatz, wer nach mir dran ist, wartet geduldig.
Meine unschuldige Frage „Wie geht es denn Ihrem Sohn?“ hatte einen Temperamentsausbruch bei Babette ausgelöst. Dieser Sohn studierte Industriedesign und wollte später für die Autoindustrie arbeiten. Er hatte ein Praktikum in Österreich absolviert, dort monatlich 1400 Euro verdient. Das hatte ihm gut gefallen. In Frankreich erhält ein Praktikant nur drei- bis vierhundert Euro.
Jetzt machte er ein weiteres Praktikum in Italien. Da werde er aber nicht bleiben, klagte er. Nicht nur die schlechte Bezahlung, auch die Arbeitsbedingungen störten ihn. Niemand beherrsche Englisch, die Fachsprache des Internets, in der er kommunizierte.
„Was dann?“, hatte Babette gefragt.
„Frankreich hat auch keine Zukunft! Ich gehe nach London“, hatte der Sohn geantwortet und damit ihren Zorn geweckt. „Du hast hier doch noch nie gearbeitet, du hast keine Ahnung. Du musst Frankreich wenigstens eine Chance geben. Du bleibst erst einmal hier!“ Noch war der Sohn
mit dem Studium nicht fertig, danach würde man weitersehen.
Aus meinem unmittelbaren Umfeld kannte ich ähnliche Fälle. Clarysse etwa, die Tochter guter Bekannter aus Nizza, hatte bei einer Investmentbank in Paris gearbeitet, war aber unzufrieden mit der Stimmung im Land und deshalb mit ihrem Mann nach London gezogen, wo beide gut bezahlte Jobs bekamen – und zwei Söhne. Oder Saskia, die Tochter eines anderen Freundes, die mit ihrem Partner, den sie noch aus der Schulzeit kannte, nach London gezogen war, weil sie dort eine bessere Zukunft für sich sah; für ihn spielte der Wohnsitz kaum eine Rolle, da er als Designer für internationale Werbeagenturen zu Hause arbeitete.
Etwa ein Drittel aller jungen Franzosen denkt wie der Sohn von Babette: Frankreich hat keine Zukunft. Viele junge Menschen ziehen daraus die Konsequenz und gehen weg. Rund dreihunderttausend junge Franzosen leben inzwischen in London, Zehntausende in Berlin und anderen attraktiven Städten – manche hat es bis nach Australien verschlagen.
In den Augen vieler junger Franzosen ist Frankreich ein Land, das von Funktionären für Funktionäre regiert wird. Die Meritokratie, jene Kultur, auf die Frankreichs Elite so stolz ist, weil sie den Aufstieg nach einem traditionellen Ausbildungssystem regelt, blockiert unkonventionelle Karrieren. In einem Blog schreibt ein junger Franzose: „Mit dem
Master-Abschluss einer der besten Universitäten der Welt kann ich in meinem Bereich in Frankreich nicht arbeiten, weil ich ein Diplom einer französischen Universität benötige. London ist so viel besser.“
Ein anderer fügt hinzu: „In Frankreich giltst du bis 35 als Berufsanfänger, und ab 45 bist du zu alt und zu teuer. Das wahre Problem Frankreichs ist die Unfähigkeit der Unternehmensleitungen.“
Da London durch den Eurotunnel nur zwei Zugstunden von der französischen Hauptstadt entfernt liegt, nennt man die britische Hauptstadt inzwischen schon das 21. Arrondissement von Paris. In der Regel findet ein junger Franzose dort schneller einen Job als zu Hause.
Der Pessimismus der Franzosen, der nicht nur die Jungen lähmt, wird genährt von Zweifeln an den Fähigkeiten der wirtschaftlichen, politischen und sozialen Institutionen, das kollektive Leben sinnvoll zu organisieren. Die Neigung, gleich das Schlimmste zu befürchten, hat zu einem unermesslichen Verlust an Vertrauen in den Staat geführt.
Dieses Unwohlsein ist nicht neu. Schon vor vierzig Jahren beschrieb Alain Peyrefitte, langjähriger Minister unter de Gaulle und Mitglied der Académie française, in seinem Bestseller Le Mal français (Was wird aus Frankreich?, 1976) die Angst vor dem Niedergang als eine typisch französische Leidenschaft. In seinem 2014 erschienenen Essay La hantise du déclin sprach der französische Historiker Robert Frank gar von einer nationalen Krankheit, die es den Franzosen ermögliche, darüber zu streiten, wer denn nun verantwortlich sei für den Abstieg. Inzwischen gibt es für diese Art der Diskussion eigene Begriffe wie déclinologie (die Kunde vom Niedergang) oder déclinisme (die Theorie des Niedergangs).
Umfragen wie die vom Januar 2014, wonach 85 Prozent der Franzosen meinen, ihr Land befände sich im Verfall, zeigen allerdings auch, dass der déclinisme hauptsächlich im rechten Wählerspektrum zu Hause ist. Dort wird vor allem der Verlust der politischen und wirtschaftlichen Macht beklagt, den man insbesondere im Vergleich mit anderen Nationen wie Deutschland empfindet. Die linke Wählerschaft befürchtet dagegen, wenn sie von Niedergang spricht, den Niedergang der Werte, auf die der französische Staat seit der Revolution baut: liberté, égalité, fraternité.
„Der französische Schwindel“ überschrieb Luc Bronner, Chefredakteur von Le Monde, einen Kommentar wenige Monate vor den Präsidentschaftswahlen 2017. „Frankreich dreht sich der Kopf, das Land ist wie von einem Schwindel gepackt. Die Angst. Die Leere. Die Anziehungskraft der Leere. Diese drei Worte beschreiben den Schwindelzustand: das Fehlen einer Perspektive, das Misstrauen gegenüber den Institutionen und das Gefühl … dass die französische Gesellschaft ins Unbekannte abstürzen könnte.“
Der Betrachter lehnt sich erst einmal zurück. Nichts Neues, sagt er sich, Frankreich befindet sich wieder einmal in einer Identitätskrise. Solche Krisen gab es schon immer, sie scheinen zum französischen Selbstverständnis dazuzugehören. Schon Anfang des 19. Jahrhunderts klagte der Schriftsteller und Politiker François-René de Chateaubriand, Frankreich, „der reifste und am meisten fortgeschrittene Staat“, zeige zahlreiche Symptome der Dekadenz.
Um diese Zeit war Frankreich mit rund 29 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Land Europas. Auf dem Gebiet des späteren Deutschen Reiches wurden nach dem Ende der Napoleonischen Kriege nur rund 25 Millionen Einwohner gezählt. 1850 stagnierte die französische Bevölkerung jedoch bei 37 Millionen und wuchs in den folgenden hundert Jahren nur noch um 3 Millionen. Dagegen zählte Deutschland um 1900 schon 55 Millionen Einwohner. Die Zahl der Einwohner war nicht zuletzt militärisch relevant: je größer die Bevölkerung, desto mehr Soldaten! Die daraus entstehenden Ängste unserer Nachbarn hielten lang an und führten noch in der Diskussion um die Wiedervereinigung 1989/90 zu entsprechenden Warnungen französischer Poli-
tiker, die Deutschen wären damit auf einen Schlag 17 Millionen Menschen mehr.
Das langsame Bevölkerungswachstum in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts führte in Frankreich zu einem erheblichen Arbeitskräftemangel. Ab 1880 lebten und arbeiteten eine Million Ausländer in Frankreich. Italiener, Polen, Deutsche, Spanier und Belgier stellten 7 bis 8 Prozent der Erwerbstätigen. Damals kam es zu ersten ausländerfeindlichen Kundgebungen.
Die Niederlage gegen Preußen 1870/71 hatte dem französischen Nationalbewusstsein einen schweren Schock versetzt. Frankreich war jetzt ein mächtiger Gegner entstanden, dessen Wirtschaft genauso rasant wuchs wie seine Bevölkerung. Nicht wenige sehnten sich nach dem alten Frankreich zurück und waren der Meinung, die Dritte Republik werde das Land in den Ruin führen.
Der unter diesen Vorzeichen entstehende Nationalismus gebärdete sich höchst aggressiv und richtete sich gegen zahlreiche gesellschaftliche Gruppen, die man als „innere Feinde“ bezeichnete. Der Schriftsteller Charles Maurras nannte die Freimaurer, die Juden, die Protestanten und die Ausländer „die vier Verbündeten der Gegner Frankreichs“, die das Vaterland angeblich zugrunde richten wollten. Der Antisemitismus gipfelte in der Auseinandersetzung um die Verurteilung des jüdischen Hauptmanns Alfred Dreyfus 1894. In diesen Jahren machte das Land eine schwere Krise durch, die man als erste nationale Identitätskrise bezeichnen kann.
Unterdessen wuchs das französische Kolonialreich in Asien und Afrika, was ebenso zum neuen Selbstbewusstsein beitrug wie die Tatsache, dass Frankreich während der Belle Époque in der gesamten europäisch dominierten Welt tonangebend war. Am Vorabend des Ersten Weltkriegs war Frankreich unbestritten wieder eine Großmacht. Die Parteien, die 1913 gegen das Gesetz zur Einführung einer dreijährigen Wehrpflicht gestimmt hatten, gewannen im Jahr darauf zwar die Wahlen, hatten aber keine Zeit mehr, die Wehrpflicht aufzuheben. Im Zeichen des drohenden Krieges schlossen sich die einstigen politischen Gegner zur Union sacrée, zu einem geheiligten Bund zusammen. „Der Wille der Franzosen, eine Nation zu sein“, so der Philosoph Julien Benda, habe sich „in Wirklichkeit erst nach zwanzig Jahrhunderten verwirklicht“ – am 2. August 1914, am Abend vor der Kriegserklärung des Deutschen Reiches.
Im Geschichtsbewusstsein der Franzosen blieb la Grande Guerre das wesentliche Ereignis des 20. Jahrhunderts. Im Mai 2016 inszenierte der deutsche Regisseur Volker Schlöndorff auf Einladung des französischen Präsidenten François Hollande die Feier zum Gedenken an die Schlacht von Verdun. Jedem der viertausend Jugendlichen, die kamen – tausend aus Deutschland, dreitausend aus Frankreich – , hatte Schlöndorff aufgetragen, ein Erinnerungsstück an den Ersten Weltkrieg aus seiner näheren Umgebung mitzubringen. Während die Deutschen an dieser Aufgabe auf der ganzen Linie scheiterten, brachte jeder der französischen Jugendlichen einen Brief von der Front oder ein anderes Stück aus Familienbesitz mit, das an den Ersten Weltkrieg erinnerte. Der 11. November, der Tag des Kriegsendes, ist heute noch ein staatlicher Feiertag, der mit Kranzniederlegungen begangen wird.
Anfang der dreißiger Jahre stürzte Frankreich in eine weitere große Krise. In kurzem Abstand wechselten die Regierungen, keine konnte sich lange halten. Enthüllungen über die Korruption der politischen Eliten, wirtschaftliche Depression, Geburtenrückgang, Ängste vor massiver Zuwanderung, extreme ideologische Grabenkämpfe und Unregierbarkeit – das alles ergab ein düsteres Bild. Plötzlich konnte man überall den Satz hören, der Sieg von 1918 habe nichts genutzt.
Bei den Wahlen im Mai 1936 triumphierte der Front populaire, bestehend aus den beiden Arbeiterparteien SFIO
und PCF. Der Sozialist Léon Blum übernahm die Regierung. Das Kapital floh aus Angst vor den Kommunisten, eine Welle des Antisemitismus schwappte über Frankreich. Und wieder beherrschten Bilder des Niedergangs die Polemik der Rechten.
„Das war die Zeit, in der die Franzosen sich selbst nicht mochten“, schrieb Georges Pompidou über diese Periode der Unsicherheit, die im Mai 1940, beim Überfall der Deutschen, ihren Höhepunkt fand und erst im Sommer 1944 mit der Befreiung von Paris endete. Und François Mitterrand erklärte 1978 in seinem Buch L’abeille et l’architecte: „Mein Gefühl, zu einem großen Volk zu gehören, hat einige Wunden davongetragen. Ich habe 1940 erlebt – unnötig mehr zu sagen.“ In Klammern fügte Mitterrand hinzu, was er unter einem „großen Volk“ versteht: „groß von der Idee her, die es sich von der Welt und von sich selbst und wiederum von sich in der Welt macht, und zwar nach einer Werteordnung, die weder auf der Zahl noch auf der Stärke, noch auf dem Geld beruht.“
„Die Niederlage von 1940 hat die Erschöpfung der Nation offenbart“, urteilte der Historiker Michel Winock. Nichts brachte den Niedergang besser zum Ausdruck als die Tatsache, dass der Sieger von Verdun, Marschall Pétain, den Waffenstillstand unterschrieb und seine Regierung unter die Kuratel der Nazis stellte. Nur eine Handvoll Franzosen, darunter der Panzergeneral Charles de Gaulle, weigerte sich, die Niederlage zu akzeptieren. Von London aus organisierten sie den Widerstand und ermöglichten so dem nationalen Bewusstsein 1944 eine Wiedergeburt – zu Lasten der Vichy-Franzosen um Pétain, die als Kollaborateure erst in den Gefängnissen und später in den Geschichtsbüchern landeten. Vom „Vichy-Syndrom“, wie es der Historiker Henry Rousso nennt, hat sich das Bekenntnis zu einer starken nationalen Identität bis heute nicht erholt. Der Verlust der Kolonien wurde von vielen als ein weiterer Beleg für den Niedergang der einst großen Nation gesehen.
In den sechziger Jahren verhalf General de Gaulle, Staatspräsident von 1959 bis 1969, Frankreich zunächst zu neuem Glanz. Er baute die französische Atommacht auf, ging politisch auf Distanz zu den USA, sagte nein zur Aufnahme der Briten in die Europäische Gemeinschaft und suchte nach einem dritten Weg zwischen den Blöcken. Politisch ragte Frankreich in Europa damals deutlich heraus.
Anfang der siebziger Jahre zerbrach die schöne Illusion, Frankreich sei unter der deutschen Besatzung eine Nation von Widerstandskämpfern gewesen. Eingeleitet wurde der Paradigmenwechsel durch Marcel Ophüls Filmklassiker Das Haus nebenan, der 1971 in die französischen Kinos kam, und das zwei Jahre später auf Französisch erschienene Standardwerk des amerikanischen Historikers Robert
Paxton Vichy France: Old Guard and New Order. Die Aus-
einandersetzung mit dem Thema Kollaboration weckte erste Zweifel an der traditionellen Überhöhung der französischen Résistance – Rousso prägte dafür den schönen Begriff résistancialisme – und führte am Ende auch zu der Frage nach einer französischen Mitschuld an der Verfolgung und Deportation von Juden. Bei keinem anderen Thema standen sich die politischen Lager so lange so unversöhnlich gegenüber wie beim Umgang mit Vichy, und das gilt in gewisser Weise bis heute.
Für Henry Rousso lassen sich aus dieser Auseinandersetzung drei konstitutive Elemente politischen Denkens in Frankreich ableiten:
- Der Katholizismus hat weder die Gesellschaft akzeptiert, die aus der Französischen Revolution hervorgegangen ist, noch den Staat, der auf den Gedanken der Aufklärung ruht.
- Die Ideologie der Konservativen ist am rechten Rand durchlässig und kennt keine klare Abgrenzung zur extremen Rechten.
- Der speziell französische Antisemitismus der Rechten, der sich während der Dreyfus-Affäre erstmals gezeigt hat, ist inzwischen wieder so stark, dass Tausende französische Juden das Land Richtung Israel verlassen.
In den achtziger Jahren wurden neue Unsicherheiten geweckt, die die Angst der Franzosen vor einem Bedeutungsverlust ihres Landes weiter schürten, Unsicherheiten, die mit dem Zusammenwachsen Europas zusammenhängen. An die damit verbundenen Sorgen vieler Bürger hat der rechtsradikale Front National bei den Präsidentschaftswahlen 2017 appelliert, indem er versprach, aus dem Euro auszutreten. Marine Le Pen weiß, dass sie damit bis weit ins Lager der Linken Zustimmung findet.
Die Europäische Union wird von der französischen Gesellschaft bis heute nicht akzeptiert, jedenfalls nicht so, wie sie sich bisher repräsentiert. 2005 stimmte deshalb ein großer Teil der bis dahin proeuropäischen Linken in einem
Referendum gegen den Lissabon-Vertrag und trug damit zu dessen Scheitern bei. Als die konservative Regierung unter Staatspräsident Nicolas Sarkozy drei Jahre später im Parlament den Antrag auf eine Verfassungsänderung einbrachte, um den Lissabon-Vertrag doch noch ratifizieren zu können, stimmten die Sozialisten dagegen. Die proeuropäische Stimmung der letzten Jahrzehnte ist geschwunden, weil die Franzosen nicht erkennen können, dass von Brüssel die erwartete Erneuerung ausgeht. Auch der Einfluss von Paris ist nicht gewachsen, im Gegenteil, in den Augen der meisten Franzosen hat die Osterweiterung der EU die Bedeutung Frankreichs verwässert.
Das sind die wichtigsten Komponenten, aus denen sich die Angst der Franzosen vor einem Verlust ihrer Identität zusammensetzt. Jedes Mal, wenn sie in den letzten hundertfünfzig Jahren den Niedergang ihres Landes vor Augen sahen, hatten sie Angst, ihre Seele zu verlieren. In der gegenwärtigen Krise scheint vor allem die Angst vor einer Islamisierung des Landes die Franzosen stärker denn je an ihrer Identität zweifeln zu lassen.
„Die Identität Frankreichs, die glückliche Identität Frankreichs, dorthin will ich das Land führen“, verkündete im Herbst 2016 Alain Juppé, einst Premierminister unter Präsident Jacques Chirac, Außenminister unter Präsident Nicolas Sarkozy, seit Jahren Bürgermeister von Bordeaux. Mit diesem Wahlversprechen hoffte er, Präsidentschaftskandidat der Konservativen im Jahr 2017 zu werden. Was unter „glück-
licher Identität“ zu verstehen sei, konnte er den Franzosen aber nicht überzeugend genug vermitteln, um gekürt zu werden. Er scheiterte bereits in der Mitgliederbefragung der Republikaner.
Sein härtester Konkurrent zu diesem Zeitpunkt war der ehemalige Präsident Nicolas Sarkozy, der ebenfalls meinte, das Thema der nationalen Identität werde den Wahlkampf 2017 bestimmen. Er hatte deshalb einen Satz aufgegriffen, der jahrzehntelang in allen französischen Schulbüchern stand,
selbst denen, die in den afrikanischen Kolonien und auf den Antillen ausgegeben wurden: „Nos ancêtres les Gaulois –
unsere Vorfahren, die Gallier“. Angesichts der Debatte um die Integration von Immigranten in Frankreich wandelte Sarkozy den Satz um, sodass er jetzt besagte, sobald jemand Franzose werde, seien die Gallier seine Vorfahren. Auch
Sarkozy scheiterte bei der Mitgliederbefragung der Republikaner mit seinem Versuch, die nationale Identität zum Wahlkampfthema zu machen.
Die Bedeutung des Satzes nos ancêtres les Gaulois hatten bereits mehrere Präsidenten infrage gestellt. Bei einem Kolloquium über „Frankreich und die Pluralität der Kulturen“ an der Sorbonne hatte Präsident François Mitterrand 1987 die Franzosen so charakterisiert: „Gallier, ein bisschen Römer, ein bisschen Germanen, ein wenig Juden, ein wenig Spanier, vielleicht immer mehr Portugiesen, wer weiß? Polen?“ Dann fügte er hinzu: „Ich frage mich, ob wir nicht schon ein wenig Araber geworden sind!“ Und meinte schelmisch: „Ich weiß, das ist ein unvorsichtiger Satz. Der wird aufgespießt werden.“
Nach dem Ursprung Frankreichs befragt, sagte Staatspräsident Jacques Chirac zwölf Jahre später in dem traditionellen Fernsehinterview am Nationalfeiertag, dem 14. Juli 1999: „Historisch hat Frankreich vielfältige Ursprünge. Wir berufen uns ständig auf unsere jüdisch-christlichen, lateinischen Wurzeln, auf die Tatsache, dass wir von den Galliern abstammen, was alles nicht richtig ist. Wir haben ein Land, dessen Name Frankreich von anderen Stämmen herrührt, von den Franken.“
Bis ins 18. Jahrhundert war an französischen Schulen gelehrt worden, dass die Franzosen einer Rasse angehörten, die von den Franken abstamme, welche wiederum aus
Troja gekommen seien, weshalb die Kinder einen vermeintlichen Stammbaum bis hin zu Priamos auswendig lernen mussten.
Die politische Auseinandersetzung über das, was den Inhalt der nationalen Identität ausmacht, lässt Zerrbilder entstehen, die mit der Wirklichkeit bisweilen nur noch wenig zu tun haben. Dies gilt unabhängig von der politischen Überzeugung. „Ich glaube, das Thema der französischen Identität zwingt sich allen auf, seien sie links, rechts oder im Zentrum, extrem links oder extrem rechts“, meinte Fernand Braudel, der sich als Autor eines mehrbändigen Werkes mit dem Titel L’identité de la France wie kein anderer Historiker mit der Materie befasst hat. Nationale Identität beinhaltet für Braudel Offenheit und Integrationsbereitschaft, eine Großzügigkeit, die andere nicht von vornherein ausschließt. Er warnte davor, die Frage politisch aufzuladen und sie allen möglichen Fantasmen auszusetzen. Aber offensichtlich fällt es vielen Wissenschaftlern und Politikern schwer, Braudels Warnung zu beherzigen.
„Benutzen Sie den Begriff Identität nicht, wenn es sich um Kultur handelt, um Sprache oder Geschlecht“, empfahl der Philosoph Michel Serres vor zwanzig Jahren, „denn da bedeutet er Zugehörigkeit. Dieser Fehler wird schnell zum Verbrechen.“ Das Wort Identität sei ausschließlich im Zusammenhang mit der Einzigartigkeit des Individuums angebracht, niemals im Sinne einer kollektiven Zuordnung. Alle Menschen sind gleich, aber kein Mensch ist mit einem anderen identisch. Das heißt: Jedes Individuum verfügt über eine in sich einzigartige Persönlichkeit, aber alle sind gleich vor dem Gesetz, unabhängig von ihrer Stellung in Staat und Gesellschaft, von Geschlecht und Religion. Weil Identität darin bestehe, dass jeder Mensch nur er selbst und niemand anderes ist, so Michel Serres, verbiete es sich, von kollektiven Identitäten zu sprechen.
Der Philosoph wandte sich mit seiner Klarstellung gegen die rechtsextreme Argumentation des Front National, dessen damaliger Führer Jean-Marie Le Pen den Begriff identité française für seine rassistischen Parolen gegen die maghrebinische Bevölkerung in Frankreich benutzte. Le Pens Argumentation reduziere die Identität einer Person darauf, ob sie französisch sei oder nicht. Von da sei es nicht weit bis zu der Forderung: Frankreich den Franzosen, Araber raus!
Serres erhielt postwendend Zustimmung aus Deutschland. „›Kollektive Identitäten enden notorisch in der Uniformierung oder mit dem Ausschluss von Individuen‹“, schrieb die Süddeutsche Zeitung. „Wer diesen begrifflichen Kadaver noch einmal aus der Gruft zerrt, beweist also nur eines: Mut zur Peinlichkeit.“ Das war ziemlich flapsig. Muss man sich aber nicht ernsthaft fragen – und heute, zwanzig Jahre später, stellt sich diese Frage erst recht – , ob es wirklich reicht, so zu argumentieren wie Michel Serres? Führt hier nicht der berechtigte Wunsch, Diskriminierungen zu verhindern, seinerseits zu einem Tabu, das verbietet, von gesellschaftlichen Gruppen als kollektiven Identitäten zu sprechen? Dieses Tabu hat in Deutschland dazu geführt, dass Braudels Buch L’identité française in der deutschen Ausgabe verharmlosend den Titel Frankreich erhielt. Mit dem Begriff „Identität“ im Titel wäre das Buch wahrscheinlich heftig kritisiert worden – und hätte sich obendrein schlecht verkauft.
Denn auch die Deutschen haben Probleme mit dem Begriff der kollektiven Identität. Vor allem, wenn es um die zwölf Jahre der Herrschaft des Nationalsozialismus geht und sie als Kollektiv in die Verantwortung genommen werden sollen. Während sich heute viele mit der Vorstellung identifizieren zu können glauben, der Tod sei „ein Meister aus Deutschland“, wehrten sich die meisten Angehörigen der vom Krieg noch betroffenen Generationen empört gegen die These des amerikanischen Historikers Daniel Goldhagen, der „eliminatorische Judenhass“ sei ein Merkmal der kollektiven Identität der Deutschen.
Der Begriff Identität wird in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen unterschiedlich benutzt. Anders als in der Philosophie ist er etwa in der Soziologie zur Charakterisierung von Gemeinschaften längst gang und gäbe. Die Psychologie wiederum geht davon aus, dass sich die Identität einer Person wesentlich aus ihrer Wahrnehmung der Welt entwickelt. Da aber jeder seine eigene Innenwelt hat, hat er auch eine ihm eigene Art, die Welt zu sehen und sich darin zu platzieren. In diesem ständigen Austausch zwischen Innen- und Außenwelt entwickelt und verändert sich seine Identität. Es gibt keine festgeschriebene, unveränderliche Identität. Da Identitäten Entwicklungs- und Lernprozessen unterliegen, wandeln sie sich mit der Zeit – und manchmal können sich ihre Inhalte auch verbrauchen.
Norbert Elias unterscheidet zwischen der Ich-Identität (Individuum) und der Wir-Identität (Gesellschaft). Das eine gibt es nicht ohne das andere: „Es gibt keine Ich-Identität ohne Wir-Identität.“ So wie die Familie mit ihrer eigenen Geschichte verhaftet ist, so weist auch die Gesellschaft eine Reihe gemeinschaftsbildender Merkmale auf, deren wichtigstes die Sprache ist. Zugleich werden in jeder Familie aber auch eigene sprachliche Codes benutzt. Indem der Einzelne für sich einen Ausgleich herstellt zwischen den Ich-Erfahrungen und den Wir-Erfahrungen – Elias spricht von der Wir-Ich-Balance – , gewinnt er seine Identität.
Man braucht nicht Marxist zu sein, um festzustellen, dass das Kollektiv eine erhebliche Rolle bei der Bildung der individuellen Identität spielt. Und es schafft zugleich die Grundlage für eine kollektive Identität, denn nur an den gemeinschaftlichen Werten lässt sich die soziale Bedeutung des Individuums entwickeln. Jürgen Habermas hat es so formuliert: »Erst das Bewusstsein der Zugehörigkeit zu ›demselben‹ Volk macht die Untertanen zu Bürgern eines einzigen politischen Gemeinwesens – zu Mitgliedern, die sich füreinander verantwortlich fühlen können. Die Nation oder der Volksgeist – die erste moderne Form kollektiver Identität überhaupt – versorgt die rechtlich konstituierte Staatsform mit einem kulturellen Substrat.«







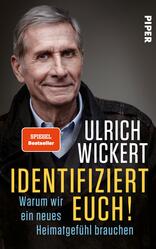






DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.