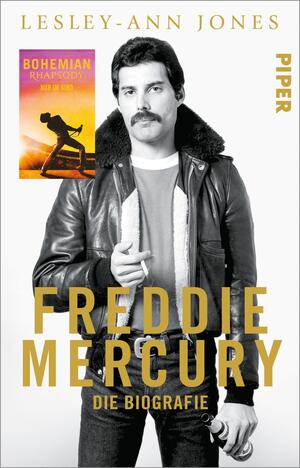
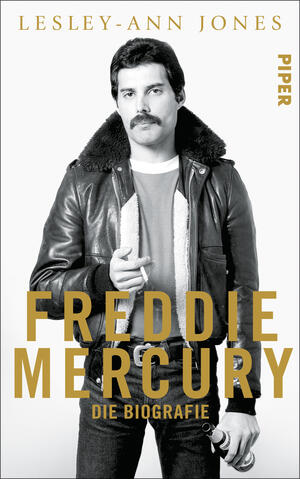
Freddie Mercury Freddie Mercury - eBook-Ausgabe
Die Biografie
— Musikgeschichte für Queen-Fans„26 Jahre nach seinem Tod dürften zwar ziemlich alle Mercury-Geheimnisse gelüftet worden sein, in dem beim Piper-Verlag erschienenen Buch ›Freddie Mercury: Die Biografie‹ der Engländerin Lesley-Ann Jones kann man sie nachlesen.“ - Süddeutsche Zeitung
Freddie Mercury — Inhalt
„Genau die Würdigung, die Mercury sich gewünscht hätte“ The Spectator
„We Are the Champions“, „I Want to Break Free“, „Bohemian Rhapsody“, „We Will Rock You“ oder „Another One Bites the Dust“ - die großen Hits der Band Queen kennt jeder. Doch wie wurde aus dem 1946 in Sansibar geborenen Beamtensohn Farrokh Bulsara der schillernde Weltstar Freddie Mercury? Sein Privatleben hielt er stets weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Lesley-Ann Jones war als junge Rockjournalistin einige Jahre mit Queen auf Tour und ist seitdem eng mit der Band befreundet. Für dieses Buch bereiste sie alle wichtigen Stationen in Mercurys Leben und sprach mit seinen Weggefährten. Zahlreiche Fotos runden den Text ab. So entsteht ein sehr persönliches und intimes Porträt eines der größten Rockstars aller Zeiten.
Queen verkauften insgesamt über 320 Millionen Tonträger, ihre Greatest Hits sind mit weltweit über 32 Millionen verkauften Exemplaren eines der erfolgreichsten Alben aller Zeiten. Freddie Mercury wird von seinen Fans auch 25 Jahre nach seinem Tod noch genauso geliebt und gefeiert wie zu Hochzeiten seiner Band.
Lesley-Ann Jones war lange mit Queen auf Tour und sprach mit über 100 Weggefährten
Leseprobe zu „Freddie Mercury“
Einleitung
Montreux
Wir haben damals nicht immer gleich alles aufgeschrieben. Wie man es als Journalist zu jener Zeit eben tat, haben wir uns das Wichtigste zu merken versucht, uns dann entschuldigt und sind auf die Toilette verschwunden, wo wir alles in unser Notizbuch kritzelten, bevor der Alkohol seine Wirkung zeigte. Klar hatten wir auch Aufnahmegeräte, aber die konnten wir nicht benutzen. Das wäre tödlich für die Konversation gewesen, besonders wenn man sich an einem, sagen wir mal, kompromittierenden Ort befand. Wo es nicht cool war zuzugeben, dass [...]
Einleitung
Montreux
Wir haben damals nicht immer gleich alles aufgeschrieben. Wie man es als Journalist zu jener Zeit eben tat, haben wir uns das Wichtigste zu merken versucht, uns dann entschuldigt und sind auf die Toilette verschwunden, wo wir alles in unser Notizbuch kritzelten, bevor der Alkohol seine Wirkung zeigte. Klar hatten wir auch Aufnahmegeräte, aber die konnten wir nicht benutzen. Das wäre tödlich für die Konversation gewesen, besonders wenn man sich an einem, sagen wir mal, kompromittierenden Ort befand. Wo es nicht cool war zuzugeben, dass man von der Zeitung war.
Wir – ein paar Schreiber und ein Fotograf – hatten uns von dem Medienzirkus abgesetzt, der ein Stück weit die Straße hinauf im Konferenzzentrum tobte, und hatten uns auf ein Bier in den einzigen englischen Pub auf der Flaniermeile von Montreux zurückgezogen. Es war ein gemütlicher kleiner Laden, das White Horse oder Blanc Gigi, wie wir es nannten. Freddie war auch dort in jener Nacht, mit ein paar Freunden in hautengen Hosen, es könnten Schweizer oder Franzosen gewesen sein. Dieser typisch englische Pub war einer seiner liebsten Zufluchtsorte, ich denke, wir wussten das damals. Freddie brauchte keinen Leibwächter, er brauchte Zigaretten. Der neue Typ vom Express war Kettenraucher, er hatte immer vier Päckchen dabei. Die Nächte waren lang für junge Showbiz-Reporter. Wir waren gut vorbereitet.
Freddie traf ich nicht zum ersten Mal. Wir waren uns schon vorher mehrmals begegnet. Ich war Rock-Fan seit meiner Kindheit – Bowie lernte ich mit elf kennen, und Hendrix starb 1970 an meinem Geburtstag (das musste doch ein „Zeichen“ sein, was sonst?). Die aufregend vielschichtige Musik von Queen brachten mir die Schwestern Jan und Maureen Day aus Aldershot näher, in dem Sommer, als ich von der Schule abging. Wir saßen in einem klapprigen Bus auf dem Weg nach Barcelona und zu den Stränden der Costa Brava. Jeder hatte damals eine Gitarre bei sich und ein Plektrum, das einmal George Harrison gehört hatte. Aber ich konnte meine Finger noch so sehr verbiegen, es wollte mir nicht gelingen, das Instrument zum Weinen zu bringen.
Ich hatte nicht das Zeug dazu, eine Chrissie Hynde oder eine Joan Jett zu werden, stattdessen arbeitete ich von den frühen Achtzigern bis 1992 als Rock- und Pop-Reporterin für die Daily Mail, die Mail on Sunday, deren Beilage, das You-Magazin, und die Sun. Ich war Frischling bei Associated Newspapers, als ich Queen zum ersten Mal begegnete. 1984 schickte man mich zum Interview mit Freddie und Brian ins Queen-Büro im Stadtteil Notting Hill, was den Beginn einer etwas einseitigen Freundschaft markierte: Sie riefen, und du standest auf der Matte. Die darauffolgenden Jahre kommen mir heutzutage irgendwie unwirklich vor. Im Musikgeschäft ging es damals noch wesentlich unkomplizierter zu. Künstler und Journalisten saßen häufig im selben Flugzeug, in denselben Luxuslimousinen, stiegen in denselben Hotels ab und ließen gemeinsam die Sau raus.
Nur sehr wenige dieser Freundschaften haben jene Zeit überlebt.
Heute geht es völlig anders zu. Es gibt zu viele Manager, Agenten, Promoter, Presseabteilungen, Plattenfirmentypen und Gefolgsleute, und alle kriegen sie ihre Prozente. Und wenn nicht, dann tun sie wenigstens so. Es liegt in ihrem Interesse, dafür zu sorgen, dass Leute wie ich hinter der Absperrung bleiben. Damals haben wir uns überall Zugang verschafft – mit oder ohne Access-all-Areas-Pass. Manchmal versteckten wir den Pass auch, weil es ohne mehr Spaß machte, sich irgendwo durchzuwursteln.
Im Jahr zuvor hatte ich Queen bei Live Aid im Wembley-Stadion vom Bühnenrand aus zusehen können – heute dürfte ich da nicht mehr hin – und wurde 1986 zu einigen Konzerten der „Magic“-Tour eingeladen. In Budapest nahm ich an einem Privatempfang zu Ehren der Band in der britischen Botschaft teil, und ich war Zeuge ihres historischen Auftritts hinter dem Eisernen Vorhang in Ungarn – für mich eines ihrer größten Konzerte. Ich habe damals ziemlich gut da reingepasst: eine schlanke, sommersprossige Mittzwanzigerin, die Rock ’n’ Roll liebte, eine unter vielen.
Was mich immer wieder überraschte, war, wie viel schmächtiger Freddie war, als er auf der Bühne wirkte. Vielleicht lag es an seinen Ernährungsgewohnheiten, bei denen Nikotin, Wodka, Wein und Kokain eine große Rolle spielten, vielleicht daran, dass er wenig aß und als Performer immer so aufgedreht sein musste. Dort oben schien er so überlebensgroß, dass man ihn sich auch im wirklichen Leben so vorstellte. Als er mir gegenüberstand, kam er mir ziemlich klein vor und liebenswert jungenhaft. Man wollte ihn bemuttern, das ging allen Frauen so. Er weckte die gleichen Instinkte wie der androgyne Boy George von Culture Club, der zum Liebling aller Hausfrauen wurde, nachdem er „gestanden“ hatte – ob man es ihm abnahm, war eine andere Sache –, dass er eine anständige Tasse Tee dem Sex vorziehe.
Im White Horse blickte Freddie um sich und brummelte mit hochgezogenen Augenbrauen und seiner so charakteristischen, leicht affektierten Stimme vor sich hin: „Kippe.“ In jener Nacht fiel es mir zum ersten Mal auf, wie viele Widersprüche er in sich vereinte. Dass er gleichzeitig so bescheiden und umgänglich sein konnte, wenn er den ganzen Rummel nicht um sich hatte, und so arrogant, sobald er auf der Bühne stand. Später bekam ich mit, wie er mit kindlichem Tonfall „Pipi“ murmelte, und sah fasziniert zu, als ihn einer seiner Begleiter in Richtung Herrentoilette schob. Das war’s, in dem Moment bin ich ihm komplett verfallen. Ich wollte ihn mit nach Hause nehmen, ihn in ein heißes Bad stecken, und meine Mutter sollte ihm einen deftigen Braten vorsetzen. Wenn ich heute darüber nachdenke, kann es wohl kaum so gewesen sein, dass der große Rockstar zu hilflos war, um allein auf die Toilette zu gehen. Freddie hätte dort ein viel zu leichtes Ziel abgegeben, deshalb brauchte er Begleitschutz.
Roger Tavener, der Typ vom Express, bot ihm eine Marlboro an. Freddie zögerte, bevor er sie annahm – er hätte Silk Cut bevorzugt. Er beobachtete uns milde interessiert von seinem Platz aus, als wir uns unter die Trinker am Tresen mischten. Vielleicht gerade weil wir ihn gar nicht so sehr beachteten, kam er zu uns und bat uns um noch eine Zigarette. Wo wir untergekommen wären, fragte er uns. Im Montreux Palace. Das war die richtige Antwort. Freddie hatte dort auch schon gewohnt, er hatte seine eigene Suite gehabt. Er und seine Kollegen von Queen waren Besitzer der Mountain Studios, der einzigen Aufnahmestudios in diesem respektablen Schweizer Ferienort. Die Mountain Studios galten zu jener Zeit als die besten in Europa.
Die nächste Runde ging auf ihn. Noch mal das Gleiche wie vorher.
Nach ungefähr einer Stunde sagte er: „Sicherlich wisst ihr, wer ich bin.“ In seinen dunklen Augen blitzte die Erkenntnis auf. Ja, das lag doch auf der Hand. Seinetwegen waren wir schließlich hier. Ein paar Wodka-Tonic früher wäre er vielleicht auch noch auf unsere Namen gekommen. Unsere Herausgeber hatten uns hierhergeschickt, um über das jährliche Fernsehfestival, die Goldene Rose von Montreux, zu berichten (1986 war die Rose d’Or gerade auf dem Höhepunkt ihrer Popularität). Bei der Gelegenheit nahmen wir noch eine weitere Veranstaltung mit, eine vielfach im Fernsehen ausgestrahlte Rockmusik-Gala, die sämtlichen Medienleuten einen willkommenen Anlass bot, über die Stränge zu schlagen.
Wir hatten gedacht, Freddie wolle seine Ruhe haben, aber ganz offenbar hatte er an diesem Abend das Bedürfnis, sich zu unterhalten. In der Regel hielt er nicht viel von Schreiberlingen. In der Vergangenheit hatten sich so viele über ihn lustig gemacht und ihn falsch zitiert, dass er nur wenigen vertraute. David Wigg, damals beim Daily Express der Redakteur für Showgeschäft-Angelegenheiten und ebenfalls in Montreux vor Ort, war ein guter Freund von Freddie. Meistens war er es, dem die Neuigkeiten zuerst gesteckt wurden.
Wir kamen ihm zu nahe. Wir wussten, dass wir damit unsere Chance auf ein offizielles Interview zunichte machten. Bald würde er uns auf die Schliche kommen. Und was noch schlimmer war: sein Management und die Presseabteilung auch. Wir hatten die Grenzen übertreten, die diese Leute gesetzt hatten, und würden wohl nie wieder die Gelegenheit bekommen, uns ihm zu nähern. Das hier war seine Bar, sein Jagdrevier. Trotzdem erschien er uns sehr verletzlich und unruhig, gar nicht so wie der Star, den wir zu kennen glaubten.
„Deshalb bin ich hier“, erzählte er. „Wir sind nur zwei Flugstunden von London entfernt, aber hier kann ich atmen, kann denken, schreiben und aufnehmen, kann Spaziergänge machen. Ich glaube, das werde ich in den nächsten Jahren auch brauchen.“
Wir litten mit ihm. Pflichteten ihm bei, wie anstrengend es sei, berühmt zu sein – sein Problem, nicht unseres. Wir machten keine große Nummer draus. Versuchten cool zu bleiben, versuchten unseren journalistischen Killerinstinkt zu unterdrücken – der doch von uns verlangte, dass wir auf der Stelle zum Telefon rannten und unserem Redakteur die heißeste Story des Jahres unter die Nase rieben, nämlich dass wir einen der am zurückgezogensten lebenden Künstler des Rockgeschäfts in der Fremde in einer Kneipe gestellt hatten. Wir tranken noch ein paar Kurze und warteten ab. Das hier war eine unbezahlbare Gelegenheit. Tavener und ich waren erst jetzt zu Komplizen geworden, wir wollten uns gegenseitig beeindrucken. Zwischen den Blättern, für die wir schrieben, herrschte bittere Rivalität. Eigentlich hätten wir uns wie zwei Haie umkreisen und abwarten müssen, wer zuerst einen Fehler macht. Wir versicherten Freddie, dass wir es gewohnt , mit Prominenten zu arbeiten. Dass wir ihre Privatsphäre respektierten, weil wir wussten, dass sie sie opferten, bevor ihnen bewusst wurde, wie sehr sie sie vermissen würden. Das kam gut an bei ihm.
Er schielte in seinen Wodka und schwenkte das Glas.
„Wisst ihr, das ist genau das, was mir schlaflose Nächte bereitet“, sinnierte er. „Ich habe ein Monster geschaffen. Und das Monster bin ich. Ich kann niemandem sonst die Schuld daran geben. Seit ich klein war, habe ich darauf hingearbeitet. Ich hätte dafür getötet. Alles, was mir zustößt, habe ich mir selbst zuzuschreiben. Ich habe es so gewollt. Wir alle wollen das: Erfolg, Ruhm, Geld, Sex, Drogen – was immer es ist, ich kann es kriegen. Aber so langsam wird mir klar, dass ich, ganz egal, wie hart ich dafür gearbeitet habe, dem Ganzen entfliehen will. Ich mache mir Gedanken, dass ich die Sache nicht mehr unter Kontrolle habe, weil sie mich längst kontrolliert.
Wenn ich auf die Bühne gehe, dann verändere ich mich“, gab er zu. „Ich verwandele mich voll und ganz in den ultimativen Showmann. Ich erzähle das, weil es so ist. Ich ertrage es nicht, der Zweitbeste zu sein, da würde ich lieber aufhören. Ich weiß, dass ich da vorne herumhampeln und den Mikroständer auf eine bestimmte Art halten muss. Und ich liebe es ja auch. Mich hat immer schwer beeindruckt, wie Hendrix alles aus seinem Publikum rausgeholt hat. Er hat kapiert, wie’s geht, und seine Fans auch. Aber außerhalb des Rampenlichts war er ein ziemlich schüchterner Typ. Vielleicht litt er darunter, dass er ständig versuchen musste, den Erwartungen gerecht zu werden. Dass er den wilden Mann markierte, der er abseits der Bühne gar nicht war. Für mich wird das zu einer außerkörperlichen Erfahrung, wenn ich da oben stehe. So als ob ich mich selbst betrachte und denke: Das ist ja ganz schön geil. Natürlich merke ich schnell, dass ich es bin, und dann geht’s wieder an die Arbeit.
Es ist eine Art Droge“, fuhr er fort, „ein Aufputschmittel.
Aber es wird schon hart, wenn dich die Leute auf der Straße entdecken. Die wollen nämlich den Typen auf der Bühne sehen, den großen Freddie. Aber so bin ich nicht, ich bin viel ruhiger. Du versuchst dein Privatleben von dem des Künstlers getrennt zu halten, weil es eine schizophrene Existenz ist. Ich schätze, das ist der Preis, den ich zahlen muss. Versteht mich bitte nicht falsch, ich bin kein bemitleidenswerter, armer reicher Typ. Die Musik bringt mich jeden Morgen wieder auf die Beine. Ich bin wirklich gesegnet.“
Was konnte er tun?
„Ich bausche das alles gerade zu einem furchtbaren Drama auf, oder nicht?“ Jetzt blitzte der große Freddie durch. „Das Geld fließt nur so in die Kassen, die Massen verehren mich, ich lebe in Montreux und in der nobelsten Gegend Londons. Ich kann mir Häuser in New York oder Paris kaufen, überall, wo ich will. Ich bin verwöhnt. Der Typ auf der Bühne kann das alles tun. Sein Publikum erwartet es sogar von ihm. Aber ich mache mir Sorgen, wo das alles enden soll“, gestand er schließlich. „Was es bedeuten kann, Teil einer der größten Bands der Welt zu sein. Es bringt ganz eigene Probleme mit sich. Es bedeutet, dass ich nicht einfach durch die Gegend spazieren und mir am Nachmittag in einem entzückenden kleinen Teeladen in Kent ein Gebäckstückchen genehmigen kann. Und das muss ich mir immer vor Augen führen. Ich habe einen unglaublichen Weg hinter mir, und es macht mir immer noch jede Menge Spaß, das versichere ich euch. Aber es gibt Zeiten …“
Durch das Casino hindurch und auf der anderen Seite raus, drifteten wir irgendwo zwischen Nacht und Dämmerung. Freddie und ein paar seiner Freunde lebten in einer Villa unterhalb der zerklüfteten Alpen, von denen Freddie behauptete, sie hüteten uralte Geheimnisse und verborgene Schätze, die die Nazis im Krieg dort versteckt hätten. In der kühlen Nachtluft lag der Duft von Pinien. Die mondbeleuchteten Berge warfen ihre Schatten auf den ruhenden See.
Es war nicht zu übersehen, wie sehr Freddie seinen Zufluchtsort liebte. Ein Idyll an der Waadtländer Riviera, berühmt geworden durch das jährliche Jazzfestival, seine Weingüter, durch Nabokov und Chaplin, durch „Smoke on the Water“, den Song mit dem unvergleichlichen Riff, den Deep Purple im Dezember 1971 schrieben, als ein Fan bei einem Konzert von Frank Zappa mit einer Signalpistole in die Decke schoss und einen Brand auslöste. Das ganze Casino brannte damals bis auf die Grundmauern nieder, Rauchwolken zogen über den Genfer See, und Roger Glover stand mit dem Bass in der Hand an seinem Hotelfenster und sah zu.
„Werft einfach meine Überreste in den See, wenn es mal so weit ist“, scherzte Freddie. Mindestens zweimal hat er das wiederholt.
Im Gespräch kamen wir darauf, wie wichtig es sei, die einfachen Dinge im Leben genießen zu können. Das Thema stand riesengroß im Raum und zugleich zwischen uns – mit seinem Vermögen als Rockstar war Freddie in der Lage, sich die Erfüllung sämtlicher Wunschträume zu erkaufen, von denen unsereins nur träumen konnte.
Und was haben wir mit dieser „Exklusivmeldung“ angefangen? Nichts. Nichts haben wir geschrieben. Alles blieb unter uns.
Freddie und sein Gefolge waren gute Leute. Wir hatten viel Spaß in dieser Nacht. Er war ehrlich zu uns gewesen. Wahrscheinlich traute er uns kein Stück weit über den Weg. Er wusste, wer wir waren, und musste einfach davon ausgehen, dass wir ihn reinlegen würden. Vielleicht wollte er das sogar, nur um bestätigt zu sehen, was er schon immer gewusst hatte: Mit Journalisten hatte man nichts als Ärger. Gerade Freddie gehörte zu den Rockstars, die es gewohnt waren, dass man sie hinterging, Leute wie wir hatten das oft genug getan. Auch wenn wir es damals nicht verstanden, im Rückblick kann ich sein Verhalten durchaus nachvollziehen: Freddie mag gespürt haben, dass seine Tage gezählt waren. Mit Sicherheit lebte er so, als ob es kein Morgen gebe. Vielleicht war ihm auch einfach danach, auf sämtliche Vorsichtsmaßnahmen zu pfeifen, mit denen er sich als Gefangener seines Erfolgs schützte. Weil wir wussten, dass Freddie das Allerschlimmste von uns erwartete, einigten Tavener und ich uns darauf, etwas zu tun, wofür wir hätten gefeuert werden können: Wir würden Freddies Vertrauen nicht missbrauchen, um daraus billige Schlagzeilen zu stricken.
Die Morgendämmerung begann über den schneebedeckten Gipfeln zu schimmern. Farben spiegelten sich im See, als wir uns auf den Weg zurück zu unserem Hotel machten. Keiner von uns beiden sagte etwas. Es gab nichts mehr zu sagen. Tavener rauchte seine letzte Zigarette.
„Rockmusik ist enorm wichtig“, erklärte Cosmo Hallström, ein renommierter Psychotherapeut, der seit vier Jahrzehnten im Dienste der Großen und Berühmten arbeitet.
„Sie repräsentiert die Kultur, wie sie sich heutzutage darstellt. Es geht um das große Geld, deshalb will jeder daran teilhaben. Ein Phänomen, das man nicht ignorieren kann. Sie vereint Menschen und schafft ein Zusammengehörigkeitsgefühl.
Rock ’n’ Roll hat diese Unmittelbarkeit. Es geht um rohe, ungezügelte, frühkindliche Gefühle und einfache Wertvorstellungen, die mit Nachdruck dargebracht werden. Dem kann man sich schwer entziehen. Man müsste schon taub sein – und manchmal gelingt es nicht mal dann. Rock ’n’ Roll spricht ganze Generationen an, gibt ihnen eine Bestätigung, die sie sonst nicht finden.“
„Künstler zu werden, ist ein Hilfeschrei“, behauptete dagegen Simon Napier-Bell, einer der berühmt-berüchtigtsten Manager der Popindustrie, und der muss es wissen. Er schrieb Hits für Dusty Springfield, machte Marc Bolan, die Yardbirds und Japan überall bekannt, erfand Wham! und verwandelte George Michael in einen Solo-Superstar. Simon nahm kein Blatt vor den Mund – schon gar nicht bei diesem Thema.
„Alle Künstler sind unglaublich unsichere Menschen. Sie sehnen sich verzweifelt nach Aufmerksamkeit. Ständig sind sie auf der Suche nach Publikum. Sie sind gezwungen, kommerziell zu werden, was sie hassen, aber für mich macht das ihre ›Kunst‹ nur besser. Und alle haben sie die gleiche Geschichte, und darin liegt der Schlüssel. Nehmen wir zum Beispiel Eric Clapton: Als ich ihn zum ersten Mal sah, dachte ich, das ist kein Künstler, das ist einfach nur ein Musiker. In John Mayalls Band spielte er mit dem Rücken zum Publikum, weil er so schüchtern war. Aber als er sich weiterentwickelte, wurde mir klar, dass er doch ein Künstler ist. Er hatte keinen Vater, eine Schwester, die eigentlich als Mutter fungierte, und eine Großmutter, die er für seine Mutter hielt. Künstler haben immer eine schwere Kindheit hinter sich – zumindest, was Gefühlsentzug betrifft. Deshalb legen sie es verzweifelt darauf an, Erfolg zu haben, von allen geliebt zu werden und im Fokus der Aufmerksamkeit zu stehen. Alle anderen ziehen sich früher oder später aus dem Geschäft zurück. Weil es stimmt, was ich sage: Es ist absolut furchtbar, ein Star zu sein. Klar ist es nett, dass man in einem Restaurant einen guten Tisch bekommt, aber beim Essen steht alle dreißig Sekunden jemand an deinem Tisch. Es ist ein Albtraum. Trotzdem nehmen die Stars so etwas nur zu gerne auf sich. Das gehört einfach dazu.
In der Regel sind sie sehr nett und charmant zu Leuten, die sie neu kennengelernt haben“, fuhr er fort. „Aber es gibt da eine dunkle Seite. Wenn sie von dir alles genommen haben, was sie nur kriegen konnten, dann brauchen sie dich nicht mehr und spucken dich aus. Ich bin ausgespuckt worden, aber das ist mir völlig schnuppe. Ich verstehe diese Menschen, ich weiß, wie sie ticken. Es hat keinen Sinn, sich darüber aufzuregen, dass irgendein Star undankbar oder bösartig zu dir ist. Sie sind, wie sie sind. Jeder Einzelne von denen hat mit psychischen Defiziten zu kämpfen. Wenn Sie in deren Kindheit stöbern, werden Sie darauf stoßen, das garantiere ich Ihnen. Wo soll es denn sonst herkommen, dass sie dermaßen um Beifall und Anerkennung buhlen? So verzweifelt, dass sie ein jämmerliches Leben führen, über das sie nie selbst bestimmen können? Kein normaler Mensch würde jemals Star sein wollen. Nicht für alles Geld der Welt.“
„Freddie Mercury hat alles richtig gemacht“, entgegnete Dr. Hallström. „Er starb jung. Statt zu einer fetten, aufgedunsenen alten Queen zu werden, trat er in der Blüte seines Lebens ab und bleibt uns deshalb auf alle Ewigkeit so in Erinnerung. Nicht der schlechteste Abgang.“
Das ist seine Geschichte.
01 Live Aid
Durch dieses Konzert leisten wir etwas Positives und bringen die Leute dazu, hinzusehen, hinzuhören und hoffentlich auch zu spenden. Wenn Menschen verhungern, sollte das als Problem angesehen werden, das uns alle angeht. Manchmal fühle ich mich so hilflos, aber nun kann ich meinen Teil dazu beitragen. Freddie Mercury
Es war die perfekte Bühne für Freddie Mercury: Die ganze Welt schaute ihm zu. Bob Geldof
Es gab einmal eine Zeit, da waren die Politiker große Redner. Im Laufe des vergangenen Jahrhunderts ist ihnen diese Fähigkeit jedoch abhanden gekommen. Ausgerechnet der Rock ’n’ Roll ist eine der wenigen verbliebenen Sparten, in der ein Einzelner oder eine Gruppe das Publikum in der Hand haben und in der sie Tausende mit ihrer Stimme bewegen können. Filmschauspieler können das nicht. Fernsehstars schon gar nicht. Vielleicht macht das den Rock-Superstar zu einer der letzten großen faszinierenden Erscheinungen unserer Zeit. Diese Gedanken gingen mir durch den Sinn, als ich bei Live Aid zusammen mit dem Who-Bassisten John Entwistle und seiner Freundin Max hinter den Vorhängen am Bühnenrand des Wembley-Stadions stand. Wir beobachteten Freddie, der in einer Bullenhitze vor annähernd 80000 Menschen auftrat. Zu Hause vor den Fernsehschirmen saßen noch einmal … wie viele wohl? Eine Menge Zahlen kursierten in den darauffolgenden Jahren, irgendwo zwischen „400 Millionen in etwa 50 Ländern via Satellitenübertragung“ und „1,9 Milliarden weltweit“ dürfte die Wahrheit liegen. Lässig, geistreich, gewagt und sexy gab Freddie alles. Wir konnten nur entgeistert zusehen. Der ohrenbetäubende Jubel der Zuschauer machte es ihm unmöglich, zu ihnen zu sprechen. Freddie wird das egal gewesen sein. Die animalische Kraft, mit der er sein Publikum in den Bann zog, lag fast greifbar in der Luft. Backstage mussten einige der größten Rocklegenden mitansehen, wie ein Rivale ihnen die Show stahl: Okay, Freddie hatte es wirklich drauf. In diesen 18 Minuten herrschte er als King mit Queen über die ganze Welt.
Das Glück erreicht uns oft auf verschlungenen Pfaden. Bob Geldof, der in einem Taxi in sein Tagebuch kritzelte, das war so ein Glücksfall. Es war im November 1984. So viele Dinge gingen ihm durch den Kopf – als „Schlachtfeld unvereinbarer Gedanken“ beschrieb er es später einmal –, als ihm die Textzeilen einfielen, die schon bald darauf die ganze Welt bewegen sollten. Kurz zuvor hatte er Michael Buerks eindringlichen Bericht über die furchtbare Hungersnot in Äthiopien in den BBC-Nachrichten gesehen. Die Bilder, die eine Katastrophe biblischen Ausmaßes schilderten, ließen Geldof entsetzt und hilflos zurück. Er hatte das Gefühl, dass er etwas tun musste, wusste aber nicht, was. Vielleicht ja das tun, was er am besten konnte: sich auf den Hosenboden setzen und eine Hitsingle schreiben. Den Erlös könnte er dann an Oxfam spenden. Aber die Boomtown Rats, seine irische Band, hatten ihre beste Zeit hinter sich, seit 1980 hatten sie keinen Top-Ten-Hit mehr landen können. Ihren Höhepunkt hatten sie mit der Nummer eins „I Don’t Like Mondays“ 1979 gehabt. Er wusste, dass Musikfans eine Benefizsingle kaufen würden, wenn der Künstler bekannt genug wäre – gerade in der Zeit vor Weihnachten. Es ging also darum, einen Star zu finden, der seine Ansichten teilte und die Platte aufnahm. Noch besser wäre es, wenn er gleich eine ganze Reihe von Stars für den Song gewinnen könnte.
Bob sprach mit Midge Ure, dessen Band Ultravox bei The Tube auftrat, einer Fernsehmusiksendung, die Geldofs damalige Freundin und spätere Ehefrau, die im Jahr 2000 verstorbene Paula Yates, moderierte. Midge erklärte sich bereit, für Geldofs Text die Musik zu schreiben und zu arrangieren. Bob wandte sich dann an Sting, an Duran-Duran-Sänger Simon Le Bon sowie an Gary und Martin Kemp von Spandau Ballet. Mit der Zeit wurde die Liste der Beteiligten immer länger, unter anderem fanden sich dort Boy George, Frankie Goes To Hollywood, Paul Weller von Style Council, George Michael und Andrew Ridgeley von Wham! sowie Paul Young. Francis Rossi und Rick Parfitt von Status Quo erklärten sich nur zu gerne bereit, Phil Collins und Bananarama folgten. David Bowie und Paul McCartney, die andere Verpflichtungen hatten, schickten Geldof ihre Beiträge zu, damit sie später in die Aufnahme reingeschnitten werden konnten. Sir Peter Blake, weltberühmt geworden durch seine wegweisende Covergestaltung für die Beatles-Platte Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band, wurde beauftragt, die Plattenhülle zu entwerfen. Band Aid, ein Wortspiel mit dem Markennamen eines Heftpflasters, war geboren – die Band, die helfen sollte, dass die Welt wieder heilt.
„Do They Know It’s Christmas“ wurde am 25. November 1984 bei Trevor Horn aufgenommen, der die Sarm West Studios in Notting Hill gratis zur Verfügung stellte, und schon vier Tage später veröffentlicht.
In jener Woche hatte der umwerfende schottische Sänger Jim Diamond mit seiner erhabenen, zeitlosen Ballade „I Should Have Known Better“ Platz eins der Charts erobert. Obwohl Diamond bereits 1982 mit der Band PhD und „I Won’t Let You Down“ einen Hit landen konnte, war ihm zuvor nie ein Soloerfolg gelungen. Der gesamten Musikindustrie verschlug es fast die Sprache, als sich der großherzige Jim in einem Interview folgendermaßen äußerte: „Ich bin überglücklich, Nummer eins zu sein, aber ich möchte, dass die Leute nächste Woche nicht meine Platte kaufen, sondern die von Band Aid.“
„Ich konnte es nicht glauben“, sagte Geldof. „Als Sänger, der fünf Jahre lang keinen Hit gehabt hat, weiß ich ganz genau, wie schwer der Schritt für ihn gewesen sein muss, so etwas zu verkünden. Er hatte gerade seine Nummer eins zugunsten anderer Leute aufgegeben. Das war in höchstem Maße selbstlos.“
In der folgenden Woche stieg „Do They Know It’s Christmas“ im Vereinigten Königreich direkt auf Nummer eins ein, verkaufte mehr Platten als die restlichen Charts zusammengenommen und wurde zur sich am schnellsten verkaufenden Single, seit die Hitparade 1952 ins Leben gerufen worden war. Allein in der ersten Woche wurden eine Million Exemplare verkauft. Die Platte hielt sich für fünf Wochen auf dem ersten Platz und verkaufte sich mehr als 3,5 Millionen Mal. Damit wurde sie zur meistverkauften Single aller Zeiten in Großbritannien – und löste nach nunmehr neun Jahren Queens „Ba-Rock“-Meisterwerk „Bohemian Rhapsody“ auf dieser Position ab. Erst 1997 konnte „Do They Know It’s Christmas“ überholt werden, und zwar von Elton Johns Doppel-A-Seiten-Benefiz-Single „Candle In The Wind / Something About The Way You Look Tonight“, die er für Diana, die verstorbene Prinzessin von Wales, neu aufgenommen hatte.
„Queen waren definitiv enttäuscht, dass niemand sie gefragt hatte, ob sie bei ›Do They Know It’s Christmas‹ mitmachen wollen“, bestätigte Spike Edney, ein Sessionmusiker, der bei Queen als fünftes Bandmitglied auf Tour an Keyboards, Gesang und Rhythmusgitarre aushalf und sich seinen Namen bei den Boomtown Rats und einer Anzahl anderer erfolgreicher Bands gemacht hatte.
„Ich war auf Tour mit Geldof und den Rats, und da habe ich ihm das gesagt. Daraufhin erzählte er mir, dass er hoffe, ein Konzert auf die Beine stellen zu können, und dass er dafür auch bei Queen anfragen wolle. Ich weiß noch, dass ich dachte: Blödsinn, der spinnt doch, das kriegt er nie hin.“
Aber allein schon die Reaktion der Industrie auf das, was Geldof erreicht hatte, ließ anderes vermuten. Auch in den USA zögerte man nicht lange und stellte die Supergruppe USA for Africa mit der Single „We Are The World“ auf die Beine. Der Song, den Michael Jackson und Lionel Richie geschrieben und Quincy Jones und Michael Omartian produziert hatten, brachte einige der weltgrößten Musiklegenden zusammen. Er wurde im Januar 1985 in den A & M Studios in Hollywood aufgenommen und beeindruckte mit seinem Staraufgebot, zu dem unter anderem Diana Ross, Bruce Springsteen, Smokey Robinson, Cyndi Lauper, Billy Joel, Dionne Warwick und Huey Lewis zählten. Alles in allem beteiligten sich mehr als 45 amerikanische Top-Interpreten an der Platte, 50 Künstler mussten abgewiesen werden. Als die Auserwählten bei den Studios eintrafen, prangte ihnen ein Schild entgegen, das sie anwies, „ihre Egos an der Tür abzugeben“. Und ein spitzbübischer Stevie Wonder empfing sie mit den Worten, dass er sie zusammen mit seinem ebenfalls blinden Musikerkollegen Ray Charles mit dem Auto nach Hause fahren werde, sollte ihre Leistung seinen Ansprüchen nicht genügen oder nicht nach einem Take sitzen. Die Platte ging mehr als 20 Millionen Mal über die Theke und wurde damit zu der Popsingle, die sich in den USA am schnellsten verkaufte.
Queen hatte gerade ihre anspruchsvolle Platte The Works abgeliefert, als Geldof alle Räder in Bewegung setzte und seine Pläne verkündete, das ambitionierteste Rock-’n’-Roll-Projekt aller Zeiten zu verwirklichen. Weil man sie bei der Single ignoriert hatte, rechneten Queen nicht damit, dass sie für das Konzert ausgewählt würden. Heutzutage muss einem das wie die reinste Ironie vorkommen. Obwohl sie auf eine 15-jährige Karriere zurückblicken konnten, Alben, Singles und Videos, die ihresgleichen suchen, veröffentlicht, Tantiemen in mehrfacher Millionenhöhe verdient und fast jeden Musikpreis, den es gab, abgeräumt hatten, weil sie als Band musikalische Fähigkeiten an den Tag legten, die vor Rock, Pop, Oper, Rockabilly, Disco, Funk oder Folk nicht haltmachten, schien der Stern von Queen im Sinken begriffen. Die Band war zwischen August 1984 und Mai 1985 eine beträchtliche Zeit unterwegs gewesen, in der sie ihr Album The Works promoteten und im Januar 1985 beim Festival Rock in Rio vor 325000 Fans auftraten. Aber die Tournee war nicht ohne Probleme verlaufen. Es war die Rede davon, dass man getrennte Wege gehen wolle.
„Man merkte, dass die Band irgendwie in der Luft hing“, bestätigte Spike Edney. „Die Zeiten hatten sich geändert, die Leute interessierten sich für eine ganz andere Art von Musik. Auf einmal waren New Romantics das große Ding, Spandau Ballet und Duran Duran. Man kann Erfolg oder Misserfolg nicht voraussehen – es gibt da keine Garantien. Es lief schon länger etwas schief für Queen, besonders in Amerika. Sie hatten dort Ärger mit ihrer Plattenfirma. Ihr Selbstvertrauen war angekratzt. Vielleicht haben sie das ja hin und wieder aneinander ausgelassen. Wer würde das nicht tun?“
„Hey, das ist halt so, Menschen streiten sich auch mal“, begründete es ein Freund der Gruppe, der Keyboard-Maestro und Musiker bei Strawbs und Yes, Rick Wakeman.
„Mitglieder einer Band streiten sich. Das muss man doch verstehen: In wie vielen anderen Berufen hockt man sich ständig auf der Pelle? Auf Tour frühstückst du gemeinsam, fährst zusammen zur Arbeit, nimmst jede Mahlzeit mit den anderen ein. Du bist höchstens allein, wenn du in deinem Bett liegst – und manchmal nicht mal dann. Ganz egal, wie freundlich alle zueinander sind, irgendwann kommt der Tag, an dem du dir sagst: Wenn der Typ sich noch einmal so am Kopf kratzt, dann steche ich ihn ab. Du musst lernen, den anderen ein wenig Raum zu lassen. Wenn man die richtige Musik macht, spielt es keine Rolle, ob sich einer besäuft, einer in Drogenhöhlen versumpft, einer früher zum Konzertort fährt, um zu üben, oder der andere abhaut und sich ein Fußballspiel anschaut. Wenn man eine Band hat, vier oder fünf extrem kreative Menschen, die mit Hirn, Händen oder Stimme Wundervolles erschaffen können, dann birgt das gleichzeitig ein großes Konfliktpotenzial. In dieser Hinsicht unterschieden sich Queen kaum von allen anderen.“
Nach der Tournee zur Promotion ihres verblüffend tanzmusikorientierten und ohne Gitarre aufgenommenen 1982er-Albums Hot Space hatten Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor und John Deacon die Band erst mal auf Eis gelegt, um sich auf Soloaktivitäten zu konzentrieren – allen voran Brian, der mit Eddie Van Halen das Star Fleet Project aus der Taufe hob, und Freddie, der ein eigenes Album plante. Im August 1983 fanden sich die vier in Los Angeles zur Arbeit an The Works wieder zusammen, ihrem zehnten Studioalbum, das erstmals auch als CD veröffentlicht wurde. „Radio Ga Ga“ war die erste Singleauskopplung. Ebenfalls auf The Works vertreten waren die Hardrock-Nummer „Hammer to Fall“, die klagende Ballade „Is This The World We Created …?“ und das kontrovers aufgenommene „I Want To Break Free“ mit seinem an die britische TV-Soap Coronation Street angelehnten Video, das einen staubsaugenden Freddie in Frauenkleidern zeigt. Während sich die Single in Großbritannien und weiteren Ländern als über alle Maßen populär erwies, verschreckte sie das konservative Publikum in Amerika und erzürnte viele alte Fans.
Was noch schlimmer war: Queen hatten kürzlich gegen den von den Vereinten Nationen initiierten Boykott des kulturellen Austauschs mit dem Apartheid-Regime in Südafrika verstoßen – wie auch Rod Stewart, Rick Wakeman, Status Quo und einige andere. Ihre Auftritte im Oktober 1984 in Sun City, Sol Kerzners Casino-, Golf- und Ferienkomplex in Bophuthatswana, brachten der Band von vielen Seiten Kritik sowie Strafen und den Bann der britischen Musikergewerkschaft ein. Für einen in Afrika geborenen Musiker – wie Freddie – war das eine Ungeheuerlichkeit. Bis die Rassentrennung im Jahr 1993 aufgehoben wurde, blieb das ein Problem für die Band. Ein Jahr danach wurde Nelson Mandela zum Präsidenten Südafrikas gewählt. Queen gehörten in den darauffolgenden Jahren zu den wichtigen und aktivsten Unterstützern Mandelas.
„Ich habe Queen verteidigt, als sie nach Südafrika gingen“, erklärt Rick Wakeman. „Auch ich bin während der Apartheid dort aufgetreten, mit einem Orchester, das sich aus schwarzen Zulus, Asiaten und Weißen zusammensetzte.
Ich habe Journey To The Centre Of The Earth dort aufgeführt, und die britische Presse hat deswegen kein gutes Haar an mir gelassen. Ich habe versucht, es zu erklären, aber niemand wollte mir zuhören. Die Musik ist nicht ›schwarz‹ oder ›weiß‹, es gibt nur ein Orchester und einen Chor. Dort aufzutreten, bedeutete nicht, dass ich das Apartheid-Regime unterstütze. George Benson hat da gespielt, Diana Ross auch. Wieso durften Farbige dort auftreten und Weiße nicht? Das ist doch auch schon wieder rassistisch. Shirley Bassey fuhr hin und meinte: ›Leck mich, ich bin zur Hälfte Schwarze und zur anderen Hälfte Waliserin, was soll mich da noch schocken?‹ Also hatten Queen meine volle Unterstützung, als sie nach Südafrika gingen. Das hat die Aufmerksamkeit auf die ganze Dummheit dort gelenkt und deutlich gemacht, dass Musik keine Geschlechtergrenzen, keine kulturellen oder rassischen Barrieren kennt. Musik ist für alle da.“
Die „globale Jukebox“ von Live Aid sollte sich am 13. Juli 1985 an zwei gigantischen Auftrittsorten manifestieren. Das Wembley-Stadion und das John-F.-Kennedy-Stadion in Philadelphia wurden dazu gebucht. Die Organisation erwies sich als logistischer Albtraum.
„Als Bob zum ersten Mal zu mir ins Büro kam, um über die Veranstaltung zu sprechen, dachte ich, er macht Witze“, erinnerte sich Promoter Harvey Goldsmith. „1985 gab es noch keine Faxgeräte, von Computern und Mobiltelefonen ganz zu schweigen. Wir arbeiteten mit Telex und Festnetzanschlüssen. Ich erinnere mich noch, dass ich eines Abends mit einer Satellitenkarte und einem alten Zirkel im Büro saß und auszurechnen versuchte, wo sich der Satellit zu bestimmten Zeiten befinden würde. Und: Als wir zur BBC gingen, haute Bob dort auf den Tisch und forderte: ›Ich will 17 Stunden Fernsehübertragung!‹ – das war schon revolutionär. Nachdem die BBC zugesagt hatte, konnten wir das als Hebel nutzen, um die Fernsehsender auf der ganzen Welt zu überzeugen. Es war das erste Mal, dass es so etwas überhaupt gab. Mein Job war es, mich darum zu kümmern, dass alles einigermaßen reibungslos funktionierte.“
Dazu kam die Herausforderung, die größten Namen im Rock, von denen einige bereits zu den Benefiz-Singles beigetragen hatten, dazu zu überreden, live aufzutreten und auf diese Weise weitere Gelder für die Verhungernden zu mobilisieren. Es war die unverhohlene Rache der Musikerschaft an den Regierungen der Welt, die versagt hatten, weil sie nicht handelten.
Francis Rossi von Status Quo drückte es so aus: „Es waren halt mal wieder die dickköpfigen Rock ’n’ Roller, die stur ihr Ding durchzogen. Im Nachhinein macht es mich sogar wütend, denn wir hätten noch weit mehr erreichen können. Wenn alle an einem Strang gezogen hätten – und wenn wir hätten voraussehen können, in welcher Größenordnung sich der Event bewegen würde –, hätten wir die Ölgesellschaften, die BPs und Shells und wie sie alle heißen, dazu bringen können, auch ihren Beitrag zu leisten. Wir hätten die zwanzigfache Summe zusammenbringen können. Und hätte die Regierung nicht die Werbekampagnen unterstützen können? Wenn die ganzen großen Konzerne mitgemacht hätten, dann wäre das Ergebnis unfassbar gewesen. Zu der Zeit war das jungfräuliches Gebiet, keiner hatte sich zuvor an so etwas herangetraut. Heute sehen wir Live Aid in einem anderen Licht. Aber trotzdem, Hut ab vor Bob. Er hat etwas auf die Beine gestellt, was außer ihm wenige geschafft hätten.“
Wie schaffte es Geldof, Queen mit ins Boot zu holen?
„26 Jahre nach seinem Tod dürften zwar ziemlich alle Mercury-Geheimnisse gelüftet worden sein, in dem beim Piper-Verlag erschienenen Buch ›Freddie Mercury: Die Biografie‹ der Engländerin Lesley-Ann Jones kann man sie nachlesen.“
„In diesem Buch ergänzt Lesley-Ann Jones die Legenden und Mythen um Mercurys Person kenntnisreich und liefert ein sehr persönliches und intimes Portrait des Mannes, der einst erklärte: ›I won't be a rockstar. I will be a legend.‹“






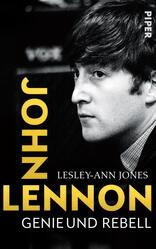
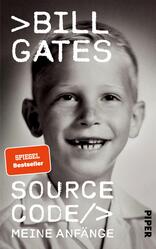
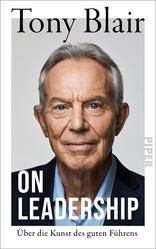

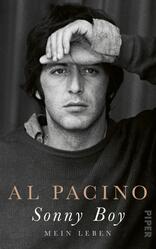






Ein sehr informatives Buch, in dem man diesen Ausnahmekünstler Freddie Mercury noch besser kennenlernt. Freddie Mercury wird nie, niemals vergessen werden. Eine Legende!!!
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.