Blicken Sie mit dem Autor und China-Kenner Kai Strittmatter hinter die Kulissen der Nation, die den USA den Rang als Weltmacht Nummer eins streitig machen möchte.
Chinesen lesen von hinten nach vorn, ihr Kompass zeigt nach Süden, und auch lebende Buddhas haben bei ihnen Visitenkarten. Lernen Sie das Land verstehen, in dem Weiß die Farbe der Trauer ist, Pandas für die Regierung schuften und die Kommunisten selbst die frechste Fälschung sind.
Dies ist der Wegweiser zu einer Nation, die uns plötzlich die Milch wegtrinkt, unseren Kindern ihre Lieblings-App liefert und bei der die Kluft zwischen Arm…
Blicken Sie mit dem Autor und China-Kenner Kai Strittmatter hinter die Kulissen der Nation, die den USA den Rang als Weltmacht Nummer eins streitig machen möchte.
Chinesen lesen von hinten nach vorn, ihr Kompass zeigt nach Süden, und auch lebende Buddhas haben bei ihnen Visitenkarten. Lernen Sie das Land verstehen, in dem Weiß die Farbe der Trauer ist, Pandas für die Regierung schuften und die Kommunisten selbst die frechste Fälschung sind.
Dies ist der Wegweiser zu einer Nation, die uns plötzlich die Milch wegtrinkt, unseren Kindern ihre Lieblings-App liefert und bei der die Kluft zwischen Arm und Reich rasant wächst. Erfahren Sie, wie Sie sich für Zufallsbegegnungen auf dem Plumpsklo wappnen. Weshalb Chinesen sehr wohl das „r“ rollen können. Dass der Mao-Anzug in China gar nicht Mao-Anzug heißt und trotzdem ein Comeback als schickes Modezitat feiert. Wo die Kommunisten heute sogar Konfuzius für sich einspannen und der Diktatur mithilfe von Künstlicher Intelligenz und Big Data ein digitales Update verpassen. Und am Ende verrät dieses Buch auch, was Frühlingsrollen und Weißwürste gemeinsam haben.
„Eine herzenswarme, kluge China-Einführung, virtuos aufgeschrieben.“ GEO Special





















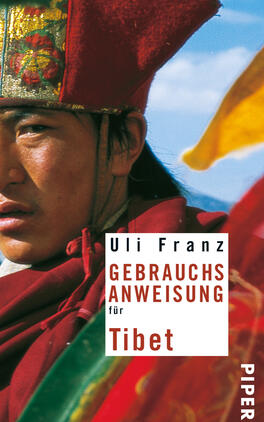

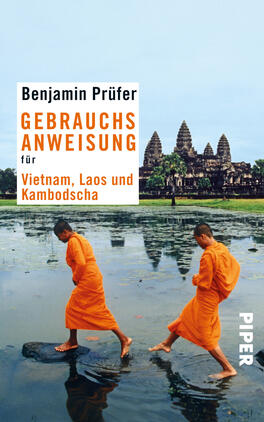

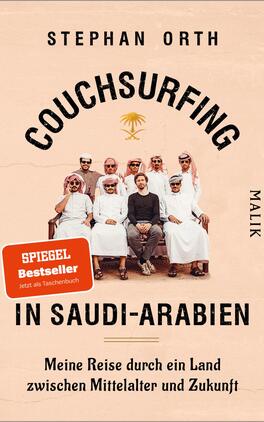






Die erste Bewertung schreiben