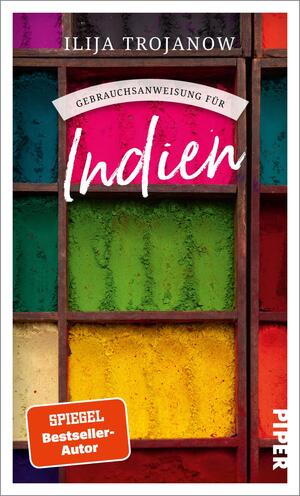
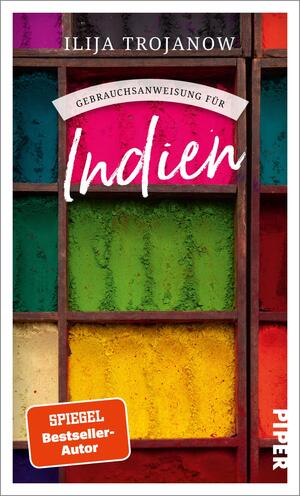
Gebrauchsanweisung für Indien Gebrauchsanweisung für Indien - eBook-Ausgabe
Gebrauchsanweisung für Indien — Inhalt
Inside India: von Kerala bis Kalkutta, von Kapital bis Karma
Ilija Trojanow, der über fünf Jahre in Indien lebte, betrachtet liebevoll-kritisch die vielfältigste Kultur der Menschheit, das Land der Gegensätzlichkeiten auf dem Weg zur Weltmacht. Anhand persönlicher Erlebnisse und typischer, mehrdeutiger Begriffe unternimmt er unterhaltsame Streifzüge durch den Alltag zwischen Chutney und Cricket, Armut und Ayurveda, Saris und Sufis, Raga und Bhangra, Cybergöttern und Popidolen. Und er wagt einen Blick auf Indiens Wandel, Zukunft und die Bedrohung, die der politische Hinduismus Hindutva mit seiner enormen Dynamik entfalten könnte.
„Von anderen Indien-Reisenden unterscheidet Trojanow sich durch eine vorsichtige Annäherung ans indische Leben, die Vorurteile und hastige Urteile vermeiden möchte.“ Frankfurter Allgemeine Zeitung
Ilija Trojanow hat Indien immer wieder erkundet und ist u.a. dem Ganges von der Quelle im Himalaja bis in die großen Städte gefolgt. Für seine Gebrauchsanweisung sieht er genau hin und räumt mit gängigen Stereotypen auf – vor allem mit den festgefahrenen Bildern von heiligen Kühen, badenden Pilgern, scharfen Curry-Gerichten und anderen Klischees der europäischen Wahrnehmung. Eine überraschende Entdeckungsreise in das Land der Widersprüche, das beseelt und bezaubert, aber auch erzürnt und verwirrt.
Leseprobe zu „Gebrauchsanweisung für Indien“
Vorab
Ehe wir von Mantra zu Monsun gelangen, vorab einige Bemerkungen über das Unverfrorene des Vorhabens, über die Unermesslichkeit des Themas, aber auch über die Zuversicht des Autors, die Herausforderung zu meistern.
Nach Indien kam ich über Kenia. Nach Kenia kam ich über Zirndorf. Nach Zirndorf kam ich über Triest. Und nach Triest kam ich über den Fluchtweg. Bei so viel Umwegerei erschien mir Indien gar nicht so fremd. Als junger Verleger in München hatte ich eine ethnologische Reihe namens ›Ganesh‹ betreut; in Mumbai (Bombay) erfuhr ich, dass der [...]
Vorab
Ehe wir von Mantra zu Monsun gelangen, vorab einige Bemerkungen über das Unverfrorene des Vorhabens, über die Unermesslichkeit des Themas, aber auch über die Zuversicht des Autors, die Herausforderung zu meistern.
Nach Indien kam ich über Kenia. Nach Kenia kam ich über Zirndorf. Nach Zirndorf kam ich über Triest. Und nach Triest kam ich über den Fluchtweg. Bei so viel Umwegerei erschien mir Indien gar nicht so fremd. Als junger Verleger in München hatte ich eine ethnologische Reihe namens ›Ganesh‹ betreut; in Mumbai (Bombay) erfuhr ich, dass der elefantenköpfige Gott Ganesh auf einer Maus reitet, die Mushka heißt. Die bulgarische Maus wird Mishka genannt. So waren Herkunft und Ankunft nur einen Vokal voneinander entfernt.
Bis zu meinem dreißigsten Lebensjahr wusste ich nichts über Indien. Dann führte mich ein Mann namens Richard Francis Burton dorthin, und den größten Teil der nächsten zehn Jahre verbrachte ich damit, mich mit Indien vertraut zu machen. Burton war ein Abenteurer, ein Grenzgänger und Freidenker. Im 19. Jahrhundert widmete er sich unbekannten Sprachen und vertiefte sich in fremde Religionen. Er war mir ein nützliches Vorbild. Auf seinen Spuren konnte ich vieles lernen, einiges erleben und hinter manches Geheimnis blicken.
Mein Bild von Indien war anfänglich geprägt von den vielen Abziehbildern und Verfälschungen, die sich in der europäischen Literatur, in Film und Fernsehen eingenistet haben. Die Reaktion auf die verstörende Fremdheit Indiens war seit jeher die verfremdende Darstellung. Indien war schon immer eine Leinwand unserer Projektionen, Objekt unserer Fehl- und Vorurteile. In der Antike vermutete man in Indien den Garten Eden (und heute ein Software-Dorado), und der Ganges galt als Grenzfluss des Paradieses. Die ersten Abenteurer, die aus dem tatsächlichen Indien heimkehrten, berichteten von schrecklichen Dingen: Die Inder verbrennen ihre Leichen, verehren blutrünstige Götter, essen keine Tiere, weil jede Ziege und jeder Hase die wiedergeborene Großmutter sein könnte. Bis in unsere Tage hinein wird der Zauber des Fremdartigen umgestülpt in einen Schrecken des Absonderlichen. Sogar was das Essen betrifft: eine gefährliche Versuchung, die im Durchfall endet. Und überhaupt: Der gemeine Inder hätte genug zu essen, aber weil ihm die Kühe heilig sind, fällt für ihn täglich nur eine Handvoll Reis ab.
Vor vielen Jahren fragte ein Reisender, verwirrt von all den Idolen mit unterschiedlichen Namen und grotesken Formen, einen einheimischen Priester, wie viele Götter es denn nun in diesem Indien gebe. So viele wie Menschen, lautete die gewitzte Antwort. Was der Reisende als bare Münze nahm und kurzerhand aus den damals dreihundertdreißig Millionen Einwohnern von Britisch-Indien dreihundertdreißig Millionen hinduistische Götter zauberte. Diese Zahl geistert seitdem durch die Literatur. Kaum ein Thema ist dem Europäer so fern geblieben wie der Glaube der meisten Inder, als Hinduismus auf einen täuschend klaren Nenner gebracht – eigentlich bedeutet Hindu nichts anderes als „jener, der hinter dem einstigen Grenzfluss Indus (Sind) lebt“.
Diese Vielgötterei, diesen sakralen Mischmasch kann doch kein Mensch verstehen, lautet ein beliebtes Mantra (siehe Kap. 1) westlicher Journalisten, wenn sie zum wiederholten Male das mühsam Erlernte über den Haufen werfen müssen, weil der gelüftete Schleier den Blick auf einen weiteren Schleier öffnet. Wir im Westen haben nicht gelernt, mit gespiegelten Täuschungen umzugehen, während der irreführende Charakter des Offensichtlichen im indischen Bewusstsein als Maya (siehe Kap. 4) seit jeher verankert ist. Das Paradoxon ist bei uns eine lästige Unstimmigkeit, bei vielen indischen Denkern und Dichtern hingegen ein scharfes Instrument der Erkenntnis.
Manche Sinnsucher vertrauen sich mit Haut und Herz einem Guru an (siehe Kap. 3) und entwickeln sich zu Anhängern einer Schmalspurfassung östlicher Spiritualität. Für mich hingegen bietet Indien einen einzigartigen Masala-Mix (siehe Kap. 5), über dessen Ingredienzien niemand so ganz genau Bescheid weiß, aber dessen Wirkung beseelen und bezaubern, aber auch erzürnen und verwirren kann. Und doch ist manches ganz einfach, und manches muss einfach behauptet werden, um überhaupt ein Bild zeichnen zu können, wenn auch in dem Bewusstsein, dass es sich um eine individuelle, subjektive Vision handelt.
Obwohl ich, abgesehen vom Nordosten, jede Region Indiens ausgiebig bereist habe, fühle ich mich der Stadt Mumbai – wobei der Begriff ›Stadt‹ diesem überbordenden Lebensraum kaum gerecht wird – besonders verbunden. Für mich ist Mumbai die lebendigste und vielfältigste Metropole, die ich kenne, und ich habe fast jeden Tag meiner knapp sechs Jahre dort mit Gewinn zugebracht. Dieses Buch ist also auch ein Buch über Mumbai, nicht nur die wichtigste Stadt Indiens, sondern auch die typischste, denn keine andere Metropole beinhaltet so sehr jenes, was allein als Indiens Wesensart gelten könnte: die Vielfalt.
Wer Indien zum ersten Mal besucht, erlebt seinen größten Kulturschock gerade in den Großstädten, neben Mumbai vor allem in Delhi und Kolkata. Hier konzentriert sich die Armut, mit der jeder Reisende unweigerlich konfrontiert wird. Menschen, die auf den Bürgersteigen leben; Männer, die gewaltig beladene Karren schleppen; Mädchen, die in die Prostitution gezwungen worden sind. Und doch begegnet man einem Mut und einer Lebensfreude, die beeindrucken und manchmal beschämen. Es ist – und ich weiß, wie kitschig sich dies auf der gedruckten Seite ausmacht –, als seien die Herzen der Menschen so reich wie die Basare, die man in jeder indischen Stadt vorfindet.
Besonders eng aneinander schmiegen sich die Widersprüche in Agra. Das Taj Mahal schlägt jeden Betrachter, obwohl schon tausendmal abgebildet, in seinen Bann. Doch um das Grabmal der geliebten Königsgemahlin herum erstreckt sich ein Moloch mit stinkenden Straßen, offener Kanalisation, herumstreunenden Schweinen, pockennarbigen Fassaden und taumelnden Baracken. Wer sich umschaut, erlebt ein Wechselbad der Gefühle: Ekel folgt auf Begeisterung, doch im Handumdrehen wird man wieder betört, um gleich darauf zur Verzweiflung gebracht und doch noch vor dem Sonnenuntergang wieder versöhnt zu werden. Manch einer wird mit unangenehmen Erinnerungen nach Hause zurückkehren, aber ich kenne niemanden, der diese Erfahrung missen möchte.
Die Stadt Varanasi hingegen ist der Mittelpunkt des Kosmos und die wohl älteste kontinuierlich besiedelte Stadt der Welt. Der Ort, an dem Gott sich niedergelassen hat, als er eine Familie zu gründen wünschte. Varanasi ist voller Paradoxa, die wie Flaschenzüge das Fundament der Tradition mit dem Aufbau der Moderne verbinden. Hier hat Buddha zum ersten Mal gelehrt, die wohl erste sozialrevolutionäre Lehre der Geschichte. Hier geben Yogis Unterricht in Atemtechniken, die vor viertausend Jahren mit den arischen Einwanderern vom Himalaja in die Gangesebene wanderten. Während das Bewusstsein auf das Ein- und Ausatmen konzentriert wird, um die innere Musik des Körpers zu vernehmen, drangsalieren Hupen, Klingeln, Schreie und Lautsprecher all jene, die noch nicht die Treppe der Entrückung emporgestiegen sind.
Varanasi wird oft als morbide Stadt mystifiziert, wegen des Glaubens an einen heilversprechenden Tod am Ufer des Ganges und weil die europäischen Besucher, mit dem Tod von Haus aus nur als Tabu vertraut, den Anblick der brennenden Leichen einsaugen wie ein kulturrelativistisches Abführmittel. Doch in Wirklichkeit wird in Varanasi täglich das Leben bejaht, die Lärmkulisse ist eine Komposition, mit der sich die Stadt selbst fortschreibt, und die erregbaren Männer drängen den Touristinnen handgreiflich ein ganz persönliches Shanti auf.
Wohin gehst du? fragte mich ein junger Schlepper. In den Himmel! gab ich zur Antwort, in der naiven Hoffnung, ihm damit eine Abfuhr erteilt zu haben. Bevor du in den Himmel gehst, rief mir der junge Mann hinterher, verbringe doch eine Nacht in meinem Hotel.
Indien lässt einen immer wieder spüren, wie wenig Zeit man auf Erden hat. Es erscheint endlos. Nicht nur verfügt es über eine immense Dichte an Geschichte und eine Bibliothek, die eine ganze Brigade von Lesern nicht bewältigen könnte, es erstreckt sich über eine Fläche größer als die der Europäischen Union, und es vereint eine immense geografische, sprachliche, kulturelle und religiöse Vielfalt. Kaum etwas verbindet einen Christen aus dem Nordosten, einen landlosen Unberührbaren (Dalit) aus Bihar, einen wohlhabenden Parsen aus Mumbai und einen muslimischen Fischer aus Kerala miteinander. Außer dem fiktiven Gebilde einer Nation, das sich trotz kolonialer Herkunft und blutiger Trennung von Pakistan im Jahre 1947 als erstaunlich stabil erwiesen hat.
Zwar hat die Gründung neuer Bundesstaaten seit 2000 den Kräften der regionalen Divergenz Tribut gezollt, aber im Gegensatz zu anderen Vielvölkerstaaten wie etwa Indonesien droht Indien keineswegs an seiner Mannigfaltigkeit zu zerbrechen. In diesem Sinne ist Indien ein Vorbild für das Miteinander des Unterschiedlichen und scheinbar Gegensätzlichen, durchaus konfliktreich, aber im Laufe der Geschichte ebenso befruchtend.
Wer weiß, wie man in hundert Jahren auf das 21. Jahrhundert zurückblicken werden wird. Vielleicht wird sich erwiesen haben, dass das noch immer als arm und rückständig geltende Indien mit einigen Herausforderungen der Epoche besser zurechtgekommen sein wird als die reichen, entwickelten Länder des Westens.
1. Mantra
Mantra (Sanskrit, ›Schutz durch Gedanken‹; ›man‹ – denken; ›mana‹ – Geist; ›manava‹ – Homo sapiens): 1. Im Hinduismus und Buddhismus ein heiliger Ausspruch aus einer Silbe, einem Wort oder einem Vers, versehen mit mystischen oder spirituellen Kräften. 2. In der Umgangssprache, ob Deutsch oder Englisch, eine oft wiederholte, vermeintliche Wahrheit. Durchaus auch im abfälligen Sinn verwendet. 3. Motto, Maxime, Slogan, Werbeschlagwort.
Es waren Millionen versammelt. Millionen von Menschen und Millionen von Dezibel. Zum größten Fest der Menschheit. Zum gewaltigsten Ritual Indiens. Ein Anlass, sich zu reinigen, Energie zu tanken, sich seiner Glaubenswelt zu vergewissern. Der Ort – der Zusammenfluss von Ganges und Jamuna nahe der Stadt Allahabad – war ebenso segensreich wie der Zeitpunkt. Ein heiliges Zusammenkommen von Ort und Zeit, das nur hier stattfinden kann, alle zwölf Jahre.
Drei Wochen verbrachte ich auf diesem Fest, der Kumbh Mela, untergebracht in einem Zelt, umgeben von den Eremiten, die Sadhus genannt werden und die oft nur in die Asche gekleidet sind, mit der sie sich eingeschmiert haben, und den Schwaden Hasch, die sie umräuchern. Jeden Morgen wurde ich um fünf in der Früh jäh aus meinem Schlaf gerissen von einem unsäglichen Gekreische, einer Mischung aus Sirenengesang und Bombenalarm. Die Lautsprecher erwachten vor der Sonne. Und sie begrüßten den Tag mit einem Mantra, einem außergewöhnlich kraftvollen, wichtigen, heiligen und mächtigen Mantra: Shanti, Shanti, Shanti. Das bedeutet: Friede! Ich habe an jedem dieser verschlafenen Morgen einige Minuten lang fassungslos in die schallende Schrille geblickt, bis ich begriff, dass es eines besonders lauten, besonders durchdringenden Mantras bedarf, um aus Frieden heraus neuen Frieden zu finden. Denn Gott (Shiva zum Beispiel) ist Zerstörer und Erschaffer zugleich, und das Schwache muss mit starken Worten verteidigt werden.
Mit Shanti wird nicht nur der Schlaf zerrissen, sondern auch das Gebet beendet. Die Wiederholung verdankt sich dem Glauben, dass sich alles, was dreifach ausgesprochen wird, verwirklicht – trivaram satyam (salopp übersetzt: ›Aller guten Dinge sind drei‹). Unglücklicherweise für jene, die auf dem Kumbh-Mela-Fest ein wenig länger schlafen wollten, besteht ein Mantra nicht nur aus dieser dreifachen Wiederholung. Mantras, deren Umfang von drei Wörtern bis hin zu seitenlangen Gedichten reichen kann, werden in Gebet und Meditation immer wieder gesprochen, in Zyklen der Wiederholung, die Mala genannt werden, nach der Gebetskette, auf der meist hundertacht Perlen aufgefädelt sind. Die Art und die Länge des Mala variieren je nach Anlass, Ort und Familientradition. Anushthana heißt der Brauch einer genau vorgeschriebenen Zahl von Wiederholungen.
Vor Jahren traf ich bei meinem Guru (siehe Kap. 3) in Mumbai einen jungen Mann von knapp zwanzig Jahren, der kurz zuvor für drei Wochen nach Haridwar gereist war, dorthin, wo der Ganges sich der nordindischen Ebene ergibt. Er hatte in einem Tempel hundertfünfundzwanzigtausend Mal das Gayatri-Mantra (das wohl bekannteste Mantra Indiens, eine uralte Anbetung der Sonne, die auf unzähligen CDs festgehalten ist, für jene, denen das Aufsagen zu mühsam ist und die es deshalb vorziehen, das Mantra morgens elektronisch abzuspielen) wiederholt, was jeweils drei Stunden gedauert hatte. In den Pausen dazwischen hatte er ein einfaches Mahl aus Reis und Linsen zu sich genommen oder eine Weile geschlafen.
Besonders beliebt ist es, ein Mantra aus zweiundfünfzig Zeilen zweiundfünfzig Mal zu sprechen. Wobei das Sprechen nicht immer so lauthals ausfallen muss wie bei der Kumbh Mela. Das Mantra kann in den Gedanken des Betenden widerhallen. Auch wäre es ein Missverständnis zu vermuten, dass jedes Mantra einen klaren Sinn in sich trägt. Mananat tryate iti mantra heißt es auf Sanskrit: ›das, was dich schützt, wenn du daran denkst‹. Das Mantra zeichnet sich also durch seine Kraft aus, nicht durch seine Bedeutung; es ist ein Destillat aus Erfahrung und Weisheit, ein potentes, konzentriertes Mittel. Deswegen sind westliche Besucher beziehungsweise Leser oft enttäuscht, wenn sie die Übersetzung der magischen Formeln erfahren. Das wichtigste Mantra des tibetanischen Buddhismus etwa lautet Aum mani padme hum, wunderschön gesummt oder gesungen, und doch beeindruckt es in seiner wörtlichen Übertragung – ›Grüße an das Juwel des Lotus‹ – weitaus weniger. Selbst die Erklärung, dass es sich um eine Anrufung des allmächtigen Geistes handelt, der überall gleich ist, im Inneren des Menschen wie auch in allem, was um ihn herum geschieht, vermittelt nicht die Essenz des Mantras, so wenig wie ›Abrakadabra‹ mit einem Wörterbuch zu entschlüsseln wäre.
Kabir, der bekannteste mittelalterliche Dichter Indiens, ein Rebell, der nachträglich zum Heiligen verfälscht wurde, sehnte sich in jungen Jahren nach einem Mantra, das ihm den Weg zu seiner geistigen Entwicklung ebnen würde. Aber da seine Herkunft in seiner Geburtsstadt Varanasi suspekt war – er stammte aus niederen Verhältnissen, und es war nicht bekannt, ob aus einer muslimischen oder einer Hindu-Familie –, wollte keiner der Priester, die er ansprach, ihn als Schüler aufnehmen, ihm sein Mantra anvertrauen. Denn jeder Lehrer besitzt ein eigenes, geheimes Mantra, das nicht nur von Generation zu Generation weitergereicht, sondern auch durch die Seelenstärke des Lehrers aufgeladen wird.
Verzweifelt, aber nicht gewillt aufzugeben, legte sich der junge Kabir auf eine Stufe jener Treppen, die zum Ganges hinabführen und über die Tausende von Einheimischen und Pilgern täglich auf und ab schreiten, um ihr gesegnetes Bad im heiligen Fluss zu nehmen. Auch der bedeutendste Lehrer jener Zeit, Guru Ramananda, stieg jeden frühen Morgen diese Treppen hinab. Am nächsten Morgen, das Tageslicht war so schwach wie die Sicht des Lehrers, trat Guru Ramananda auf einen ausgestreckten Körper und stürzte über den jungen Kabir. „Ram, Ram“, rief Guru Ramananda erschrocken aus, worauf Kabir aufsprang, die Füße des Lehrers berührte und sich überschwänglich für das Mantra bedankte, das dieser ihm hatte angedeihen lassen. Zwar hatte der Lehrer das Mantra in einer Schrecksekunde unbedacht von sich gegeben, aber was immer der Grund gewesen sein mochte, auch wenn es erschlichen wurde, es war überreicht worden. Es galt in seiner ganzen Machtfülle nun auch für Kabir. Ein Leben lang begnügte er sich damit, beim Meditieren Ram, Ram zu intonieren, den Namen Gottes in einfacher Wiederholung.
Diese Legende findet auch in heutigen Zeiten Nachahmer. Unweit von den sandigen Uferebenen, auf denen sich das Kumbh-Mela-Fest ausbreitet, lebte noch im 20. Jahrhundert ein Heiliger, der sein letztes Lebensjahrzehnt damit zubrachte, Ram, Ram zu wiederholen, unentwegt, und jedes andere Wort verschmähte.
Die Wiederholung eines Mantras führt in die Trance. Die Wiederholung des Money Mantra führt laut einer Werbung zu Artha (siehe Kap. 8) und die dauernde Wiederholung politischer Mantras zur Verdummung, wobei es keineswegs einem sprachkritischen Impetus zu verdanken ist, dass der Minister Mantri und das Parlament Mantralaya heißt.
Da wir das Wort ›Mantra‹ Indien verdanken, erscheint es mir nur angemessen, dass Indien das Opfer unzähliger Mantras geworden ist. Denn Mantras dienen auch als Feigenblätter des Unwissens. Die erste heilige Kuh, die an dieser Stelle zu schlachten wäre, ist das Mantra von der Heiligkeit der Kuh. Kaum eine Fernsehsendung über Indien ohne Kuh, vor allem nicht ohne Kühe, die sich durch den Straßenverkehr bewegen oder an einer befahrenen Kreuzung mampfen und somit kraft ihrer Existenz die Kontinuität des Traditionellen im urbanen, modernen Indien beweisen. Als ich Anfang 2006 mit einem deutschen Fernsehteam in Mumbai einen kurzen Film drehte, hielt der Redakteur vor jeder Kuh inne und versuchte mich zu überzeugen, ich solle an ihr vorbeischlendern. Eine Kuh im Bild ist eben besser als tausend Gedanken.
Die Sache mit der heiligen Kuh hat jedoch einen Haken: Die Kuh wird nicht angebetet, es gibt keinen Tempel, der einer Kuh geweiht ist, und es existiert kein Gott, der die Form einer Kuh besitzt. Gewiss, der Bulle Nandi trägt den Gott Shiva, aber unter den Reittieren der Götter gibt es auch Ratten und Schwäne, und bislang ist niemand auf die Idee gekommen, diese als heilige Tiere zu bezeichnen, was insofern bedauerlich ist, da die Allgegenwart der Ratten in den Städten ein noch stärkerer Ausdruck der ewigen Spiritualität Indiens wäre (in Rajasthan gibt es sogar einen Tempel der Ratten). Somit erfüllt die allgemeine Wertschätzung der Kuh keineswegs die theologischen Maßstäbe von Heiligkeit. Gläubige Inder wären ebenso erzürnt, wenn Affen oder Elefanten, Adler oder Schlangen getötet werden würden, mit dem kleinen Unterschied, dass die Kuh traditionell und in vielen ländlichen Gebieten auch heute noch mit ihrer Milch die Gemeinschaft ernährt. Wenn also jemand in der Großstadt einige Münzen zahlt, um einer Kuh ein Büschel Gras zu spenden, so verbessert er im Vorbeigehen sein ethisches Konto, indem er einem geachteten Lebewesen Gutes tut.
Übrigens ist es historisch erwiesen, dass die Hindus keineswegs schon immer entschiedene Vegetarier waren. Bevor sich der Buddhismus ausbreitete, wurden Kühe geopfert, geschlachtet und verspeist. Auf den Reliefs nordindischer Tempel sieht man Jäger ein gefesseltes Wildschwein tragen, und es ist nicht anzunehmen, dass sie den Eber zu Zuchtzwecken nach Hause schleppten. Aber da bekanntlich nicht sein kann, was nicht sein darf, werden neuerdings in Indien sogar wissenschaftliche Publikationen zum Thema des antiken Fleischgenusses öffentlich angefeindet, ihre Autoren physisch bedroht. Die Verteidiger eines Mantras können zuzeiten sehr uneinsichtig sein.
In Monghyr am Ganges unterhielt ich mich mit einem knorrigen Mann, der eine kleine Molkerei leitete. Während wir über die Kolonialgeschichte des Ortes sprachen, wurde hinter ihm eine Kuh festgehalten, damit ein Bulle sie besteigen konnte. Ich hatte Schwierigkeiten, mich auf das Gespräch zu konzentrieren, mein Blick stahl sich immer wieder von den asketischen Gesichtszügen des Mannes weg zu dem Drama hinter seinem Rücken. Die Kuh widersetzte sich dem Versuch heftig, der Bulle ging einige Male in die Knie. Die Männer, die den Begattungsversuch beaufsichtigten, lachten erbarmungslos. Die widerspenstige Kuh musste harte Schläge einstecken. Immer wieder besprang sie der geile oder vielleicht auch nur schicksalsergebene Bulle. Schließlich wurden die beiden Tiere weggeführt.
„Hat es geklappt?“, fragte ich den Mann.
„Jaja.“
„Aber die Kuh wollte wohl nicht?“
„Dieses Vieh ist halt so“, antwortete er, „ich weiß nicht, was mit ihr los ist. Was soll’s, sie ist doch nur eine Kuh.“










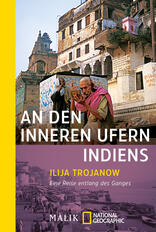


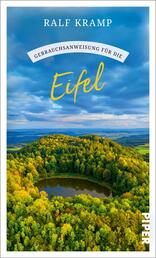
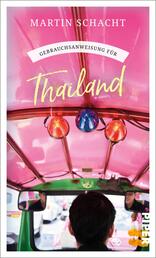
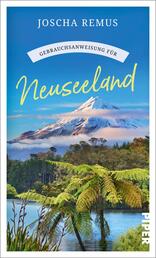





DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.