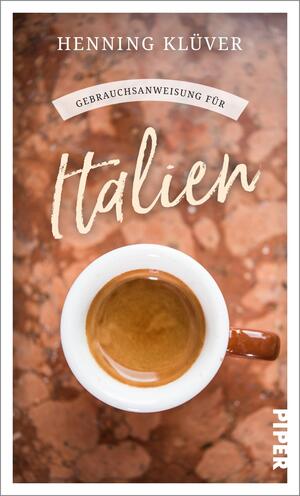
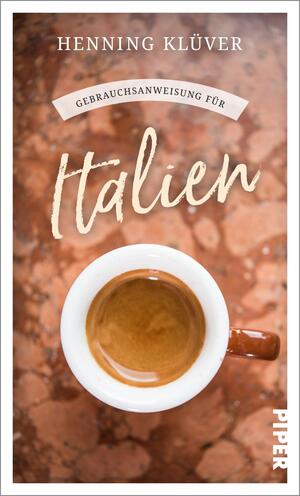
Gebrauchsanweisung für Italien Gebrauchsanweisung für Italien - eBook-Ausgabe
„Klüver schreibt als Journalist ebenso über Politik wie über Kultur – beste Voraussetzungen für einen ebenso liebevollen wie kritischen Blick auf seine Wahlheimat.“ - Stuttgarter Zeitung
Gebrauchsanweisung für Italien — Inhalt
Im Land, wo die Zitronen blühen
„Mit Klüver im Gepäck fühlt man sich wie ein Insider.“ Frankfurter Rundschau
Wissen Sie, warum die Sonne hier wärmer strahlt? Was die Italiener essen, wenn die Mamma keine Lust auf Pasta hat? Und warum alle unsere Schuhe das Gütesiegel „Made in Italy“ tragen? Mit leichter Hand widmet Henning Klüver sich den ureigensten Domänen seiner Wahlheimat: der Familie und der Mafia, der Mode und der Pizza, der Kirche und dem guten Essen.
Der Autor kennt den Unterschied zwischen Pandoro und Panettone, weiß um die Bedeutung der Bar als Institution, die man mehrmals täglich aufsucht. Berichtet, warum die Innenpolitik eher einer Daily Soap gleicht und wie ein Landesvater für reichlich Furore sorgte; und findet Antworten auf die Frage, warum die Deutschen dieses Land so sehr ins Herz geschlossen haben – sich manchmal aber auch darüber ärgern.
La dolce vita garantiert – eine fundierte Liebeserklärung an das Land, wo die Zitronen blühn
Leseprobe zu „Gebrauchsanweisung für Italien“
O sole mio
Annäherungen
Lange haben wir warten müssen. Da konnten die Schwalben noch so zwitschern, konnte der Himmel noch so blau sein und Adriano Celentano im Radio mit dem „Azzurro“-Song noch so sehr Sehnsüchte wecken. Die Pandemie, die in Deutschland mit dem etwas traulichen, irgendwie italienisch klingenden Namen „Corona“ benannt wird, aber in Italien meist nur „Covid 19“ heißt, hatte uns fest im Griff. Es gab Wochen, da durften wir in Mailand die Wohnung nur zum Einkaufen von Lebensmitteln oder höchstens für einen Minispaziergang im Radius von [...]
O sole mio
Annäherungen
Lange haben wir warten müssen. Da konnten die Schwalben noch so zwitschern, konnte der Himmel noch so blau sein und Adriano Celentano im Radio mit dem „Azzurro“-Song noch so sehr Sehnsüchte wecken. Die Pandemie, die in Deutschland mit dem etwas traulichen, irgendwie italienisch klingenden Namen „Corona“ benannt wird, aber in Italien meist nur „Covid 19“ heißt, hatte uns fest im Griff. Es gab Wochen, da durften wir in Mailand die Wohnung nur zum Einkaufen von Lebensmitteln oder höchstens für einen Minispaziergang im Radius von maximal 200 Metern von der Haustür entfernt verlassen. Parks waren gesperrt, Bars, Restaurants sowie die meisten Läden geschlossen und die Spielplätze verwaist. An Reisen war nicht zu denken, und besuchen durfte uns auch keiner – nicht einmal die eigenen Kinder, die in derselben Stadt wohnten. In die Augen gucken konnte man einander nur noch via Zoom oder WhatsApp-Videoanruf. Nachbarschaftssolidarität erlebte man singend oder ein Instrument spielend vom Balkon aus. Dann, nach einem nervigen Hin und Her von Lockerungen und neuen Lockdowns, ersten längeren Ausflügen und erneuten Beschränkungen, kam es auch dank der Impfungen wieder zu mehr Bewegungsfreiheit. Endlich ist Reisen wieder möglich.
Also alles wie gehabt? Auf nach Italien ins Sehnsuchtsland! Endlich wieder den Alltag hinter sich lassen! In den Wochen und Monaten der Pandemie, als das Selbstverständliche plötzlich nicht mehr selbstverständlich war, konnte man sich Zeit nehmen, über alltägliche Gewohnheiten und Lebensstile nachzudenken. Dazu gehörte zudem die Klimadebatte, die inzwischen auch in Italien in jedem Wohnzimmer, an jedem Küchentisch geführt wird.
Die Erfahrungen von Naturkatastrophen, sozialen Ungerechtigkeiten und zunehmend schnellen und oftmals für den Einzelnen unüberschaubaren digital geprägten Wandlungsprozessen überfordern viele Menschen und produzieren Ängste. Nicht nur in Italien treten Flüsse über ihre Ufer oder brennen Wälder. Vielleicht mehr als anderswo hat man hier Erfahrungen mit Erdbeben gemacht. Nördlich wie südlich der Alpen trennen Veränderungsprozesse, die innerhalb der Gesellschaft mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten verlaufen, Alters- und Bildungsgruppen. Das reicht vom schnellen Internet über die inzwischen allgemeine Notwendigkeit eines Smartphones bis zum Umgang mit Bargeld. Überall wächst die Sehnsucht nach dem Ursprünglichen, dem greifbar Lebendigen, dem Natürlichen. Und ist Italien nicht gerade deshalb ein ideales Reiseziel? Jeder kann sich ausmalen, dass Wunsch und Wirklichkeit auch in italienischen Landschaften auseinanderklaffen und Sehnsüchte in Enttäuschungen enden können. Aber ein erster, bescheidener Anfang, aus den Erfahrungen der Pandemie zu lernen und die Problematik der Klimakatastrophe ernst zu nehmen, liegt in einem bewussteren, langsameren Reisen. Versuchen wir es deshalb zunächst mit einem Mosaik von Annäherungen.
In dem Buch „Die unsichtbaren Städte“ von Italo Calvino erzählt Marco Polo dem Mongolenkaiser Kublai Khan von Reisen zu rätselhaften, sogar unsichtbaren Städten. Aber, fragt Kublai nach einigen Erzählungen, wozu nützt eigentlich das viele Reisen?
„Marco Polo stellte sich vor zu antworten (oder Kublai stellte sich seine Antwort vor), dass er, je mehr er sich in unbekannten Vierteln ferner Städte verliere, desto besser die anderen Städte verstehe, durch die er auf dem Weg bis dahin gekommen sei, und er ging im Geist die Etappen seiner Reisen durch und lernte den Hafen wiederzuerkennen, von dem aus er in See gestochen war, und die vertrauten Orte seiner Jugend und die heimische Umgebung und einen kleinen Platz in Venedig, auf dem er als Kind gespielt hatte. (…)
›Machst du Reisen, um deine Vergangenheit wiederzuerleben?‹, war an diesem Punkt die Frage des Khans, die auch hätte formuliert werden können: ›Machst du Reisen, um deine Zukunft wiederzufinden?‹ Und die Antwort von Marco: ›Das Anderswo ist ein Spiegel im Negativ. Der Reisende erkennt das wenige, das sein ist, und entdeckt das viele, das er nicht gehabt hat und nie haben wird.‹“
„Ich fühle, wie mich das Behagen an der Faulheit umschließt!“ Diesen Satz hätte man von einem Workaholic wie Sigmund Freud nicht unbedingt erwartet. Er schreibt ihn in einem Brief an seine Familie aus Rom. Rom ist das Reiseziel seiner Jugendträume, das er in Begleitung seines Bruders Alexander im September 1901 zum ersten Mal besucht. „In Rom eingetroffen, um 3 h nach Bad umgekleidet u Römer geworden. Unbegreiflich, daß wir nicht Jahre früher gekommen sind.“ Freud ist 45 Jahre alt. Er sollte danach öfter, insgesamt sieben Mal in die Ewige Stadt reisen.
Aber nicht nur Rom. Freud reiste zwischen 1895 und 1923 mehrfach kreuz und quer durch die Apennin-Halbinsel. Er war geradezu „verrückt nach Italien“, wie man in einem Buch von Jörg-Dieter Kogel („Im Land der Träume. Mit Sigmund Freud in Italien“) lesen kann, das sich auf den reichhaltigen Briefwechsel des Wiener Nervenarztes mit Familie und Freunden stützt. Freud schreibt geradezu manisch fast jeden Tag zumindest einen Kartengruß, wenn nicht einen längeren Brief. Und jubelt etwa in Sizilien: „So viel an Farbenpracht, Wohlgerüchen, Aussichten – und Wohlbefinden habe ich noch nicht beisammengehabt.“ Das Wohlbehagen löst aber zugleich wissenschaftliche Arbeiten Freuds etwa über die Moses-Skulptur von Michelangelo in Rom aus – oder den berühmten Leonardo-Aufsatz nach einem Mailand-Aufenthalt. Dieser „Leonardo“, so lässt er Lou Andreas-Salomé wissen, sei „das einzig Schöne, das ich je geschrieben“ habe.
Bei Sigmund Freud spiegeln sich gleichsam in der Vergangenheit auch aktuelle Verhältnisse wider. Als im September 1910 in Neapel die Cholera ausbricht, befindet er sich gerade auf Sizilien, zusammen mit seinem Schüler und Kollegen Sándor Ferenczi. Um der Cholera auszuweichen, brechen sie die bis dahin äußerst glücklich verlaufene Reise ab. In Rom werden die „Ankömmlinge aus Neapel kontrolliert“, wie Freud erzählt. Sie werden ärztlich untersucht, ob sie etwa Träger von Cholera-Bakterien seien. Freuds größte Furcht heißt: „Quarantanien“. Doch man lässt die beiden Reisenden ziehen, die glücklicherweise noch zwei Fahrkarten für den Schlafwagen nach Wien erstehen können. Nach heutigen Verhältnissen hätten sie sich auch in Wien noch einmal testen lassen müssen, wenn ihnen nicht sogar „Quarantanien“ gedroht hätte.
„Die morgendliche Brise streift umher wie ein Engel. Ich wasche mich, gehe nach draußen. Die Motorkutsche steht da, in der noch milden Sonne, daneben der Junge, ungekämmt und schlaftrunken. Es geht los.“ Die Mailänder Illustrierte Successo hatte 1959 den Filmregisseur und Schriftsteller Pier Paolo Pasolini beauftragt, eine Reportage über eine Autofahrt (in mehreren Etappen) entlang der italienischen Küste rund um den Stiefel von Sanremo bis Triest zu schreiben („La lunga strada di sabbia“ – auf Deutsch erschienen unter dem Titel „Die lange Straße aus Sand“). Pasolini fährt in einem Fiat, den ihm Fellini für die Mitarbeit an dem Film „Die Nächte der Cabiria“ geschenkt hatte. Er erlebt dabei, weitgehend noch ohne Autobahnen, ein Italien, das sich in Teilen sprunghaft, atemberaubend schnell modernisiert, während andere Bereiche noch in vergangenen Jahrhunderten verwurzelt scheinen. Neue Freizeitriten stehen neben alten Gesängen. Überall brechen Widersprüche auf, Konsumdenken und traditionelle Werte überlagern sich. Nicht das Rastlose, wie bei Kerouac, fasziniert ihn, sondern ihn interessieren die Haltepunkte der Reise. „Gassenjungen und Sonne, blendendes Weiß“ auf Ischia. Die bäuerlichen Gesichter in Kalabrien und ihre Welt, die, „wenn nicht gesetzlos, so doch fern unserer eigenen Kultur“ liegt. Er selbst lebt auf bei dieser Spurensuche des Archaischen, genießt die Schönheit der Landschaft, fühlt sich glücklich nachts in Neapel: „Ich habe den Vesuv gesehen, so nah, dass ich nach ihm hätte greifen können, vor einem Himmel, der bald so rot aufloderte, als könne er das Paradies nicht länger verbergen.“
Süditalien wird zu seinem Element. „Ich habe immer gedacht und gesagt, dass Rom die Stadt ist, in der ich leben möchte, gefolgt von Ferrara und Livorno. Aber da kannte ich Reggio, Catania und Syrakus noch nicht. Ohne Zweifel, ohne jeden Zweifel, würde ich hier gerne leben: leben und sterben, nicht an der Stille (…), sondern an der Freude. Trotz einiger prächtiger Ecken und Straßenzüge, eines Barocks, der aus Fleisch gemacht scheint, trotz der Kathedralen von unerhörter, beinahe überladener Üppigkeit sind es keine schönen Städte … Ich kann aber bestätigen, dass einem die Fahrt von Messina nach Syrakus den Verstand rauben kann.“ Dabei ist er sich der Spontaneität seiner Eindrücke bewusst, die schnell von anderen, neuen Gefühlen überlagert werden können: „Ich sage das so dahin, als Tourist. Ginge man einer derart spontanen Verliebtheit nach, lernte man diese Orte nicht nur mit den Augen und der Nase kennen, würde sich sicher herausstellen, dass es dafür echte und tiefere Gründe gibt.“
Ein jüngeres, befreundetes Ehepaar aus Leipzig, beide Lehrer an einer Gesamtschule, hatte mich um Ratschläge gebeten, wie man Italien landauf, landab irgendwie „anders“, also nicht auf ausgetretenen Pfaden erleben könne. Ich vermute, dass inzwischen alle Pfade mehr oder weniger ausgetreten sind und es auch keine „Geheimtipps“ mehr gibt. Wichtig ist, Land und Leuten mit Offenheit und Neugier zu begegnen, das Fremde auf sich wirken zu lassen, aber ebenso der eigenen Lust nach Entspannung Raum zu geben – und schlechten Service oder Verwahrlosungen zu registrieren, ohne daraus gleich Vorurteile zu entwickeln.
Wenn man in Italien auch keine neuen Pfade finden kann, vielleicht erlebt man es schon anders, wenn man sie in der Gegenrichtung abläuft. Wie ich das meinte, fragten mich E. (sie) und F. (er)? „Euer Seume“, antwortete ich, „ist von Leipzig in den Süden nach Syrakus gelaufen. Wenn ihr 14 Tage und vielleicht sogar etwas mehr Zeit habt, fliegt doch einfach nach Sizilien, und reist von Syrakus aus per Eisenbahn und hier und da mit Bus oder Mietwagen in den Norden – in Mailand lade ich euch dann zum Essen ein. Und zwischendurch dürft ihr euch ruhig melden und eure Eindrücke schildern.“ E., etwas praktischer als ihr Mann veranlagt, richtete daraufhin gleich eine Whatsapp-Gruppe „Italienreise“ für die Eltern und ein paar Freunde ein – um ihre Eindrücke und Grüße nicht mehrfach an verschiedene Adressaten verschicken zu müssen: „Hallo zusammen.“
Der Wortschatz legt kulturelle Unterschiede offen: Was im Deutschen alles Eis ist, wird im Italienischen sehr wohl zwischen ghiaccio (gefrorenes Wasser), gelo (allgemein Gefrorenes) und gelato (kalte Süßspeise) unterschieden. Also Eis, gelato, kann eine Delikatesse sein, die dem Süden auch im Winter eine sommerliche Note verleiht. Allein wenn ich an dieses frische, lockere, zitronenduftende Speiseeis aus Sizilien denke, das ich einmal im Februar zusammen mit einer Brioche in Catania genossen habe, wird mir warm ums Herz. Denn Speiseeis, wie jeder Kenner weiß, wärmt. Jedenfalls die Seele.
Lidia, meine italienische Frau, ist da ganz anderer Ansicht. Für sie gehört Eis zum Sommer, weil es erfrischt. Die Italiener sind eben ein ganz praktisches, unsentimentales Volk. Vielleicht passen Deutsche und Italiener deshalb auch so gut zusammen. Und man könnte meinen, die Sizilianer haben das Eis extra für die Völker nördlich der Alpen erfunden, um ihnen den Süden ein bisschen näherzubringen. Tiefer Süden sogar, denn Speiseeis – wie übrigens auch der Zucker – kam im Mittelalter ursprünglich aus dem arabischen Raum nach Süditalien, von wo aus es nach und nach den ganzen Stiefel eroberte und schließlich alle Grenzen sprengte.
Denn was wären die deutsch-italienischen Beziehungen ohne das Speiseeis. Die ersten Arbeitsmigranten aus Italien, die in der Nachkriegszeit in die Bundesrepublik zogen – damals nannte man sie noch „Gastarbeiter“ –, brachten es gleichsam im Gepäck mit und machten das gelato der einheimischen deutschen Bevölkerung im Rahmen von „Eisdielen“ schmackhaft. Sicher, Anfänge hatte es bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts gegeben, als findige Italiener, Saisonarbeiter, die oft aus den Dolomiten stammten, diese südländische Leckerei in Österreich und Deutschland vertrieben. Doch erst mit dem Zustrom italienischer Arbeitskräfte (sowie nach und nach auch ihrer Familien) und der gleichzeitigen Entdeckung Italiens als beliebtes Reiseziel der Bundesdeutschen von den 1950er-Jahren an wurde daraus eine Art „Kulturtransfer“. Einer, der etwa an den Ostdeutschen in der DDR lange Zeit vorbeiging. „Eis wurde zum italienischen Geschmacksträger, sein Genuss verband sich mit der Idee von Bella Italia“, kommentiert Dieter Richter in seinem genussvoll zu lesenden Buch „Con gusto. Die kulinarische Geschichte der Italiensehnsucht“.
In Italien selbst hat die Gelateria nicht nur die von Touristen heimgesuchten Orte erobert. Als es nach der Pandemie erste Lockerungen gab, Reisende aber noch nicht mal zwischen Regionen verkehren durften, standen die Einheimischen – die Abstandsregeln natürlich streng einhaltend – vor ihnen Schlange. Und ich habe früh gelernt, dass es zum guten Ton gehört, ein dolce, eine Süßspeise, mitzubringen, wenn man zum Essen eingeladen wird. Wobei man mit einer Mischung aus Frucht- und Milcheissorten sicher keinen Fehler macht. Vorausgesetzt, der gelataio vertreibt sein eigenes, täglich frisch hergestelltes Eis und lässt sich nicht von irgendwelchen Ketten beliefern oder verkauft das Eis von gestern.
Italien ist ein Paradies für Eisliebhaber, aber man kann leider mangels Qualität auch ziemlich enttäuscht werden. Manchmal braucht man sogar etwas Mut, denn „schräge“ Geschmacksrichtungen greifen um sich. Nicht nur klassische Sorten wie Schokolade, Nuss oder Zitrone, Menta und viele weitere werden angeboten, sondern hier und da auch alle möglichen Gemüsearten (Zucchini, Bohnen), Käse (Gorgonzola, Grana) oder Ricotta (etwa aus Ziegenmilch). In Florenz soll es sogar salziges Eis geben. Fantasie bereichert den Geschmack und belebt das Geschäft, ich bleibe allerdings in der Hinsicht etwas konservativ und kann mich nicht recht mit salzigem Gemüseeis anfreunden.
Nördlich der Alpen kennt man Italien. Hier kann jeder und jede mitreden, selbst die, die noch gar nicht da waren. Schließlich ist Italien von der Prosecco-Bar bis zum Benetton-Laden, von der Gelateria bis zur Pizzeria längst zu uns gekommen. Und was Italien als beliebtes Urlaubsziel angeht, gehört es im Grunde zu Deutschland – da fühlen wir uns zu Hause. Das hat durchaus Tradition. Aus „Positano bei Neapel“ schrieb Bertolt Brecht an Arnolt Bronnen im Mai 1924 eine Postkarte: „… wenn Du die italienische Landschaft kennenlernen willst, dann kaufe Dir eine Ansichtspostkarte; aber wenn Du die Deutschen kennenlernen willst, dann reise nach Italien!“
Die Italiener sind so sympathisch, weil wir uns ihnen gerne, und sei es auch nur ganz im Stillen, ein bisschen überlegen fühlen. Die Tüchtigen und Pünktlichen, die es am Ende richten müssen, das, so reden wir uns gerne ein, sind wir. Und doch beneiden wir sie wegen ihrer Kreativität, wegen ihrer (angeblichen) Fähigkeit, das Leben leichtzunehmen, wegen ihrer Kunstschätze, der vielen Strände und natürlich wegen des besseren Wetters.
Ist das so? „Fragile Freundschaft“ lautet der Titel einer Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung (Rom, 2021), die mit einer Meinungsumfrage die deutsch-italienischen Beziehungen untersucht hat. Das Verhältnis der beiden Länder, so das Fazit, sei „weder konflikt- noch widerspruchsfrei und durchaus von Stereotypisierungen geprägt“. Ein robustes Selbstvertrauen in Deutschland weicht von einem skeptischen und selbstkritischen Italien ab, zu dem ein „leicht gebrochenes Verhältnis zur EU“ gehört. Die Studie macht gegenseitige Schätzung beziehungsweise Achtung aus, aber – so doch das harte Urteil – man würde sich „nicht wirklich kennen“.
In der deutschen Perspektive lässt sich eine „paternalistische Note“ ausmachen, während aus italienischer Sicht nüchtern das partnerschaftliche Verhältnis bei allerdings mangelndem Selbstvertrauen vorherrscht. Wobei von deutscher Seite die italienische Wirtschaftskraft total unterschätzt wird und die überwiegende Mehrheit der Befragten glaubt, dass etwa Italien mehr Geld aus den EU-Kassen erhalte, als es einzahle. Dabei lag Italien im Jahr 2020 nach dem Ausscheiden Großbritanniens im europäischen Vergleich mit einem negativen Haushaltssaldo von vier Milliarden Euro an dritter Stelle hinter Deutschland (minus vierzehn Milliarden Euro) und Frankreich (minus sieben Milliarden Euro).
Über die Beziehungen zwischen Deutschland und Italien gibt es ein bitteres Wort, das jedem, dem beide Kulturen am Herzen liegen, einen Stich versetzt: „Die Deutschen lieben Italien, aber achten die Italiener nicht, die Italiener bewundern Deutschland, aber lieben die Deutschen nicht.“ In ihrem letzten Text, den man nach ihrem Tod fand, schrieb die große italienische Journalistin Franca Magnani über die anscheinend unausrottbaren Vorurteile: „Die Klischees, diese von uns so sehr bekämpften und verpönten, haben sich weitgehend bestätigt.“ Die Klischees kommen von weither, in der ersten Auflage des Meyer-Lexikons von 1846 konnte man gar nachlesen: „Der Deutsche und der Italiener divergieren in ihrem Charakter so sehr, dass beide gleichsam die Pole der westeuropäischen Menschheit bilden.“ Klischees sind dazu da, dass man sie überwindet. Aus der langjährigen Erfahrung einer Ehe mit einer Italienerin weiß ich, dass es durchaus eine Anziehungskraft zwischen diesen Polen gibt. Und was kann schöner sein, als sich im Februar darüber zu streiten, ob man ein Eis essen soll oder nicht?
Liebhaberinnen und Liebhabern Italiens wurde es vom Land selbst nicht immer leicht gemacht. Man kann sich noch gut an die Jahre zwischen 1994 und 2014 erinnern, als der reiche Mailänder Medienmogul Silvio Berlusconi und rechtsliberale Mitläufer das kulturpolitische Klima des Landes prägten. Politik wurde zum Marketing, und Gesetzesvorhaben wurden wie Produkte beworben. Im Mittelpunkt stand eine bunte Waren- und Traumwelt, in der sich Fiktion und Realität kaum noch voneinander unterschieden. Berlusconi verhielt sich wie ein Polit-Popstar, mischte Privatleben mit dem öffentlichen, prächtige Villen und schöne Escorts eingeschlossen.
Deutsche Medien reagierten entsetzt: „Italien, was hast du bloß aus dir gemacht“, lautete 2008 eine Schlagzeile. Der Staat würde am Boden liegen, Korruption die Institutionen durchziehen und die Wirtschaft vor dem Kollaps stehen. „Stinkstiefel“ nannten die Zeitungen ein Land, das seine Kunstschätze verkommen ließ und die schönsten Landschaften mit Beton zuschüttete.
Im Frust trennten sich viele enttäuschte Italienliebhaber wortreich von ihrer Geliebten nach dem Motto: Du bist nicht mehr die, die ich einst gekannt habe. Der Maler Markus Lüpertz sagte es 2005 in einer Rede zum 100. Jahrestag der Gründung der Villa Romana, der deutschen Künstlervilla in Florenz, so: „Aus dem Zwang, dieses Land zu begreifen, suchen wir es heim und belästigen es mit Liebe.“ Die gleichsam logische Folge: Italien wehrte sich und machte sich unbeliebt.
Gott sei Dank haben sich inzwischen die Wogen wieder etwas geglättet. Italien, das sind großartige Landschaftsbilder von den Alpen bis nach Sizilien und Sardinien, die Reisende auf der Suche nach einem milden Klima seit jeher angezogen haben. Städte der unterschiedlichsten Art bewahren Geschichte und Kultur. Hier haben die Künste ein ideales Umfeld gefunden, sind Musik und Malerei gewachsen, Literatur und Film, Mode und Design. Italien, das ist schließlich auch die Kunst zu leben – bei Tisch, im Gespräch und auf der Piazza. Man kann über 150 Jahre nach Gründung der staatlichen Einheit südlich der Alpen stolz sein auf ein Land, das – gegenwärtigen Widrigkeiten zum Trotz – wie kaum ein anderes in Europa bis in den Alltag hinein Ausdruck einer jahrtausendealten Kultur ist.
„Hallo zusammen.“ Kein Wunder, dass eine der ersten Botschaften von E. und F. ein Foto von einem prächtigen Eisbecher in einem Straßencafé in Syrakus zeigt, mit dem begeisterten Kommentar von F. darunter: „Den kann ich euch leider nicht mitbringen. ›Coppa Aretusa‹, nach der Nymphe benannt, die hier in eine Quelle verwandelt wurde.“ Und er fügt hinzu: „Sozusagen ein mythisches Eis.“ E. hat natürlich Johann Gottfried Seumes „Spaziergang nach Syrakus“ dabei und zitiert: „Diese Quelle ist, wenn man auch mit keiner Sylbe an die alte Fabel denkt, bis heute noch eine der schönsten und sonderbarsten, die es vielleicht giebt.“ Zusammen hatten E. und F. zuvor in der Barockkirche Santa Lucia alla Badia das Altarbild von Caravaggio bewundert, welches das Begräbnis der heiligen Lucia zeigt. „Irre!“, schreibt E., „Im Vordergrund zwei große verdreckte, halb nackte Arbeiter, die das Grab schaufeln, klein im Hintergrund die feine Gesellschaft. Caravaggio malte das Bild nach seiner Flucht aus Malta, wo er zum Tode verurteilt worden war. Zum Fotografieren leider zu dunkel, Blitzen war nicht erlaubt. Aber sucht mal im Internet. Es lohnt sich!“ Als Foto zeigt sie dagegen vor sich hin kokelnde Müllreste an einer Straßenecke: „Südliche Düfte.“
Als im August des Jahres 1920 bei den Olympischen Spielen von Antwerpen die italienische Nationalhymne gespielt werden sollte, fehlten die Noten. Der Dirigent zögerte einen Augenblick und ließ dann eine Melodie spielen, die seine Musiker auswendig konnten: „O sole mio“. Das neapolitanische Volkslied war da gerade dank der Interpretation von Enrico Caruso auf dem neuen Massenmedium Schallplatte zu einem Weltschlager geworden. Die Geschichte dieses Liedes ist verbunden mit vielen solcher Geschichten, die von Elvis Presley („It’s now or never“) über Juri Gagarin (der das Lied zum ersten Mal im Weltraum sang) bis zu Papst Johannes Paul II. reichen. Der Song ist sprachlich so unbedarft („Meine Sonne/leuchtet aus deinem Gesicht!“), wie seine Melodie eingängig ist.
Aber geradezu tragisch ist das Schicksal seiner Autoren. Der Komponist Eduardo Di Capua, der „O sole mio“ vermutlich 1898 nicht in Neapel, sondern während eines Tourneeaufenthalts in Odessa in Noten setzte, starb verarmt 1917. Auch der Texter Giovanni Capurro erlebte den Welterfolg seiner Verse nicht mehr. Und spätestens dann wäre er vor Gram gestorben, denn ein neapolitanischer Musikverleger hatte sowohl Texter als auch Komponisten um ihre Autorenrechte betrogen. Singen steht in Neapel für alle Nuancen zwischen Lachen und Weinen. So hat es jedenfalls der deutsche Komponist Hans Werner Henze (1926–2012) einmal ausgedrückt, der den größten Teil seines Lebens südlich der Alpen verbrachte.
In Italien steht der regionale, sogar der lokale Bezug vor dem nationalen, der individuelle vor dem kollektiven. Italien ist historisch gesehen „ein Land mit hundert Städten und tausend Türmen“. Als zwischen 1860 und 1870 in der Nationalbewegung des Risorgimento politisch ein Einheitsstaat entstand, wurde die Losung ausgegeben: „Wir haben Italien geschaffen, jetzt geht es darum, die Italiener zu schaffen.“ Das scheint bis heute noch nicht ganz gelungen. Neapolitaner gelten als lebhaft, skeptisch und trotz der großen sozialen Probleme meist guter Laune. Die Sizilianer, so hört man, seien verschlossen und pessimistisch, die Lombarden geschäftstüchtig, die Piemontesen fleißig, die Ligurer sparsam, die Toskaner gewitzt, die Römer herzlich, aber plump – warum sollten sie „italienisch“ werden?
Sie werden es vor allem immer dann, wenn sie sich von außen be- oder gar verurteilt fühlen. Dann schmettern auch die azzurri, die Spieler der Fußballnationalmannschaft, den Refrain der Nationalhymne „Fratelli d’Italia“ („Brüder Italiens“) mit einer Inbrunst, die man bei den deutschen Nationalspielern wirklich nicht ausmachen kann: „Lasst uns die Reihen schließen,/Wir sind bereit zum Tod,/Italien hat gerufen!/Lasst uns die Reihen schließen,/Wir sind bereit zum Tod,/Italien hat gerufen! Ja!“ Den Text schrieb Goffredo Mameli aus Genua 1847. Mit den Noten von Michele Novaro wurde „Il canto degli italiani“ nach dem Zweiten Weltkrieg provisorisch zur Nationalhymne erklärt, nachdem das Lied im Faschismus verboten gewesen war, offiziell machte es aber erst ein Gesetz von 2017 dazu.
Italienisch an Italienerinnen und Italienern, so habe ich gelernt, ist das Bedürfnis, bella figura zu machen. Nun wollen auch wir Nichtitaliener bella figura, also einen guten Eindruck machen. Aber bei den Italienern reicht das tiefer. Ein Turiner Bekannter erzählte mir, wie er an einem Sonntagmorgen eine auto- und menschenleere Straße bei roter Ampel überquerte. Aus den Augenwinkeln sah er noch einen vigile, einen städtischen Polizisten, vorbeigehen, der ihn prompt herbeizitierte. Mein Bekannter verteidigte sich: eine menschenleere Straße, da gebe es doch keinen Grund zu warten. Der Beamte sagte, die Straße sei nicht das Problem, die Ampel auch nicht, aber ob er ihn, den vigile, nicht gesehen habe? Welche figura würde er als Ordnungshüter abgeben, wenn man in seiner Gegenwart die Ordnung nicht ernst nehme? Man sollte also allen Italienerinnen und Italienern, den Ordnungshütern voran, immer die Gelegenheit geben, bella figura zu machen. Sie werden es Ihnen herzlich danken.
„Ich habe eine Einladung zu einer Kulturveranstaltung bekommen, die gut gemeint an einen Asterisk gerichtet war. Ich werde da nicht hingehen, ich bin kein Asterisk.“ So begann ein Artikel des siebzigjährigen Schriftstellers Maurizio Maggiani in der Tageszeitung la Repubblica. Die Sprachdebatte um das richtige Gendern hatte spätestens im Sommer 2021 auch Italien erreicht. Gelegentlich erhalte auch ich Mails mit „Buongiorno tutt*“ statt der früher üblichen Begrüßung „tutti“ als generisches Maskulinum – was im Italienischen maschile sovraesteso heißt und in diesem Fall die weiblichen „tutte“ mit einschließt. Im Wissenschaftsbereich, vor allem bei Jüngeren, hatte die Benutzung vor allem des Gendersterns, aber auch des e-Schwa-Zeichens (ein auf den Kopf gestelltes e) bereits länger Einzug gehalten. In der breiten Öffentlichkeit hingegen beginnt man erst langsam, sich diesen Fragen zu stellen. Wobei, ähnlich wie im deutschen Sprachraum, in der Bevölkerungsbreite die Ablehnung, zumindest aber die Skepsis gegenüber dieser sprachlichen Bevormundung von oben überwiegt.
Der Verlag effequ aus Florenz hat angefangen, Sachbuchtexte konsequent zu gendern. Die Gemeinde Castelfranco Emilia hat landesweite Aufmerksamkeit gewonnen, weil sie in ihren Facebook-Mitteilungen das e-Schwa-Zeichen benutzt, um alle Beteiligten der LGBT+-Szene ernst zu nehmen und keinen auszuschließen. Sprache spiegelt zweifellos gesellschaftliche Verhältnisse und Machtstrukturen wider, aber kann sie die auch gleichsam von heute auf morgen verändern und Sensibilität verordnen? Spielt da nicht eher der Trend zur Political Correctness eine Rolle?
Ich wohne in Mailand im Lazzaretto-Viertel, das von vielen lebhaften Bars und Restaurants mit Küchen aus Asien, Afrika und Lateinamerika geprägt ist und zugleich als ein Zentrum der Gay Community gilt. In unserer Metrostation „Porta Venezia“ zieren – einmalig in Italien – die Regenbogenfarben als feste Installation im Bahnsteigbereich die Wände. Es ist angenehm, in einem offenen Umfeld zu leben, das sich sensibel für bunte Gesellschaftsstrukturen gibt, was man gemeinhin mit dem teilweise inflationär benutzten Begriff „inklusiv“ bezeichnet.
Weniger wohl fühle ich mich in der Debatte, die aus der Sprache ein politisches Feld macht, in der die unterschiedlichsten Gruppen auf Grundlage ihrer Identität (ethnisch, biologisch, geschlechtliche Orientierung usw.) einen Kampf um Anerkennung führen, während soziale Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten immer weniger problematisiert werden. „Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt“, heißt es sowohl in der italienischen Verfassung als auch im deutschen Grundgesetz. Jeder, auch „jede“ oder „jedes“, soweit er, auch „sie“ oder „es“, nicht die Rechte anderer verletzt. Mir will nicht einleuchten, Sprache mit Sternchen auf der einen Seite inklusiv, auf der anderen Seite aber unaussprechbar zu machen. Wo bleibt denn da die Schönheit der Sprache? Wie betont man einen Asterisk? Auch das deutsche „Italiener*innen“ will mir nicht über die Lippen kommen, wenn ich Italienerinnen und Italiener meine oder einfach nur: Italiener.
Vielleicht ist das wirklich ein Generationsproblem, und ich bin zu alt dafür. Aber ich las vor Kurzem im Corriere della Sera in einem Interview mit der 27-jährigen Giovanna Cristina Vivinetto, die sich selbst eine poetessa trans („Trans-Dichterin“) nennt, dass Freiheit sich nicht aus den Worten ergebe, die einer gebrauche, um vielleicht freier als andere zu erscheinen. Sondern, so schreibt Giovanna (vormals Giovanni): „Es ist nicht die Sprache, die Vorurteile aufbaut, sondern die Vorurteile werden von Personen aufgebaut, die Sprache benutzen. Der Asterisk hilft hier nicht weiter.“ Und so halte ich es auch in diesem Buch: Es geht darum, Vorurteile abzubauen, zwischen den Nationen wie zwischen den Geschlechtern – und das ohne Asterisk.
Italien hat sich rasant verändert, auch in den vergangenen 25 Jahren, seit ich Texte für die erste Ausgabe dieser „Gebrauchsanweisung“ geschrieben habe. Manche Sichtweisen haben sich gewandelt, ich habe viel dazugelernt und weiß doch, wie mir scheint, noch immer nicht genug über dieses alles in allem wundervolle Land. Manchmal fühle ich mich wie ein ewiger Schüler. Einer von denen, die in Lidias kleiner Sprachschule hier in Mailand in der Via Ponte Vetero gegenüber der zauberhaften Piazza del Carmine einen Grundkurs belegen. Da lernen Manager, Studenten oder Au-pairs nicht nur, Italienisch zu verstehen und zu sprechen, sondern erfahren auch einiges über das Land. Das beginnt mit einfachsten kulturellen Grundregeln (keinen Cappuccino nach dem Essen bestellen) und praktischen Tipps (Briefmarken kauft man nicht in der Post, sondern im tabacchi, dem Tabak-Shop – falls man sie im Zeitalter von WhatsApp überhaupt noch benötigt). Man redet etwa über Verhaltensmaßregeln bei einem Privatbesuch (zum Abschied geht man nach der Ankündigung „Jetzt wollen wir aber gehen“ nicht ruckzuck weg wie nördlich der Alpen, sondern hält sich auch im Stehen noch eine geraume Zeit plaudernd bei den Gastgebern auf).
Vor allem kommen Lidia und ihre Kollegen aber auf aktuelle gesellschaftliche Fragen zu sprechen. Was eben in Politik und Öffentlichkeit gerade so diskutiert wird. Zum Beispiel ob hierzulande geborene Kinder von Migranten einen Anspruch auf die italienische Staatsbürgerschaft haben. Ob geschlechterfeindliches Verhalten (auch Reden) unter Strafe gestellt werden soll. Oder man diskutiert über die Rolle der Frauen. Frauen treten in Italien selbstbewusst in der Öffentlichkeit auf, sind aber in Politik und Wirtschaft total unterrepräsentiert. Als der italienische Staat vor 150 Jahren gegründet wurde, waren gerade mal 2,2 Prozent der Gesamtbevölkerung wahlberechtigt. Ab 1912 durften alle männlichen Personen über 21 Jahren an Abstimmungen teilhaben. Das allgemeine Wahlrecht für Frauen wurde erst 1946 im republikanischen Italien eingeführt (in Deutschland bereits 1919).
Von der ersten Stunde an kommen die Schülerinnen und Schüler mit eigenen Beobachtungen und Fragen zu Wort. Zum Beispiel wollen sie wissen, warum die meisten italienischen Restaurants und Pizzerien nicht durchgehend geöffnet haben und zwischen 15 und 19 Uhr geschlossen sind, wohingegen viele fremdländische Restaurants durchgehend geöffnet bleiben. Je nachdem, woher sie kommen, wird das Leben in Mailand beispielsweise als „chaotisch“ (etwa von vielen Deutschen) empfunden oder auch als „absolut ruhig und normal“ (etwa von den meisten Brasilianern). Manchmal tauchen bereits im Vorfeld merkwürdige Anfragen auf. Kürzlich fragte ein Deutscher, ob es im Land auch 220 Volt Wechselstrom gebe, denn er habe leider keinen Laptop mit Gleichstromanschluss. Oder ob man in der Schule auch die lateinischen Schriftzeichen benutzen würde, lautete eine andere Anfrage, ebenfalls aus Deutschland. „Wir schreiben doch nicht mit Hieroglyphen! Denken die, wir leben hier auf dem Mond?“, schnaubte Lidia wütend, als sie mir die beiden Mails mit den besorgten Nachfragen zeigte. „Das sind deine Landsleute!“ Aber natürlich hat sie die Anfragen dann aufs Allerhöflichste beantwortet.
Halten wir uns lieber an die Tatsachen. In Italien leben rund 60 Millionen Menschen. Wenn die gegenwärtige Geburtenrate konstant niedrig bleibt, werden es im Jahr 2050 nur noch 46 Millionen sein. Zurzeit sind im Land offiziell rund 5 Millionen Ausländer mit einer Aufenthaltserlaubnis registriert (davon 1,4 Millionen aus europäischen Staaten), die meisten (22 Prozent) leben in der Lombardei. Wie viele es inoffiziell sind, weiß man nicht. Die Arbeitslosenquote betrug Anfang 2021 10,3 Prozent (in Süditalien übersteigt die Jugendarbeitslosigkeit besonders bei Frauen dramatisch die 40-Prozent-Marke). Pro Woche wird durchschnittlich 35 Stunden gearbeitet – in Deutschland 30, Frankreich 32 und Großbritannien 36. Die größten Städte (Metropolräume eingeschlossen, Stand 2021) sind Rom, die Hauptstadt, mit 4,22 Millionen Einwohnern, Mailand mit 3,25 Millionen, Neapel mit 3,01 Millionen und Turin mit 2,21 Millionen.
Die etwa dreißig Millionen Hektar große Landesfläche (kleiner als Deutschland und auch als Polen) setzt sich zu drei etwa gleich großen Teilen aus Berglandschaft, Hügeln und Ebene zusammen. Die Luftlinie zwischen nördlichstem und südlichstem Punkt misst 1177 Kilometer (in Deutschland 832 Kilometer), die Autobahnstrecke zwischen Brenner und Reggio Calabria ist 1450 Kilometer lang. Die Halbinsel ist relativ schmal (Breite bis zu 244 Kilometer) und wird von 8600 Kilometer Küste (Inseln eingeschlossen) geprägt. Dazu zählen auch die Strände, an denen wir so gerne in der Sonne liegen und faulenzen. Oder abgelegene Ufer, an denen Flüchtlinge aus ärmeren Weltgegenden Zugang zum reichen Europa suchen.
Geopolitisch ist das Land in 20 Regionen, 82 Provinzen und 14 Metropolstädte aufgeteilt, wobei den Provinzen zugunsten der Regionen beziehungsweise der Metropolstädte viele Kompetenzen entzogen wurden. Die Regionen im Norden haben einen höheren Lebensstandard (über dem EU-Durchschnitt) als die im Süden (unter dem EU-Durchschnitt). Der Nord-Süd-Gegensatz, der die Geschichte und Entwicklung des Landes seit dem Risorgimento prägt, ist nicht leicht zu fassen. Denn allein der nördliche Landesteil bildet bereits keine homogene Gemeinschaft. Manchmal zählt man die Region Emilia-Romagna hinzu, manchmal nicht. Landeskundler und Soziologen trennen außerdem zwischen dem Nordwesten (Piemont/Ligurien/Lombardei) und dem Nordosten (Südtirol/Trentino/Venetien/Friaul), die jeweils ganz unterschiedliche Traditionen haben. Auch das Piemont und die Lombardei sind sich nicht grün. Nirgendwo werde ich so oft gefragt, ob man denn in dem schrecklichen Mailand überhaupt leben könne, wie in Turin.
Wie verhält es sich mit dem Süden? Wenn man nur an die Eigenarten der Städte Neapel, Bari oder Palermo denkt, an Landschaften und Mentalitäten an der kalabresischen Stiefelspitze oder in der sardischen Barbagia, wird deutlich, dass es viele, ganz unterschiedliche „Süden“ gibt. Hier liegt einer der wichtigsten Schlüssel zum Verständnis von Italien: die Vielseitigkeit und Gegensätzlichkeit, wobei Modernes und Traditionelles nebeneinander existieren und jedes Chaos seine Ordnung hat. Man hüte sich also vor Verallgemeinerungen.
Und noch ein paar Kuriosa: Italien ist in Europa der größte Produzent von Bioprodukten und nach Deutschland der zweitgrößte Konsument. In Italien sind mehr Autos (663) auf tausend Einwohner zugelassen als in Deutschland (574), Österreich (562) oder der Schweiz (537) – EU-Durchschnitt: 540. Es wachsen auf italienischem Boden im Durchschnitt mehr Wälder als in Irland, Belgien, Holland oder Dänemark. Es soll 57 Millionen Mäuse, 20 Millionen Spatzen und 10 Millionen Igel geben. Die älteste Osteria („Al Brindisi“) hat in Ferrara seit 1435 geöffnet. Das Thermometer fällt niemals unter null Grad in Taormina, Anacapri, Amalfi und Sanremo.
Der Zug setzt sich langsam in Bewegung. Er wird schneller, immer schneller, die letzten Häuser Roms verschwinden unter einem azurblauen Himmel, die Campagna Romana rauscht vorbei. War das nicht eben ein antikes Viadukt? Aber schon tauchen wir in einen Tunnel ein. Auf wilde, gleichsam unberührte Natur folgt die Gartenlandschaft Kampaniens. Wieder ein Tunnel. Wo sind eigentlich die Bucht von Gaeta und das Meer geblieben, die man früher vom Zug aus sehen konnte?
Auf dem Display über der Gangtür kann man lesen, wie sich die Reisegeschwindigkeit auf dieser Strecke nach Neapel immer weiter steigert und schließlich 300 Kilometer pro Stunde erreicht. Der Frecciarossa hält dann siebzig Minuten nach der Abfahrt in Rom am Bahnhof Napoli Centrale. Der Privatzug Italo, die Konkurrenz zur staatlichen Trenitalia, schafft es sogar in 68 Minuten. Dieselbe Strecke habe ich bei meiner ersten Zugfahrt von Rom nach Neapel in den 1970er-Jahren noch in gemütlichen zweieinhalb Stunden zurückgelegt und dabei mehr von der Landschaft gesehen.
„Das Italien unserer Ahnen ist, wie man weiß, seit die Eisenbahnen es für den Verkehr erschlossen haben, eines der unbekanntesten Länder Europas geworden.“ Der Schriftsteller und Privatgelehrte Rudolf Borchardt beginnt so, gleichsam widersinnig, den im Jahr 1907 veröffentlichten Aufsatz „Villa“. 1907! Was würde er denn 2022 nach einer Fahrt im Frecciarossa schreiben? Aber es stimmt, wir rauschen bei unseren Reisen oft von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten, um in der kostbaren Zeit, die uns zur Verfügung steht, möglichst viel zu sehen und zu verstehen. Was können wir jedoch bei dieser Eile überhaupt verstehen? Sehen wir dann nicht nur das, was in den Reiseführern steht? Aber keine Sorge: Jeder sollte heute durch Italien reisen, wie es ihm Lust und Neugier auftragen, Geldbeutel und Zeitrahmen gestatten. Im Hochgeschwindigkeits- oder im Bummelzug, beim Wandern, im Auto oder mit dem Fahrrad.
„Es gibt nichts Langweiligeres auf dieser Erde, als die Lektüre einer italienischen Reisebeschreibung – außer etwa das Schreiben derselben“, behauptete Heinrich Heine. Zumindest den Nachsatz kann ich nicht bestätigen. Mir hat die Arbeit an der „Gebrauchsanweisung für Italien“ Spaß gemacht, und ich habe dabei viel gelernt. Sicher: Ich habe sie nicht für die Fachleute geschrieben, die alles wissen. Sondern für Liebhaber und Neuankömmlinge, die neugierig sind auf dieses Land und seine Menschen. Dieser Band möchte mit Informationen und Beschreibungen den Dialog erleichtern und Vorurteile abbauen. Als Journalist in Italien hatte ich Gelegenheit, viele Menschen zu hören, die mir etwas über das Land und seine Leute erzählt haben, Tatsachen und Geschichten. Ihnen allen und den Autorinnen und Autoren der Bücher, aus denen ich Informationen und Anregungen schöpfen konnte, sei Dank.
Zu diesen Büchern gehört auch die Geschichte über den Handelsreisenden Bianchi, Vertreter einer pharmazeutischen Firma aus Varese, der berufsmäßig die Halbinsel kreuz und quer bereist. Abends jedoch ruft er zu Hause an, um seiner kleinen Tochter, die sonst nicht einschlafen kann, eine kurze, oft ganz kurze Gutenachtgeschichte zu erzählen.
Die Figur des Signor Bianchi und diese „Favole al telefono“ (auf Deutsch: „Das fabelhafte Telefon“) hatte sich der Pädagoge und Kinderbuchautor Gianni Rodari (1920–1980) ausgedacht. Darunter die Fabel von den „Affen auf Reisen“, die davon erzählt, wie die Affen im Zoo eines Tages beschließen, eine Bildungsreise zu unternehmen. Nachdem sie eine Weile gegangen sind, bleiben sie stehen, und einer fragt, was es zu sehen gebe. „Löwenkäfig, Seehundbecken und Giraffenhaus.“ Und die Affen kommentieren: „Wie groß ist die Welt und wie viel lernt man auf Reisen.“ Sie gehen weiter und sehen auch gegen Mittag wieder Löwenkäfig, Seehundbecken und Giraffenhaus und sagen sich, wie seltsam die Welt sei und wie viel man auf Reisen lerne. Als es am Abend wieder Löwenkäfig, Seehundbecken und Giraffenhaus zu sehen gibt, gestehen sie sich ein, die Welt sei langweilig und Reisen nütze wirklich nichts. „So reisten und reisten sie, waren aber nie aus ihrem Käfig herausgekommen.“
Allen Reisenden also offene Grenzen und der Neugierde ein freies Feld! Buon viaggio!
Henning Klüver
Mailand, im Januar 2022
»Italien hat sich rasant verändert, auch in den vergangenen 25 Jahren, seit ich Texte für die erste Ausgabe dieser „Gebrauchsanweisung“ geschrieben habe. Manche Sichtweisen haben sich gewandelt, ich habe viel dazugelernt und weiß doch, wie mir scheint, noch immer nicht genug über dieses alles in allem wundervolle Land.
„Es gibt nichts Langweiligeres auf dieser Erde, als die Lektüre einer italienischen Reisebeschreibung – außer etwa das Schreiben derselben“, behauptete Heinrich Heine. Zumindest den Nachsatz kann ich nicht bestätigen. Mir hat die Arbeit an der „Gebrauchsanweisung für Italien“ Spaß gemacht, und ich habe dabei viel gelernt.
Sicher: Ich habe sie nicht für die Fachleute geschrieben, die alles wissen. Sondern für Liebhaber und Neuankömmlinge, die neugierig sind auf dieses Land und seine Menschen. Dieser Band möchte mit Informationen und Beschreibungen den Dialog erleichtern und Vorurteile abbauen. Als Journalist in Italien hatte ich Gelegenheit, viele Menschen zu hören, die mir etwas über das Land und seine Leute erzählt haben, Tatsachen und Geschichten.« Henning Klüver
„Klüver schreibt als Journalist ebenso über Politik wie über Kultur – beste Voraussetzungen für einen ebenso liebevollen wie kritischen Blick auf seine Wahlheimat.“
„Eine wunderschöne Liebeserklärung an das Land, wo die Zitronen blühen.“
„Mit leichter Hand findet der Autor Antworten auf die Frage, warum wir dieses Land so sehr ins Herz geschlossen haben.“
„Silvio, lass gut sein! Henning Klüver bringt uns das fremd gewordene Italien wieder näher. (...) Was auch immer nach den Parlamentswahlen am 25. Februar geschehen wird, Klüvers Buch ist schon jetzt eine wunderbar wohlschmeckende geistige Vorbeugung gegen kommende anti-italienische Ressentiment-Viren.“













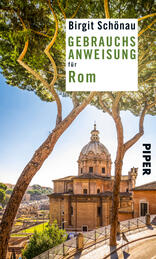
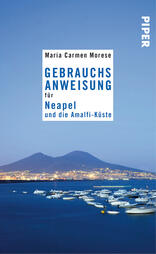



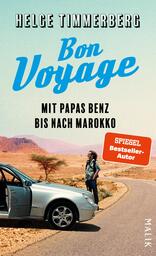






An Reisebüchern, Kunstbänden, Geschichtsdokumentationen über Italien mangelt es im deutschsprachgigen Raum wirklich nicht. Aber bei allen Veröffentlichungen von Henning Klüver spürt man immer wie sich hier ein kompetentes Wissen über seine Wahlheimat und seine Passion für dieses Land - trotz aller Kritik - verbinden. Er kennt wirklich alle Ecken des Landes auch jenseits der Toskana, jenseits von Venedig, Rom und Sizilien. Man kann seinem Urteil vertrauen. Carl Wilhelm Macke ( München - Ferrara )
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.