
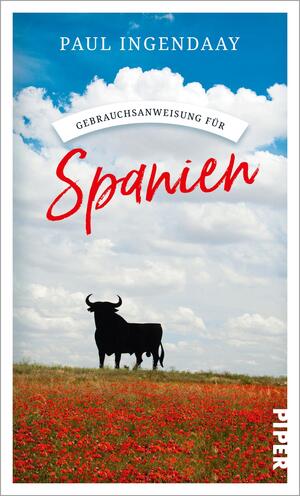
Gebrauchsanweisung für Spanien Gebrauchsanweisung für Spanien - eBook-Ausgabe
„Ingendaays Buch über Spanien gibt einen gut recherchierten Einblick in die südeuropäische Seele.“ - StadtRadio Göttingen „Book´s n´ Rock´s“
Gebrauchsanweisung für Spanien — Inhalt
Die Katalanen, die Basken oder die Kastilier – sie alle sind das wahre Spanien. Es spricht vier Sprachen und besitzt mehr als nur eine Mentalität. Spanien-Experte Paul Ingendaay blickt genau hin, von Granada bis Galicien und zu den Kanaren. Er erzählt von Aberglauben und Improvisation, von der kuriosen Notwendigkeit zu heiraten und von escapadas als Volkssport; vom Königshaus und dem tief verwurzelten Wunsch aller Spanier:innen, Hausbesitzer zu werden. Er lässt den Reichtum dieses facettenreichen großen Landes zwischen Charme und Anarchie, Bikini und Ballermann, Kulinarik und Kultur erstehen.
Der Autor, Spanienexperte und ehemaliger FAZ-Korrespondent, lebte lange in Madrid. Über seine Wahlheimat Spanien schreibt er mit „funkelndem Humor und leidenschaftlicher Sympathie“. Ruhr-Nachrichten
Leseprobe zu „Gebrauchsanweisung für Spanien“
Der Outdoor-Typ
Dieses Buch handelt von Verwunderungen und Verzauberungen, von Rätseln und Klischees. Alle vier sind sich über Jahrzehnte hinweg erstaunlich gleich geblieben. Nur das Land, auf das sie sich beziehen, Spanien, hat sich stark verändert. Wie kann es sein, dass manche Dinge sich wandeln, andere dagegen ewig währen?
Als ich in den Neunzigerjahren des letzten Jahrhunderts damit begann, Spanien aus der Nähe zu beobachten, lag die Franco-Diktatur noch keine 25 Jahre zurück. Wir alle wissen inzwischen, was das bedeutet. Historisch gesehen, [...]
Der Outdoor-Typ
Dieses Buch handelt von Verwunderungen und Verzauberungen, von Rätseln und Klischees. Alle vier sind sich über Jahrzehnte hinweg erstaunlich gleich geblieben. Nur das Land, auf das sie sich beziehen, Spanien, hat sich stark verändert. Wie kann es sein, dass manche Dinge sich wandeln, andere dagegen ewig währen?
Als ich in den Neunzigerjahren des letzten Jahrhunderts damit begann, Spanien aus der Nähe zu beobachten, lag die Franco-Diktatur noch keine 25 Jahre zurück. Wir alle wissen inzwischen, was das bedeutet. Historisch gesehen, schrumpft ein Vierteljahrhundert auf ein Nichts zusammen, wenn es um das Überdauern von Vorurteilen und Stereotypen geht. Unsere eigene Geschichte und der mehr als dreißigjährige Abstand zum Mauerfall sind dafür das beste Beispiel.
Äußerlich also hat sich in Spanien eine Menge getan: Das Land hat ein autoritäres Regime hinter sich gelassen, demokratische Institutionen aufgebaut und – mit leichter Verzögerung gegenüber Ländern wie Deutschland oder Frankreich – einen ähnlichen gesellschaftlichen Wandel durchlaufen wie seine Nachbarn. Es wurde zum respektierten EU-Mitglied, fand im Tourismus die Säule seines Wohlstands und schaffte es in zwei außerordentlichen Jahren sogar, alle Fußballklischees zu besiegen und sowohl Welt- als auch Europameister zu werden.
Spanien hatte aber auch Rückschläge zu verkraften, die hier drastischere Formen annahmen als anderswo. 2004 zeigten die islamistischen Terrorattentate von Madrid, die 191 Menschenleben forderten, dass der Dschihadismus in einer völlig neuen Dimension in Europa angekommen war. Die Finanzkrise von 2008, die in Spanien eine tiefgreifende, alle bestehenden Strukturen mitreißende Immobilienkrise war, warf ein Land, das allmählich zu den wohlhabenden Nationen Westeuropas aufschloss, um Jahre zurück. Gut zehn Jahre später schlug die Corona-Pandemie in Madrid und Barcelona, ähnlich wie in Italien, viel stärker zu als im nördlichen Europa.
Krisen dieser Art bringen viel in Bewegung. 2011 etwa entstand auf der Puerta del Sol, im Herzen der Hauptstadt Madrid, ein Dorf des sozialen Protests, das weltweit Aufmerksamkeit erregte. Kurz darauf wurde mit Podemos eine neue Partei gegründet, die das soziale Bewusstsein der „Empörten“ in die Politik trug und die spanische Parteienlandschaft für immer veränderte. Abermals wenige Jahre später trat ein gealterter, von persönlichen Pannen und Misserfolgen gezeichneter König Juan Carlos I. zurück und überließ das Ruder der Monarchie seinem Sohn Felipe. Und irgendwann gab es auch in Spanien mit Vox das, was andere europäische Länder, Deutschland eingeschlossen, schon längst hatten: eine populistische rechte Partei, die den gesammelten Unmut über die Globalisierung in simple Formeln presste.
Unterdessen hatte es mehrere – mit großer Komik gescheiterte – Versuche gegeben, die spanische Nationalhymne mit einem Text zu versehen. Sie hat nämlich keinen, und zwar deshalb nicht, weil sie ein Marsch ist, den man trommeln und blasen, aber nicht singen kann. Hat das wirklich etwas zu bedeuten? Ich glaube, ja. Spanien ist nämlich ein zentralistisch organisierter Nationalstaat mit äußerst unruhigen Rändern. Fast ein halbes Jahrhundert lang hatte die baskische Terrorgruppe ETA gemordet, bis sie den Kampf aufgab. An ihre Stelle traten katalanische Nationalisten, die die staatliche Ordnung ohne Waffengewalt aus den Angeln zu heben versuchten und sehr weit damit kamen.
Die meisten dieser Phänomene schienen aus dem Nichts entstanden zu sein. Zugleich sagen sie etwas über die neuen, extrem volatilen Zeiten im spanischen Krisenmodus aus. In Wahrheit, so glaube ich, hängen sie untergründig miteinander zusammen, und deshalb wird von ihnen auch in diesem Buch die Rede sein. Allein schon am Schicksal des früheren Monarchen lassen sich die erdrutschartigen Veränderungen nachzeichnen, die das moderne Spanien prägen.
Als Juan Carlos I. nach Francos Tod 1975 den Thron bestieg und damit einen sechs Jahre zuvor geschlossenen Pakt über das politische Fortleben des Regimes erfüllte, waren die Erwartungen an ihn minimal. Der in Italien geborene, unter Francos Aufsicht erzogene Thronfolger schien eine Marionette zu sein, zu schwach, um gegen die Militärs der alten Garde auf der einen und die Opposition der Franco-Gegner auf der anderen Seite bestehen zu können.
Doch der achtunddreißigjährige Monarch erwies sich als Stratege mit verblüffendem Weitblick. Bei der Ernennung des ersten Ministerpräsidenten ignorierte er die Großperücken des alten Staates, indem er sich mit Adolfo Suárez für einen jungen Politiker der „Bewegung“ statt für einen der wartenden Betonköpfe entschied. Im Tandem rangen der König und Suárez der Rechten wichtige Zugeständnisse ab, darunter die Wiederzulassung der Kommunistischen Partei, und trieben die Demokratisierung des Landes voran. Doch sie hüteten sich davor, zu weit zu gehen: Ein Militärputsch schien immer möglich.
Der Schriftsteller Javier Cercas hat diesen meisterhaften Balanceakt in seinem Buch Anatomie eines Augenblicks über den Militärputsch von 1981 literarisch verewigt. Seine beeindruckende Geschichtserzählung legt die Triebkräfte der transición frei, die es Spanien ermöglichten, über ideologische Abgründe hinweg eine moderne Demokratie zu werden.
Diese historische Leistung hat sich in den Jahrzehnten darauf zu einer Legende für die Geschichtsbücher verdichtet. Die Jahre unmittelbar nach Francos Tod waren für die Beteiligten jedoch hart umkämpft, voller Konflikte, wirtschaftlicher Sorgen und Zukunftsangst. Der Journalist und Autor Juan Antonio Tirado hat die Spanier nach einem Gang in die Pressearchive noch einmal daran erinnert. In seinem Buch Siete caras de la Transición (Sieben Gesichter des Übergangs) belegt er, dass selbst denkfähige liberale Medien wie El País den Reformkurs von Suárez fünf Jahre lang mit Häme und Ablehnung begleiteten. Ein volles Jahr nach Suárez’ Ernennung durch König Juan Carlos schrieb das Blatt: „Die Annahme, der gegenwärtige Präsident könne den Demokratisierungsprozess unseres Landes anführen, wäre genauso absurd wie die Aussage, Goebbels hätte nach Hitlers Tod die Demokratie wiederhergestellt.“
Spaniens progressivste Zeitung hatte also noch nicht mitbekommen, wohin die Reise ging. Fast ein weiteres Jahr später, am 4. März 1978, klagte der junge Juan Luis Cebrián, der in den Jahrzehnten darauf zum mächtigsten Medienmanager des Landes aufsteigen sollte, weit und breit sei in Spanien „kein Staatsmann“ zu sehen. Man lernt daraus: Die Zeitgenossen großer Ereignisse sind oft ahnungslos. Die später glorifizierte transición war, während sie ablief, ein unbegriffener Prozess, der von schrillen Tönen und zahllosen Fehleinschätzungen begleitet wurde.
Was König Juan Carlos I. betrifft, so hat ihn die neuere Generation von Spaniern nur noch als alten Mann erlebt. Sie kennt nicht den geschickten Instinktherrscher von damals, sondern lediglich jenen Monarchen ohne rechte Aufgabe, ohne Selbstdisziplin, der seinen Freiraum für die entsprechenden Skandale nutzt, darunter 2012 eine unselige Elefantenjagd, die ihn sein Renommee kostete. Meine persönliche Theorie ist, dass Juan Carlos sich in der langen Phase zunehmenden spanischen Wohlstands – sagen wir, zwischen Spaniens NATO-Eintritt 1982 und dem Abenteuer in Botswana dreißig Jahre später – einfach ein wenig gelangweilt hat. Auch Könige sind Menschen.
Ich habe auch Verständnis dafür, dass Juan Carlos I. nicht als Regent der Kultur und der schönen Künste in Erinnerung bleiben wird, sondern als Outdoor-Typ, der sich dort wohlfühlte, wo Männer sich mit Männersachen beschäftigen: Segeln, Schießen, Skilaufen, Fußball. Gut Essen und Trinken. Lachen und lustig sein. Ich gebe hier keine Indiskretionen preis, wenn ich außerdem anmerke, dass die Interessen des Königs und der Königin nicht zu allen Stunden des Tages und der Nacht vollständig zur Deckung kamen. Und doch blieb er, allen Tolpatschigkeiten und wirklich unglücklichen Knochenbrüchen zum Trotz, auf wundersame Weise der „König aller Spanier“.
Was bekommen Fremde von solchen Veränderungen mit? Sehr viel, wenn sie mit wachen Sinnen im Land leben und neugierig sind. Gerade der innere Abstand erlaubt ja dem Ausländer manchmal zu erkennen, was den Einheimischen nicht mehr auffällt. Es entsteht ein Verständnis, und was sich verstehen lässt, lässt sich auch mögen. Restlos erklärbar sind Spanien und die Spanier ohnehin nicht. Im Zweifelsfall habe ich eher Geschichten vertraut als stolzen Theorien.
Für eine Eigenschaft, die die Spanier sich selbst zuschreiben, den Neid, fand sich in diesem Buch nirgendwo ein Platz. Daher erwähne ich sie jetzt. Viele Spanier meinen, der Neid, la envidia, sei ein hervorstechendes Merkmal ihres Charakters. Ich bin froh darüber, dass ich das nicht bestätigen kann. Wobei es mir allerdings zu denken gibt, dass die spanische Sprache zwischen gewöhnlichem Neid, envidia, und gesundem Neid, envidia sana, unterscheidet. Die erste Form bedeutet, dass man einem Menschen wirklich etwas neidet (und wegnehmen will), die zweite, dass man jemanden um etwas beneidet, das man ihm aber gönnt. Jetzt würde mich interessieren, auf welche kollektive Schwäche die Deutschen sich einigen könnten?
Viel mehr als vom Neid handelt dieses Buch von der spanischen Großzügigkeit, la generosidad. Niemand wird empirisch ermitteln können, ob Großzügigkeit wirklich der markanteste Zug des spanischen Gemüts und der spanischen Lebensart ist. Aber es steht außer Frage, dass Reisende der letzten zweihundert Jahre, aus welcher Kultur sie auch kommen mochten, von der Geberlaune der Einheimischen beeindruckt waren und sie beschrieben haben. Der amerikanische Schriftsteller William Gaddis, in dessen Roman Die Fälschung der Welt das Land tiefe Spuren hinterlassen hat, nannte diese Eigenschaft generosity of spirit, womit Geist, Gesinnung und Charakter gemeint waren. Die Formulierung ist nicht zu übertreffen. Sie enthält das Materielle und das Immaterielle, die Gesten der Gastlichkeit ebenso wie die Fähigkeit, sich die Nöte des anderen zu eigen zu machen, zu geben, zu teilen und über alldem die Zeit zu vergessen. Hinter der spanischen Großzügigkeit steht kein Kalkül.
Stellen wir uns eine junge Frau in Deutschland vor, die ein Ersatzteil für ihre Vespa braucht, sagen wir, ein Vorderlicht. Es handelt sich um ein älteres Modell, wie es heute nicht mehr hergestellt wird. Die junge Frau fährt mit ihrem Motorroller zur Vespa-Werkstatt, und der Händler sagt ihr: Nein, ein solches Licht führe er nicht, das kaufe niemand mehr. Wenn die junge Frau dem Händler nun antwortet, er solle bitte schön in seinem Lager nachschauen, ob er das Vorderlicht vielleicht nicht doch irgendwo …? „Hören Sie“, entgegnet der Händler gereizt, „ich kenne doch mein Lager!“ Die junge Frau nickt und zieht von dannen. Sie bezweifelt nicht, dass der Händler sein Lager kennt. Es ist ein deutscher Händler.
Dieselbe junge Frau sucht ihr Ersatzteil in Spanien, sagen wir, in Madrid. Sie fährt mit ihrer Vespa zur Werkstatt und erkundigt sich. José, so nennen wir den jungen Mann im Hof, zuckt ratlos die Achseln. Er ruft Ramón, der hinzutritt und anerkennend die junge Frau und die schöne alte Vespa mustert. Dann schüttelt Ramón den Kopf. Er pfeift durch die Zähne, und Paco taucht auf. Aber auch Paco, der die Vespa ebenfalls bewundert, kann sich nicht erinnern, ein solches Vorderlicht – nicht kantig, sondern gerundet – im Lager gesehen zu haben. Man berät, bemitleidet die junge Frau, deren Suche bisher vergeblich war, lobt ihr Spanisch, lobt dann noch einmal die Vespa und ruft schließlich Julio. Und Julio erinnert sich an ein Vorderlicht, eines von den alten, gerundeten, das schon seit Ewigkeiten niemand mehr haben will und das noch irgendwo im Lager herumliegen muss. Drei Minuten später hält er es triumphierend in der Hand, alle lachen, teuer ist das Vorderlicht auch nicht, weil es ja schon fast ausgemustert war.
Die erste Geschichte trägt sich wahrscheinlich täglich in dieser oder einer ähnlichen Form in Deutschland zu. Die zweite hat sich ziemlich genau so abgespielt – in Spanien. Man könnte sich nun fragen, was die vier Leute in der Madrider Werkstatt den ganzen Tag machen. Womöglich ist das Ersatzteillager in so fürchterlichem Zustand, dass man mindestens vier Leute braucht, um das Chaos in den Griff zu bekommen. Oder einer hat einen Freund mitgebracht, der gerade nichts Besseres zu tun hat und ebenso gut in der Werkstatt herumräumen kann wie in seiner Bude. Kurz, der Charme des geschilderten Erlebnisses, der erfolgreichen Suche nach dem Vorderlicht, gründet wahrscheinlich auf einer gewissen Unordnung und Ineffizienz der Lagerhaltung.
Doch wie sehr man an der kleinen Geschichte auch herumdeutet, das Ergebnis bleibt davon unberührt. Die junge Frau mit der Vespa wird aus der Werkstatt nicht nur ein gerundetes Vorderlicht mitnehmen, sondern auch einen sehr guten Eindruck, dem keine spätere Erfahrung mehr etwas anhaben kann. Und das nicht etwa in der Provinz, sondern in der spanischen Hauptstadt. Sie wird die Madrilenen, die Spanier als solche, loben und preisen. Bis sich im Laufe der nächsten Wochen die Frage stellt, ob sie gut beraten ist, ihr schönes altes Gefährt in Madrid überhaupt zu benutzen, denn der Verkehr auf den pockennarbigen Straßen ist lebensgefährlich.
Wer umweltbewusster Vegetarier ist, Fußball verabscheut, aber gern Fahrrad fährt, die Stille liebt und ohne Körnerbrot und reibungsloses Abfall-Recycling nicht leben will, dem kann man Spanien oder jedenfalls große Teile des Landes immer noch nicht ohne Weiteres empfehlen. Wer dagegen Spaß am Gespräch und gutem Essen hat, den offenen Himmel mag, fehlende Systematik und etwas Anarchie nicht fürchtet, wer vielleicht alteuropäische oder gar katholische Neigungen hegt und die Nacht nicht an den Schlaf verschwenden will … Ach, fahren Sie einfach.
Das Bikini-Universum
Ein Blick auf die Landkarte zeigt, dass Spanien groß ist. Dafür ist es mit siebenundvierzig Millionen Menschen ziemlich dünn besiedelt. Im Inneren gibt es riesige unbewohnte Flächen, Wüste, leere Hochplateaus, schroffe Bergketten, Ödland – und eine Menge Ruinen, verfallene Häuser und verlassene Dörfer. In den letzten siebzig Jahren haben verschiedene innerspanische Migrationsbewegungen das Gesicht des Landes drastisch verändert. Der britische Schriftsteller Gerald Brenan hat die Dürre als das vorherrschende klimatische Element bezeichnet. Sie sei so verteilt, schreibt er, „dass der schlechteste Boden die meisten Regenfälle bekommt, während der beste keinen Tropfen erhält“. Dank moderner Bewässerungstechniken spielt das heute keine so große Rolle mehr. Dennoch veröffentlichen die Medien täglich den aktuellen Stand der Wasserreservoirs; mehrere regenarme Jahre hintereinander können verheerende Folgen haben.
Wer mit dem Auto durchs Land fährt, glaubt manchmal, in den Vereinigten Staaten zu sein, so weit dehnt sich der Himmel über der gähnend leeren Fläche. Selbst eine Fahrt von Madrid nach Saragossa vermittelt überwältigende Landschaftseindrücke, die ich metaphysisch nennen würde, wenn ich nicht wüsste, dass sich mancher Leser an die Stirn tippte. Was soll ich machen? Es ist das Gegenteil des Lieblich-Kultivierten, das die deutsche Seele in Italien entdeckt. Das Herbe, oft Karge, jedenfalls Kraftvolle der spanischen Landschaften ist von Reisenden immer wieder beschrieben worden. Wer dafür empfänglich ist, verliebt sich in Spanien rettungs- und bedingungslos. Vieles davon ist auch heute noch zu entdecken, obwohl ein dank kräftiger EU-Zuwendungen ausgebautes Straßennetz manche pittoreske Holperstrecke planiert hat.
Dieses Buch wird in der Hauptsache nicht von dem handeln, was viele Millionen Deutsche Jahr für Jahr im Urlaub konsumieren, also weder von spanischen Stränden noch von Sangría und Bumm-Bumm. Es wird auch nicht von den verbleibenden Ureinwohnern auf den Balearen handeln, die sich gegen die Invasion der Briten und besonders der Deutschen mit gemischtem Erfolg zur Wehr setzen. Ich glaube, die Besucher der einschlägigen Ferienorte mit ihren Bettenburgen und den deutschen Importwürstchen brauchen zur Erfüllung ihrer Wünsche keine Lektüre. Jedenfalls nicht diese.
Andererseits möchte ich bekennen, dass mich das Strandleben nicht weniger fasziniert als Sie. Deshalb gehört spätestens in dieses zweite Kapitel ein Gedenkblatt für den tapferen Spanier, der das Erblühen der Bikinikultur in finsteren Zeiten ermöglicht hat. Denn Pedro Zaragoza Orts, so sein voller Name, war ein Visionär, einer von jenen, den die Geschichte des menschlichen Fortschritts so gern übergeht, von dessen Leistung wir jedoch alle profitieren. In den Fünfzigerjahren des letzten Jahrhunderts sah der Bürgermeister eines idyllischen Fischerdörfchens namens Benidorm in der Provinz Alicante voraus, dass für eine Gegend mit paradiesischen Stränden und 3400 Sonnenstunden im Jahr das Heil im geordneten Tourismus liegt. Also beschloss er, ihn zu ordnen. Der Staat, in dem er das tat, war Francos Spanien, und dessen Kräfte hatten zwar viel für Ordnung, aber weniger für Spaß und lose Sitten übrig.
Zaragozas erste Leistung bestand darin, sich nicht für die Weite, sondern für die Höhe zu entscheiden. 1956 wurde unter seiner Federführung ein Bebauungsplan beschlossen, 1963 hob Benidorm die Höhenbeschränkung bei Neubauten auf, und zwischen 1965 und 1975 baute das Städtchen fast die Hälfte der heute existierenden Hoteltürme. Da hatte der 1922 geborene Zaragoza, der von 1950 bis 1967 die Geschicke des Ortes leitete, sein Amt schon wieder abgegeben, doch das Erbe wirkte fort. Heute werden in über dreihundert Wolkenkratzern jährlich rund fünf Millionen Touristen abgefertigt, und die Einwohnerzahl Benidorms – offiziell bei siebzigtausend – erreicht im Hochsommer mehr als vierhunderttausend Menschen.
Dass dies nicht jedermanns Idee von Urlaub ist, liegt auf der Hand. Und deshalb ist – noch jenseits des deutschen „Ballermann“-Klischees, das sich auf Mallorca bezieht – kaum ein Ferienort auf der Welt so sehr mit Spott übergossen, kein Name zum Synonym für Sand, Sonne und Saufen geworden wie Benidorm. Die Begründung dafür ist nicht allein in den strandhungrigen Menschenmassen (meist Spaniern oder Briten) zu suchen, die jedes Jahr genau diesen und keinen anderen Punkt der Costa Blanca ansteuern, sondern vor allem in ihrer sozialen Herkunft. Denn hierhin schafft es jeder, der seinen Namen auf die gepunktete Linie einer Kreditkartenquittung schreiben kann. Mehr als vierzig Prozent der Besucher bekennen, gäbe es Benidorm nicht, könnten sie sich keinen Urlaub leisten.
Inzwischen hat der Ort, den manche als Sandkasten britischer Proleten schmähen, sogar die höheren Weihen von Urbanisten und Architekten erhalten. Nirgendwo sonst in Europa außer in London und Mailand gibt es eine so hohe Konzentration an Wolkenkratzern, und nirgendwo sonst wird so penibel Wasser recycelt. Benidorm kann also von sich behaupten, seine natürlichen Ressourcen für die größtmögliche Zahl von Menschen auf dem geringstmöglichen Raum zu nutzen.
Mit mächtigen Gegnern, den Ideologen des Regimes und den Moralhütern der katholischen Kirche, nahm Bürgermeister Zaragoza es auf, als er für die Strände seines Modellstädtchens den zweiteiligen Badeanzug zuließ. Darauf drohte ihm die Exkommunikation. Der früheste Streiter für die Akzeptanz des Bikinis, so die gern erzählte Geschichte, schwang sich auf seine Vespa, fuhr die 450 Kilometer nach Madrid und erbat ein Gespräch mit Francisco Franco, um ihm seine Pläne für die touristische Erschließung Benidorms zu erläutern. Und er hatte Erfolg. „Im Interesse des Tourismus“, hieß es, solle der Bikini zugelassen werden. Das war 1959. Pedro Zaragoza krönte seine kulturhistorische Leistung mit einer Verordnung, welche die öffentliche Beleidigung von Bikiniträgerinnen unter Strafe stellte. Meine Leserinnen! Denken Sie an ihn, der leider nicht mehr unter uns weilt, wenn Sie sich das nächste Mal in die spanische Sonne legen.
In der Zeitung war mal ein tiefer Satz über die spanische Gesellschaft zu lesen: Wer auf die Titelseiten der Klatschmagazine kommen will, hieß es da, schafft es am ehesten in Handschellen oder im Bikini. Und wie man es auch dreht und wendet, es stimmt. Als einmal die bekannte spanische Sängerin Isabel Pantoja wegen des Verdachts auf Geldwäsche und Korruption dem Haftrichter vorgeführt wurde, machte ihre Popularität einen großen Satz, und bei ihren nächsten Konzerten zeigten ihr die Fans, dass sie hinter ihr standen.
Mit dem Bikini geht es noch einfacher, aber nur bei denen, die es sich leisten können, von der Physis her. Jede Reflexion über den iberischen Zweiteiler muss sich mit Ana Obregón befassen, einer nicht sehr wichtigen, aber hochpopulären Schauspielerin und Fernsehpräsenz, die den Spaniern über Jahrzehnte hinweg das zuverlässigste Startsignal für den Beginn der Badesaison gegeben hat. Dann nämlich, wenn die Klatschmagazine Anfang Juli ihr jährliches Bikini-Foto veröffentlichen. Man könnte sogar sagen, der Sommer habe erst dann angefangen, wenn Ana Obregón in Málaga die Fotografen versammelt und für ihr Bikini-Foto posiert. Wichtig für das Aussehen, sagte sie einmal, seien nicht „die Jahre des Lebens, sondern das Leben der Jahre“. Wie man an ihr selbst studieren kann: Auch mit Mitte sechzig war sie noch – bauchfrei – an vorderster Front zu finden. „Ich werde im Zweiteiler posieren“, sagte sie, „solange mein Körper es mitmacht.“
Zu den Bikinis an „unserem“ Strand – Provinz Cádiz, Atlantikküste, frequentiert von unprominenten Urlaubern, ein paar Nudisten und Hundehaltern – will ich gar nicht viel sagen, es gibt sie in allen Größen und Dehnungsgraden (die andalusische Jugend nascht gern), aber eine Beobachtung zur Soziologie ist doch am Platz: Die spanische Familie pflegt in großen Gruppen an den Strand zu gehen.
Dieser demografische Anachronismus hat mich irgendwie hoffnungsfroh gestimmt, als wäre der Untergang der abendländischen Familie noch lange nicht in Sicht. In Wahrheit beglückt mich wohl nur, dass sich an spanischen Stränden Reste eines Sozialverhaltens erhalten haben, das einmal für Paare mit neun bis zwölf Kindern typisch war. Von Privatsphäre keine Spur. Selbstverwirklichung? Null. Bei brüllender Hitze knubbelt sich ein halbes Dutzend Menschen mit verblüffender Geschmeidigkeit unter einem einzigen kleinen Sonnensegel, bis es 14.30 Uhr schlägt und alle sich um die Kühlbox scharen. Essenszeit! Danach zwei Stunden lang kein Kontakt mit dem Wasser (schlecht für den Körper), dann wieder vorsichtiges Eintauchen verschiedener Zehen, doch am liebsten in der Gruppe. Und nur bei Ebbe.
Gegessen wird viel. Gelesen auch, aber nichts mit hartem Deckel. Im August lesen die Spanier in Klatschmagazinen wie ¡Hola! davon, wer an anderen spanischen Stränden alles am Strand liegt und ebenfalls nachliest, wer denn wohl an den spanischen Stränden in der Sonne brät, bei mehreren Tausend Kilometern Küstenlinie ein unerschöpfliches Thema, geografisch und überhaupt. Im August werfen selbst seriöse Tageszeitungen die gewohnte Blattaufteilung über den Haufen und liefern uns Sondersektionen, die hirnerweichende Titel wie „Ein Super-Sommer“ oder „Vierzig Grad“ tragen, und auch dort wird darüber reflektiert, wer gerade wo am Strand liegt und mit wem.
Man muss das verstehen. Fast alle Spanier, vom Popstar bis zum Regierungschef, verbringen die Ferien im eigenen Land, eine Vorstellung, die wir lieber nicht auf Deutschland übertragen wollen. Die Frage, wer an welcher Küste ins Meer steigt, ist im Süden also von brennendem Interesse. Und was sie dabei trägt, auch. Die Beschreibung kaum verhüllter Frauenkörper folgt meistens einem romantischen Klischee: „Der gewagte rosa Zweiteiler von Marta G. brachte ihre Kurven bestens zur Geltung.“ Oder: „Sonia F. hat ihre phantastische Linie nach ihrer letzten Schwangerschaft im Handumdrehen zurückgewonnen.“ Oder: „Das sehr verliebte Paar teilte ein Badetuch und zeigte der ganzen Welt, dass an den Trennungsgerüchten nichts dran ist.“
Ob mit ein- oder zweiteiligem Badeanzug: Wo liegt das wahre Spanien? Vermutlich besteht es aus verschiedenen Ländern, einer Fülle von kulturellen, geografischen, klimatischen und kulinarischen Unterschieden, vielen Arten von Gebräuchen, Mentalitäten, Redewendungen – und mindestens vier verschiedenen Sprachen: dem Spanischen (oder castellano), dem Katalanischen (mit Varianten, wie sie in Valencia oder auf den Balearen gesprochen werden), dem Baskischen sowie dem Galicischen. Während Letzteres dem Portugiesischen nahesteht und von allen Spaniern, ebenso wie das Katalanische, zumindest rudimentär entziffert werden kann, ist das Baskische keine romanische Sprache. Wörter wie lehendakari (der Ministerpräsident der autonomen Region des Baskenlandes) oder Ertzaintza, die autonome baskische Polizei, haben trotzdem den Weg in die gemeinsame spanische Sprache gefunden. Dass die kulturelle und linguale Vielfalt wieder in ihr Recht gesetzt wurde, auch wenn Einzelfragen noch immer Konfliktstoff bieten, ist eine der vielen Segnungen der jüngeren spanischen Geschichte.
Jeder, der als Fremder ins Land kommt, konstruiert sich ein Wunsch-Spanien. Aber der Blick eines Deutschen bringt zweifellos ein anderes Land hervor als der Blick eines Franzosen, Niederländers oder Kolumbianers. Ein halber Engländer und halber Spanier, Tom Burns Marañón, der langjährige Korrespondent der Financial Times in Madrid, hat diesen Mechanismus in seinem Buch Hispanomanía in Bezug auf die englischen Reisenden des neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts zu erklären versucht. Diese Besucher, so Burns, hätten ihre Beobachtungen der eigenen Klischeevorstellung angepasst: Weil sie nostalgisch ein glutvolles Andalusien mit herber Agrarromantik herbeisehnten, hätten sie sich zugleich ein anarchisches, politisch konfuses, „anomales“ Spanien gewünscht. Der Spruch Spanien ist anders sei also nichts weiter als eine ausländische Wunschprojektion, die von den Spaniern selbst dankbar aufgegriffen und der eigenen Identität einverleibt worden sei. Wann immer ich von meinem eigenen Lieblings-Spanien träume, erinnere ich mich an diesen Gedanken.
Feine Unterschiede
España es diferente, so stand es in Tourismusbroschüren der Franco-Zeit. Was rückständig und verkommen war, was nicht funktionierte, was reglementiert wurde: Es erhielt von oben das Etikett „anders“ und wurde kurzerhand als exotisches Merkmal eines exotischen Landes verkauft. Jenseits dieses Stereotyps fallen die Unterschiede zwischen Spaniern und Deutschen, gerade bei den Ritualen des Alltags, sofort ins Auge. Einige davon habe ich in diesem Kapitel zusammengetragen.
Nehmen wir an, Sie treffen am Flughafen ein und benötigen ein Taxi. Achten Sie darauf, hinten einzusteigen. Niemand steigt vorn ein. Der Beifahrersitz dient dem Taxifahrer als Ablagefläche, gelegentlich als Mülleimer. Übrigens können Sie Taxifahrern im Allgemeinen vertrauen. Ich habe fast nur gute Erfahrungen mit ihnen gemacht. Alle Madrider Taxis haben übrigens einen schwarzen Buchstaben auf dem Kofferraum. Er bezeichnet den verbindlichen Ruhetag dieses Fahrzeugs: V für viernes (Freitag), L für lunes (Montag) und so fort. Wird ein Taxi an dem Tag, der auf seinem Kofferraum bezeichnet ist, auf der Straße erwischt, droht eine saftige Geldstrafe.
Für den Fall, dass Sie Spanisch sprechen, öffnen sich Ihnen die spanischen Herzen. Und die Münder. Denn Spanier sprechen viel, schnell und laut. Betreten Sie eine Bar, in der sich mehr als drei Personen befinden, wird Ihnen der hohe Geräuschpegel sofort auffallen. Es gibt hier offenbar immer etwas zu erzählen. Warum die Stimmen so laut sein müssen, habe ich noch nicht herausgefunden. Statistisch ist Spanien, nach Japan, das zweitlauteste Land der Welt. Außerdem hat Spanien, wiederum nach Japan, die zweithöchste Lebenserwartung der Welt. Ich warte noch auf die Theorie, die zwischen diesen beiden Befunden einen Zusammenhang herstellt.
Man darf Spanier beim Reden ungestraft unterbrechen, was einer alten Beobachtung zufolge mit der Stellung des Verbs im Satz zu tun hat: Anders als im Deutschen weiß man bei romanischen Sprachen recht früh, worauf die Aussage hinausläuft. Erwarten Sie umgekehrt keinen übertriebenen Respekt vor Ihren wertvollen Sätzen. Genau genommen bestehen Unterhaltungen in Spanien großenteils aus Unterbrechungen. Das heißt, zwei Menschen brabbeln munter aufeinander ein, ohne sich ständig vergewissern zu müssen, ob jede ihrer Aussagen wirklich ankommt.
Auch ich habe inzwischen gelernt, unter ausladenden Gesten munter daherzubrabbeln und mich dem fließenden Kontinuum gesprochener Rede anzupassen. Als ich neulich ein deutsches Café betrat, kam mir die Gesprächs- beziehungsweise Schweigeatmosphäre gespenstisch ruhig vor. Mir sank das Herz. Ich dachte: Die Menschen hier müssen sehr wichtige Gedanken haben, dass sie nur so wenige davon aussprechen. Verständlicherweise redet es sich gleich etwas leichter in einem Land, das den Kuss auf die Wange – aus der Sicht des Küssenden: erst links, dann rechts – zur regulären Begrüßung zwischen Frauen und Männern erhoben hat. Virus-Pandemien sind ein schwerer Schlag für alle, die kulturell und emotional so sehr auf Körperlichkeit und Berührungen angewiesen sind wie die Südländer.
Ein Hinweis für alle, die sich verabreden. Uhrzeiten sind Näherungswerte. Aber das wussten Sie sicherlich. Es ist nicht höflich, um Punkt 21 Uhr da zu sein, wenn man sich für 21 Uhr verabredet hat. Legen Sie eine Viertelstunde drauf. Dieselbe Unbestimmtheit gilt auch beim Ausklang eines gemeinsam verbrachten Abends. Das definitiv „letzte Getränk“, das man miteinander teilt, kann sich öfter wiederholen. Andererseits ist es unüblich, im Restaurant noch lange sitzen zu bleiben, wenn Kaffee und Absacker (chupito) hinter einem liegen. Denn der nächste Hafen, die Bar, wartet schon.
Die informelle Redeform – das „Du“ statt des „Sie“ – hat viele Bereiche des täglichen Lebens erobert. Man darf sich über die Bedeutung der sprachlichen Formen nicht täuschen. Sie haben ihren Sinn, aber welchen genau, entspricht nicht immer deutschen Erwartungen. Zum Beispiel muss die vertrauliche Du-Anrede durchaus nicht bedeuten, dass sich das Autoritätsgefälle verringert. Wildfremde Menschen, etwa beim Kennenlernen in Anwesenheit eines gemeinsamen Bekannten, können sich in Spanien schon bei der ersten Anrede duzen. Es wäre verfrüht, daraus auf freundschaftliche Bande zu schließen. Allerdings erleichtert die vertrauliche Anrede die Annäherung. Umgekehrt jedoch kann das „Du“ auch benutzt werden, um der Anrede jede Höflichkeit und Achtung zu entziehen. Zwischen dem freundlich-intimen „Du“ und dem abfällig-beleidigenden „Du“ besteht äußerlich kein Unterschied. Woraus wir lernen, dass die informelle Redeform deutungsbedürftig ist. Zunächst einmal ist sie nur das: informell. Und erleichtert wird mit ihr gewiss nicht der tiefgründig-philosophische Austausch zweier verwandter Seelen, sondern das Reden in Gesellschaft.
Bemerkenswert ist, dass Menschen, die beide Sprachen beherrschen, die Anredeform der einen nicht automatisch auf die andere übertragen. Zumindest spüren sensible Geister dabei eine Kluft. Marta, eine Spanierin, hat mir einmal erklärt, wie die informelle deutsche Anredeform auf Menschen einer anderen Kultur wirkt: Das deutsche „Du“, so sagt sie, sei ein großer Vertrauensbeweis, den man sich erwerben müsse. Da er etwas Ernstes bedeute – verlässliche Beziehungen, gar Freundschaft –, müsse man ihn gedanklich von dem leichtgewichtigen Gebrauch des „Du“ in südlichen Kulturen trennen.
Das übernächste Kapitel handelt ausführlicher von gesellschaftlicher Etikette und vom Essen. Hier nur die Warnung, was Ihnen in Spanien mit Sicherheit fehlen wird: dunkles Brot, Quark und ein repräsentatives Angebot von ungesüßtem Joghurt. Nichts gegen das helle spanische Brot (die Stangen, die wie Baguette aussehen, heißen barra de pan), aber man hat es als deutscher Brotesser bald satt und sucht nach gehaltvolleren Genüssen.
Eines der wesentlichen Ärgernisse früherer Zeiten, das Telefonieren, hat sich durch Mobilfunk und europäische Flatrates erledigt. Im selben Maß hat auch die ehemals staatliche Gesellschaft Telefónica ihre finstere Macht verloren. Immer noch sind in manchen Bereichen jedoch bürokratische Ineffizienz und starre Hierarchien zu beobachten, dazu Absprachen und gewährte oder empfangene Gefälligkeiten. Wenn Ihnen jemand bei etwas helfen will und dies nicht selber tun kann, gibt er Ihnen die Telefonnummer eines Freundes, den Sie bei Bedarf anrufen können. Tun Sie es! Wenn Sie bei Gesprächsbeginn den Namen des gemeinsamen Bekannten nennen, wirkt er wie ein Sesam-öffne-dich. Das System von Empfehlung und Patronage umschreibt man mit dem Begriff enchufe. Das heißt wörtlich „Stecker“. Wer enchufado ist, hat viele Verbindungen und ist mit wichtigen Leuten verstöpselt, von denen er nach Kräften profitieren kann. Es wäre unsinnig, darüber die Nase zu rümpfen. Viel wichtiger ist, solche Beziehungen als Faktor des geschäftlichen Umgangs einzukalkulieren. Denn sie reichen weit in den familiären Bereich hinein und damit ins Herz der spanischen Gesellschaft.
Gute Kontakte sind auch deswegen so oft vonnöten, weil Spanien eine lange Geschichte bürokratischer Tyrannei und entsprechender Willfährigkeit aufseiten des Volkes hinter sich hat. Mit der Beziehung zwischen Individuum und Bürokratie hat es jedoch eine besondere Bewandtnis. So willkürlich, sinnlos und demütigend vieles erscheint, was spanische Bürger an Papierkram über sich ergehen lassen oder genauer: durchwaten müssen, so oft finden sich überraschende Seitenwege und Schlupflöcher. Ein und derselbe Beamte kann Ihnen eine haarsträubende Prozedur erläutern, aus der niemand unter der Sonne entrinnen könne – und Ihnen im nächsten Augenblick in verschwörerischem Ton zu verstehen geben, er kenne eine Methode, um das System zu überlisten.
Seien Sie darauf gefasst, dass die tägliche Schulung in praktizierter Absurdität die Spanier hart und duldsam gemacht hat, was nicht dasselbe ist wie geduldig. Die Geduld verlieren sie schnell, wenn damit Aufbrausen und Temperamentsausbrüche gemeint sind. Nein, duldsam: Man sieht das Leben nicht als Effizienzmaschine.
Noch etwas zur Einstimmung. Der Akzent, etwa in Frauennamen wie María Jesús, zeigt stets die zu betonende Silbe an; bitte sprechen Sie das j immer kehlig-kratzig, wie am Ende des Wortes „doch“. Vor allem aber wissen Sie jetzt, dass Sie es mit einem katholischen Land zu tun haben. Mädchen heißen zu Ehren der Gottesmutter fast immer María, wenn nicht mit erstem, dann mit zweitem oder drittem Namen.
So fromm spanische Vornamen oft klingen, bei den Nachnamen hat die Gesellschaft kein allzu schweres patriarchalisches Erbe. Verheiratete Frauen nämlich konnten ihren Nachnamen schon immer behalten, sind also in der Öffentlichkeit nicht als verheiratete Frauen gekennzeichnet. Da Nachnamen sich ihrerseits aus einem Doppelnamen zusammensetzen – dem Nachnamen des Vaters und dem der Mutter –, entstehen gelegentlich vielsilbige Ungetüme, an die sich das deutsche Ohr nicht so leicht gewöhnt, etwa Amelia Marina Serrano Ibargüengoitia.
Bei den Nachnamen gibt es einen benutzten ersten und einen stummen zweiten. Der Dichter Federico García Lorca wird „Lorca“ genannt, weil dies der ungewöhnlichere der beiden Nachnamen ist. Und jemand mit dem Allerweltsnamen González benötigt entweder zusätzlich den Vornamen, um sich unterscheidbar zu machen (wie der ehemalige Ministerpräsident Felipe González), oder er wirft den unaufregenden Nachnamen gleich über Bord. So der große Fußballspieler von Real Madrid, später Schalke 04, inzwischen ein junger Trainer, von dem wir wohl noch hören werden und den alle Welt nur bei seinem Vornamen nennt: Raúl.
„Ingendaays Buch über Spanien gibt einen gut recherchierten Einblick in die südeuropäische Seele.“
„Mir hat das Buch Lust auf Spanien gemacht und mein Reisefieber geweckt, und bei der Lektüre habe ich viel Neues erfahren, bin aber auch auf bereits Bekanntes gestoßen.“
„Eine informativ-unterhaltsame Plauderei über spanische Themen.“









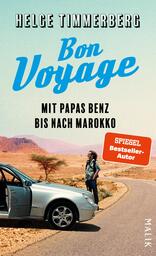


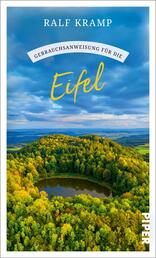





DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.