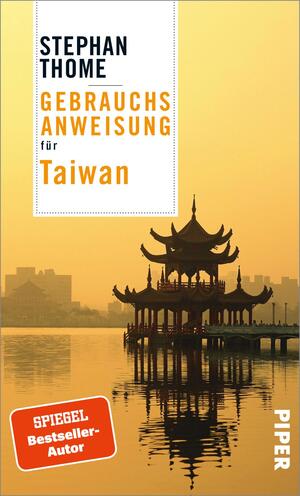
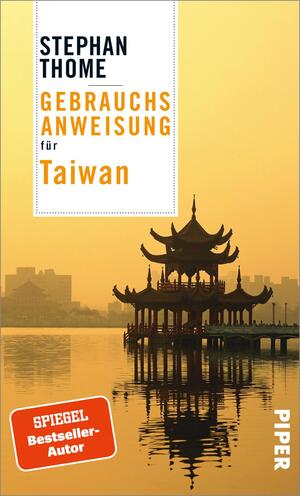
Gebrauchsanweisung für Taiwan Gebrauchsanweisung für Taiwan - eBook-Ausgabe
„Stephan Thomes Buch steckt voller faszinierender historischer Pointen.“ - Der Tagesspiegel
Gebrauchsanweisung für Taiwan — Inhalt
Das andere, das bessere oder gar kein China?
Das andere, das bessere oder gar kein China?
Taiwan ist eine ebenso junge wie umkämpfte Demokratie, geprägt von Kolonialherrschaft, Diktatur und neuer Freiheit. Hier mischt sich das japanische Erbe mit chinesischem Brauchtum und den Traditionen der Ureinwohner.
„Die 224 Seiten haben es in sich.“ ― Süddeutsche Zeitung
Reisende erwartet eine auf ihre Unabhängigkeit pochende Nation, die sich im Meistern von Krisen bewährt und zu deren größten Obsessionen Essen und Baseball zählen. Dazu grandiose Naturlandschaften mit Nationalparks, imposanten Bergen und Steilküsten, heißen Quellen und wilden Schluchten. Eine außergewöhnliche Dichte an alten Tempeln und unzählige Nachtmärkte mit der köstlichsten Küche Asiens – und so verlockenden Speisen wie „Stink-Tofu“.
„Das Buch ist sehr persönlich verfasst und darüber hinaus sehr aktuell.“ ― bn Bibliotheksnachrichten
Der preisgekrönte Bestseller-Autor Stephan Thome – Autor von „Schmales Gewässer, gefährliche Strömung" und „Pflaumenregen" – lebt seit vielen Jahren in Taiwan und erzählt kundig und unterhaltsam von seiner Liebe zum geschichtsträchtigen Inselstaat im Pazifik.
Leseprobe zu „Gebrauchsanweisung für Taiwan“
Prolog am Schalter Nummer 20
Am 25. März 2020 morgens um kurz vor zehn beträgt meine Körpertemperatur 36,4 Grad. Das jedenfalls bescheinigt mir die uniformierte Person im Foyer des Verwaltungsamts von Songshan, einem Stadtviertel im Osten Taipeis, wo meine Freundin (36,2 Grad) und ich seit fünf Jahren wohnen. Wie in allen öffentlichen Gebäuden Taiwans gibt es auch hier strikte Eingangskontrollen. Wir müssen Gesichtsmasken tragen, uns die Temperatur messen und ein Desinfektionsmittel auf die Hände sprühen lassen, dann erst werden wir zum Empfangsschalter [...]
Prolog am Schalter Nummer 20
Am 25. März 2020 morgens um kurz vor zehn beträgt meine Körpertemperatur 36,4 Grad. Das jedenfalls bescheinigt mir die uniformierte Person im Foyer des Verwaltungsamts von Songshan, einem Stadtviertel im Osten Taipeis, wo meine Freundin (36,2 Grad) und ich seit fünf Jahren wohnen. Wie in allen öffentlichen Gebäuden Taiwans gibt es auch hier strikte Eingangskontrollen. Wir müssen Gesichtsmasken tragen, uns die Temperatur messen und ein Desinfektionsmittel auf die Hände sprühen lassen, dann erst werden wir zum Empfangsschalter vorgelassen und nach dem Zweck unseres Besuchs gefragt. Den haben wir uns zum Glück gut überlegt. „Wir wollen heiraten.“
Die Dame am Schalter nickt: „Vierter Stock.“ Ihre guten Wünsche für die Zukunft begleiten uns zum Aufzug.
Mit Gesichtsmaske zu heiraten ist nicht gerade der Inbegriff von Romantik. Heute allerdings steht mit der offiziellen Registrierung sowieso nur ein Verwaltungsakt an. Feiern wollen wir unsere Hochzeit erst im nächsten Jahr, in der Hoffnung, dass die Pandemie dann auch in Deutschland vorbei und das Reisen wieder möglich sein wird. Hier in Taiwan hat man es glücklicherweise verstanden, die Krise durch entschiedenes Handeln im Keim zu ersticken. Einen Tag bevor im Januar der erste Infektionsfall bestätigt wurde, hat das nationale Krisenzentrum seine Arbeit aufgenommen. Die Verlängerung der Neujahrsferien, durch die landesweit alle Schulen für zwei weitere Wochen geschlossen blieben, trat in Kraft, als die Gesamtzahl der Infizierten auf zehn geklettert war. Dass zu diesem Zeitpunkt alle Fahrgäste in öffentlichen Verkehrsmitteln Gesichtsmasken trugen, versteht sich von selbst. Statt darüber zu diskutieren, ob Masken mit der Menschenwürde vereinbar sind, wurde ihre Produktion gesteigert und ein effizientes Verteilungssystem eingerichtet. So konnte innerhalb Taiwans zu keiner Zeit von einer Epidemie die Rede sein.
Einige präventive Maßnahmen habe ich selbst zu spüren bekommen: Bei meiner letzten Einreise aus Deutschland galt noch Reisewarnstufe II, was mir für zwei Wochen leichte Einschränkungen auferlegte, die als Empfehlungen formuliert waren: keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, Menschenansammlungen meiden, nicht auswärts essen. Acht Tage später war die Lage in Europa derart außer Kontrolle, dass ich, den Regeln von Stufe III entsprechend, nicht mehr vor die Tür durfte. Zweimal am Tag wurde ich angerufen und nach meinem Befinden gefragt. Auf dem gelben Formblatt, das mir ein Mitarbeiter der Behörden persönlich an die Tür gebracht hatte, musste ich meinen Gesundheitszustand protokollieren, außerdem fand ich dort aufgelistet, welche Strafen ein Verstoß gegen Quarantäne-Auflagen nach sich ziehen würde, die nun keine Empfehlungen mehr waren. Auf Zuwiderhandlungen gegen § 58 des Gesetzes zur Kontrolle übertragbarer Krankheiten stand ein Bußgeld von umgerechnet drei- bis dreißigtausend Euro. Es waren strikte, aber transparente Maßnahmen, die der taiwanische Gesundheitsminister in seiner täglichen Pressekonferenz erklärte und deren Wirksamkeit schnell sichtbar wurde. Als sich die Fallzahlen in Deutschland der Zwanzigtausendermarke näherten, gab es
in Taiwan gerade mal 169 Infizierte, größtenteils Rückkehrer aus dem Ausland. Um es vorwegzunehmen: Als im Herbst 2020 die Zahl der deutschen Corona-Toten auf über zwanzigtausend anstieg, waren es auf der Insel immer noch sieben(!).
Kaum in Zahlen ausdrücken lässt sich der gestärkte soziale Zusammenhalt. Zu Recht sind die Menschen stolz auf den Erfolg ihrer kollektiven Anstrengung und registrieren zufrieden, dass das in internationalen Medien anerkannt wird, wo das Land sonst nur vorkommt, wenn Erdbeben oder Taifune wüten oder das Regime in Peking wieder mal mit Krieg droht. Obwohl Letzteres seit einiger Zeit mit steigender Tendenz geschieht, haben die Menschen das Gefühl, im sichersten Land der Welt zu leben. Nachdem die jüngsten Präsidentschaftswahlen die Gräben innerhalb der Gesellschaft offengelegt haben, sorgt der erfolgreiche Kampf gegen Covid-19 – hier nach wie vor „die Lungenentzündung aus Wuhan“ (wuhan feiyan) genannt – für ein neues positives Wir-Gefühl. Allenfalls Neuseeland könnte Taiwan den inoffiziellen Titel des Corona-Weltmeisters streitig machen. Weil die Regierung schnell und planvoll agiert und die Bevölkerung diszipliniert mitgezogen hat, mussten die Maßnahmen am Ende nicht annähernd so radikal ausfallen wie in Europa. Keineswegs wurde, wie gelegentlich zu lesen ist, die Gesundheit der Menschen auf Kosten ihrer Freiheit geschützt. Kein landesweiter Lockdown, weder Hotels noch Bars, noch Fitnessstudios muss-
ten wegen des Virus dichtmachen, und die Spiele der Baseball-Profiliga fanden nach kurzer Unterbrechung wieder vor Zuschauern statt. Der Hochzeitsreise rund um die Insel, die meine Frau und ich in zwei Tagen antreten wollen, steht nichts im Weg.
Vorher müssen wir unsere Ehe nur noch offiziell schließen.
Im vierten Stock empfängt uns ein neonbeleuchtetes Großraumbüro mit über zwanzig Schaltern. Der Andrang ist gering, im Wartebereich sitzen lediglich meine Schwiegermutter sowie mein Schwager mit seiner Frau und zwei Kindern. Die Begrüßung fällt kurz aus, denn kaum haben wir eine Nummer gezogen, werden wir auch schon aufgerufen. Schalter Nummer 20.
Feierlichkeit, große Gefühle, ein Bewusstsein der Zäsur im Leben, die eine Eheschließung bedeutet – all das stellt sich in der nächsten halben Stunde nicht ein. Zunächst präsentieren wir eine Reihe von Dokumenten, darunter mein ins Chinesische übersetztes, beglaubigtes und von der taiwanischen Vertretung in Deutschland legalisiertes Ehefähigkeitszeugnis. Volle elf Arbeitstage hat das Standesamt Biedenkopf gebraucht, um mir zu bescheinigen, dass ich in meiner Heimat nicht bereits verheiratet bin. Zwischendurch schicken meine Eltern übers Handy ein Foto der Sektflasche, die sie um drei Uhr nachts deutscher Zeit öffnen, um auf unser Glück anzustoßen, ansonsten ist der Vorgang an Nüchternheit kaum zu überbieten. Weder eine Rede noch Ringe sieht das Protokoll vor, wir werden nicht einmal expressis verbis zu Mann und Frau erklärt, geschweige denn gefragt, ob wir unsere Ehefähigkeit wirklich an genau dieser Person testen wollen. Kein Jawort, nur eine Reihe von Unterschriften.
Die einzige Verzögerung entsteht am Schluss: Soll ich die Eheurkunde mit meinem deutschen oder dem chinesischen Namen unterschreiben? Das Gesetz lässt beides zu, meine Frau zuckt mit den Schultern, auch die Standesbeamtin wirkt einen Augenblick lang ratlos. Schon klar, es ist bloß die letzte Formalität des Ganzen, und vielleicht zögere ich aus dem inneren Bedürfnis heraus, den Moment doch noch als Zäsur zu markieren und ihn mit den Weihen einer bewusst gefällten Entscheidung zu versehen.
„Was sagt denn Ihr Gefühl?“, fragt die Beamtin, um mir die Sache zu erleichtern.
Ausgesprochen viel, bin ich versucht zu antworten. Irgendwie kulminiert am heutigen Tag auch die Geschichte, die mich mit der Insel Taiwan verbindet. Zum ersten Mal besucht habe ich sie vor 24 Jahren, für ungefähr die Hälfte dieser Zeit war sie seitdem mein Hauptwohnsitz, aber warum bisher jeder Versuch, sie zu verlassen, in eine Rückkehr mündete, ist nicht so leicht zu sagen. Beim ersten Besuch vertraute mir ein betrunkener Amerikaner an: „Taiwan saugt dich auf wie ein schwarzes Loch, Mann, wenn du einmal hier bist …“. Was man eben so redet in den Bars von Ostasien, diesen traditionellen Ballungszentren männlicher Einfalt. Eine Anziehungskraft der Art, für die unser Wort „exotisch“ steht, besitzt die Insel zumindest auf den ersten Blick nicht. In taiwanischen Städten dominiert grauer Beton, und wer das Besondere entdecken will, braucht scharfe Augen und ein gutes Ohr. Zum Beispiel erklingen in der U-Bahn von Taipei alle Ansagen viersprachig, auf Chinesisch, Taiwanisch, Hakka und Englisch: ein erster Hinweis darauf, dass sich in Taiwan seit Langem Ethnien und Kulturen mischen, wobei die Einflüsse keineswegs auf den asiatisch-pazifischen Raum beschränkt geblieben sind.
Portugiesische Seefahrer tauften das dünn besiedelte Eiland im 16. Jahrhundert Ilha Formosa, die schöne Insel. Der Süden wurde im 17. Jahrhundert von Holland besetzt, der Norden von Spanien, im 19. Jahrhundert fühlten sich auch Frankreich und Preußen von den Reizen der Insel angezogen, vor allem von ihrer Lage im Kreuzungspunkt wichtiger Handelsrouten. Die aufkommende Regionalmacht Japan umwarb die Schöne mit rasselnden Säbeln. Erst dieses Interesse von außen veranlasste den Hof in Peking, den bisher kaum beachteten, von Menschenfressern und giftigen Schlangen bewohnten Flecken – als „Klumpen Dreck“ schmähte ihn ein Kaiser – administrativ stärker zu integrieren. 1887 wurde Taiwan zur chinesischen Provinz aufgewertet, aber bereits acht Jahre später verlor das Kaiserreich einen Krieg gegen Japan, und für die kommenden fünfzig Jahre war Formosa, wie der Westen inzwischen sagte, eine japanische Kolonie. Wer heute gedankenlos behauptet, Taiwan habe „schon immer“ zu China gehört, sollte einen zweiten Blick auf die Geschichte werfen.
Auf den Punkt gebracht, verlief sie so: Immer wollte irgendwer die Insel haben, nur nach den Wünschen der Bewohner fragte niemand. Als Japan 1945 den Pazifikkrieg verlor, wurde Taiwan aufs Neue ins Gefüge der chinesischen Nation eingegliedert. Offiziell hieß das „glorreiche Rückkehr“ (guangfu), aber da die Geschichte keinen Rückwärtsgang kennt, verblasste der Glorienschein des Slogans schnell. Aus dem Kaiserreich, zu dem die Insel einmal gehört hatte, war eine vom Krieg gegen Japan und von inneren Kämpfen aufgeriebene Republik geworden, die sich dem drohenden Zusammenbruch durch Flucht entzog. Geschlagen von den Kommunisten, floh Chinas militärischer Oberbefehlshaber Chiang Kai-shek mit seinem Heer nach Taiwan, knapp zwei Millionen demoralisierte Menschen, die voller Argwohn auf ihre vermeintlichen Landsleute schauten, die größtenteils nicht einmal Chinesisch verstanden. Während der Kommunist Mao Zedong 1949 in Peking
die Volksrepublik China ausrief, begannen Generalissimus Chiang und seine Getreuen damit, alle Taiwaner gewaltsam zu Chinesen umzuerziehen. Heute heißt die Zeit, die bis zur Aufhebung des Kriegsrechts 1987 dauerte, Weißer Terror (baise kongbu).
Bis ins späte 20. Jahrhundert hinein handelt die taiwanische Geschichte vor allem von Leid und Unterdrückung. Inzwischen allerdings schauen viele Menschen in Ostasien bewundernd auf eine Nation, in der die Zivilgesellschaft gedeiht wie nirgendwo sonst in der Region: Seit 1996 demokratisch regiert, seit 2016 angeführt von einer unverheirateten Frau, seit 2019 das erste asiatische Land, das gleichgeschlechtlichen Paaren die Ehe erlaubt. Leider ist diese Erfolgsgeschichte dem großen Nachbarn China ein Dorn im Auge, und nach den jüngsten Ereignissen in Hongkong stellt sich die bange Frage, ob die Zerstörung der taiwanischen Demokratie als Nächstes auf Pekings To-do-Liste steht. Am entsprechenden Willen des Regimes ist kaum zu zweifeln; ob es seinen Willen bekommt, wird von vielen Faktoren abhängen, nicht zuletzt vom Agieren der viel beschworenen westlichen Staatengemeinschaft, falls es die gegenwärtig noch gibt. Welches Schicksal Taiwan im 21. Jahrhundert ereilen wird, ist zwar von größter weltpolitischer Relevanz, aber einstweilen völlig ungewiss.
Wie leben die Menschen mit dieser Ungewissheit, und wie leben sie überhaupt? Woran glauben und worauf hoffen sie? Warum sind sie so begeistert vom Baseballspiel? Woher kommen die weltberühmten Taiwanese Beef Noodles, und wie schmeckt der berüchtigte Stinktofu? Solchen und anderen Fragen werde ich auf den folgenden Seiten nachgehen, ohne jedes Mal den kürzesten Weg zur Antwort einzuschlagen. Die schöne Insel im Pazifik hat die Form einer Süßkartoffel – worauf im Volksmund oft angespielt wird – und nicht nur eine Geschichte voller abrupter Wendungen, sondern auch über zweihundert Gipfel von mehr als dreitausend Metern Höhe. Wer dieses anspruchsvolle Terrain erkunden will, muss manchen Umweg in Kauf nehmen.
Die letzte Unterschrift leiste ich schließlich mit meinem deutschen Namen. In einem anderen Land und Kulturkreis zu leben verändert einen in vielerlei Hinsicht, aber nicht in jeder. Den verschiedenen Anteilen der eigenen Identität gerecht zu werden verlangt einen ähnlichen – ebenso bewusst wie beiläufig ausgeführten – Balanceakt wie die Ehe. Unabdingbar ist ein waches Gespür, nicht nur für die andere Person, mit der man sein Leben teilt, sondern auch für jene anderen, die in den tieferen Schichten des eigenen Ichs wohnen. Taiwanerinnen und Taiwaner, die im Verlauf ihrer Geschichte schon vieles gewesen sind, wissen nur zu gut, dass ungemischte Identitäten eine ideologische Abstraktion darstellen. Eine gleichmacherische Zumutung, gegen die es sich mit Entschiedenheit und Humor zu wehren gilt.
„Was sind Taiwaner?“, lautet eine beliebte Scherzfrage.
Antwort: „Taiwaner sind Chinesisch sprechende Japaner.“
Witzig und nicht ganz unwahr, wie Sie bei der Lektüre dieses Buches feststellen werden.
Nun bin ich also verheiratet und habe auch offiziell so etwas wie eine zweite Heimat. Grund genug, deren Geschichte in den nächsten Kapiteln noch einmal etwas gründlicher aufzuarbeiten. Schließlich kenne ich Taiwan lange genug, um bei einigen historischen Wendungen selbst dabei gewesen zu sein.
Ankunft: Das andere, das bessere oder gar kein China?
Wir schreiben das Frühjahr 1996, wenige Monate trennen mich von meinem 24. Geburtstag. Seit dem vorigen Herbst bin ich als Sprachstudent an der Universität Nanjing in China eingeschrieben, einer Stadt am Unterlauf des Yangzi mit drückend heißen Sommern, nasskalten Wintern und rund einer Million Baustellen. Das winzige Doppelzimmer, das ich mir mit einem japanischen Kommilitonen teile, hat weder Heizung noch Klimaanlage, nur undichte Fenster, durch die der Staub hereindringt, der die Stadt das ganze Jahr über in ein seltsames Zwielicht taucht. Auch wenn die Sonne scheint, sieht man sie nicht. Im ersten Semester bin ich jeden Vormittag zum Unterricht gegangen und habe danach neue Schriftzeichen gepaukt, oft bis spät in die Nacht. Das zweite Semester schwänze ich, um auf Reisen zu gehen. Im März war ich im äußersten Südwesten, an der Grenze zu Myanmar, im Sommer will ich nach Sichuan und Tibet reisen, um von Kathmandu aus nach Hause zu fliegen, aber jetzt im Frühjahr mache ich mich auf den Weg nach Taiwan. Ein Freund aus Berlin wohnt dort, genau wie ich für ein Jahr als Student. Wir kommunizieren per Brief, denn das World Wide Web steckt in den Kinderschuhen, in China wurde es noch nicht geboren. Handys sind so groß wie ein Föhn und haben eine Antenne. Da es zwischen China und Taiwan keine Direktflüge gibt, muss ich über die Kronkolonie Hongkong reisen und den Flug nach Taipei dort buchen.
Über mein Reiseziel weiß ich fast nichts, im Kopf nenne ich es „das andere China“. Seines rasanten wirtschaftlichen Aufschwungs wegen wird es zu den vier asiatischen Tigerstaaten gezählt, neben Singapur, Südkorea und Hongkong, und im März wurde zum ersten Mal der Präsident frei gewählt. Da ich in Nanjing vom internationalen Nachrichtenfluss abgeschnitten bin (kein Fernseher, keine ausländische Zeitung), habe ich bloß beiläufig mitgekriegt, dass Peking mit dieser Entwicklung nicht einverstanden ist, obwohl die Taiwaner lediglich den bisherigen Präsidenten Lee Teng-hui von der Nationalpartei Kuomintang (KMT) im Amt bestätigt haben. Die KMT, sage ich mir, ist eben der historische Erzfeind der Kommunistischen Partei, der Gegner in einem zwar fünfzig Jahre zurückliegenden, aber nie offiziell beendeten Bürgerkrieg. Also hat die Volksrepublik Manöver in der Taiwanstraße abgehalten und sogar Raketen in taiwanische Gewässer gefeuert, gleichsam Schüsse vor den Bug der Insel. Klingt nach Säbelrasseln, für mich in diesem Moment nicht wichtig.
Die vielen Gesichter Chinas
Hongkong ist ein Schock. So modern und glitzernd und dennoch unverkennbar asiatisch. An den überfüllten U-Bahnhöfen stehen die Passagiere schon in Reih und Glied, bevor der Zug kommt. Trotz der Enge läuft alles wie am Schnürchen, die Stadt ist international und schick, wahrscheinlich sehe ich innerhalb von zehn Minuten mehr Männer mit Krawatte als in China in einem halben Jahr. Überall begegne ich Menschen, die sich weigern, meinen vorgefassten europäischen Kategorien zu entsprechen. Es ist ein merkwürdiger Gedanke, in einer Kolonie zu sein. Was für ein Anachronismus! Tatsächlich sind die Tage der britischen Herrschaft gezählt, Hongkongs Rückgabe an China ist beschlossene Sache. Später mache ich mit der Fähre einen Ausflug nach Macau, wo Straßen und Gebäude portugiesische Namen tragen und ich nicht mehr weiß, in welchem Sinne ich mich noch in China befinde.
Nach vier Tagen steige ich ins Flugzeug nach Taipei.
Ankunft am Chiang Kai-shek International Airport.
Im Rückblick scheint es mir ein passendes Symbol zu sein: Die junge Demokratie, deren wichtigster Flughafen weiterhin dem Diktator gewidmet ist, der die Insel jahrzehntelang mit eiserner Hand regiert hat. Bei meiner Ankunft ist es bereits spät, und ich bin froh, dass mein Freund Knut in der Ankunftshalle auf mich wartet; ob mein Brief aus Hongkong angekommen war, hatte ich nicht wissen können. Die Fahrt in die Stadt dauert fast eine Stunde, erst mit dem Bus zum Hauptbahnhof, dann mit dem Taxi in die Shida Lu, eine Straße, die ich anderthalb Jahre später täglich entlanglaufen werde, um zum Sprachunterricht an der Uni zu kommen. Erste Eindrücke: Es gibt so viele Motorroller wie in China Fahrräder, die Fassaden der Geschäfte sind bunter und heller, außerdem kann ich noch weniger Schriftzeichen lesen als in Nanjing. In Taiwan benutzt man sogenannte Langzeichen, also Schriftzeichen in ihrer traditionellen Form, nicht die Kurzzeichen, die die Kommunistische Partei eingeführt hat, um den Analphabetismus zu bekämpfen.
Den ersten Abend verbringen wir in einer Schwulenbar namens The Source. Keiner von uns beiden ist schwul, aber erstens ist es eine coole Bar, und zweitens tut es gut, in einer Stadt zu sein, wo es so etwas gibt. Taiwan, das spüre ich, ohne den Eindruck in Worte fassen zu können, ist anders als die Volksrepublik. Es herrscht ein anderes soziales Klima, ein anderer Vibe, man sieht kaum Uniformierte und überhaupt keine Propagandaslogans. Auf der Straße begegnen mir zwar neugierige Blicke, aber niemand starrt mich an oder ruft mir „Hello, hello“ hinterher, wie es drüben allenthalben geschieht. In Geschäften und Restaurants schallt mir stattdessen ein freundliches Huanying guanglin entgegen, was ich zuerst nicht verstehe, weil ich es nie gehört habe. Wörtlich heißt es „Gegrüßt sei die Annäherung Ihres Glanzes“, aber es ist bloß eine gängige Grußformel, und seit ich einige Jahre später in Tokio das allgegenwärtige Irasshai-mase gehört habe, weiß ich auch, woher die Sitte kommt (wie ich in Japan überhaupt oft denken werde: Das kenne ich doch aus Taiwan!). Knut wohnt in einem kleinen Zimmer nahe der Uni, nicht wie ich in einem Wohnheim nur für Ausländer, wo einheimische Bekannte ihren Ausweis vorzeigen müssen, wenn sie zu Besuch kommen. Vom ersten Tag an fühle ich mich in Taipei wohltuend unbeobachtet. Frei.
Zwei Erzählungen von Taiwans Geschichte
In den kommenden Tagen erkunde ich die Stadt, die an manchen Tagen im Smog verschwindet, so wie Nanjing im Staub der Baustellen. Nach einigen Stunden im Freien bilden sich schwarze Ränder um die Nasenlöcher, und ich habe einen metallischen Geschmack im Mund. In den Hügeln am Stadtrand besuche ich das Palastmuseum und bewundere die Kunstschätze, die ich im Winter beim Besuch der Verbotenen Stadt in Peking vermisst habe – tonnenweise hat die KMT sie vor ihrer Flucht vom Festland nach Taiwan gebracht. Jade und Porzellan, Kalligrafien und Gemälde, Opfergefäße und alte Münzen. Es sind Kostbarkeiten, die lange Zeit den Anspruch untermauern sollten, die Republik China auf Taiwan sei das bessere und wahre China, der Hüter einer jahrtausendealten Kultur, die auf dem Festland verkam, wenn sie nicht gar aktiv zerstört wurde. Inzwischen ist die chinesische Kulturrevolution (1966–1976) mit ihren Exzessen zwar vorbei, aber die Anzahl der Tempel, die ich auf meinen Spaziergängen passiere, ist hier um ein Vielfaches höher als in chinesischen Städten. Immer wieder weht mich der Duft von Räucherstäbchen an, höre ich Gongs und buddhistische Sprechgesänge, in fast allen Geschäften steht ein rot leuchtender Hausaltar. In gewisser Weise, denke ich, ist Taiwan sogar chinesischer als die Volksrepublik.
Mitten im Stadtzentrum steht das Memorial für den Generalissimus Chiang Kai-shek. Ein riesiger freier Platz, flankiert von der Nationalen Konzerthalle auf der einen und dem Nationaltheater auf der anderen Seite. Mit ihren säulengestützten Fassaden und geschwungenen Dächern sind sie kaum voneinander zu unterscheiden. Am Kopfende erhebt sich eine protzige Pagode aus weißem Marmor mit blauem Dach, den Farben der KMT. Dutzende Stufen führen hinauf in die Haupthalle, und dort sitzt er, in Bronze gegossen, mehrere Meter groß und unwillentlich an den despektierlichen Spitznamen erinnernd, den der amerikanische General Stilwell ihm verpasst hat, sein verhasster Stabschef während des Kriegs gegen Japan: „Peanut“. Der kahle Kopf ähnelt tatsächlich einer Erdnuss, und statt richtungsweisend die Hand zu heben wie Mao Zedong auf fast allen Statuen, die es von ihm gibt, sitzt Chiang Kai-shek mit angelegten Armen auf einem Sessel und wirkt wie ein gütiger Landesvater, der würdige Nachfolger seines Förderers Sun Yat-sen. In der Erzählung der KMT war Chiang der Garant des Überlebens der chinesischen Republik, ein kluger Stratege in Kriegszeiten und später der Initiator des taiwanischen Wirtschaftswunders. Westliche Beobachter zeichnen meist ein anderes Bild. In Barbara Tuchmans allerdings einseitigem Buch Stilwell and the American Experience in China gibt Chiang Kai-shek das Musterbeispiel des orientalischen Despoten ab, paranoid, selbstherrlich und realitätsblind. In seiner Jugend war er bekanntlich in die dunklen Geschäfte der Shanghaier Unterwelt verstrickt, aber der Ausstellung im Inneren der Pagode zufolge bestand sein Leben aus nichts als Triumphen – was die Frage heraufbeschwört, weshalb sein Memorial in Taipei steht und nicht in Nanjing, der verfassungsmäßigen Hauptstadt der Republik China (übrigens bis heute), wo Sun Yat-sen begraben liegt. Das demütigende Kapitel der Flucht auf die kleine Insel wird einfach übergangen.
Das auf den ersten Blick so sichere, wie in Stein gemeißelte Selbstbild der KMT hat am Ende des 20. Jahrhunderts längst Risse bekommen. Jahrzehntelang war der Bevölkerung auf der Insel eingetrichtert worden, der Rückzug nach Taiwan sei strategischer Natur und diene der Vorbereitung der kurz bevorstehenden „Rückeroberung des Festlands“. In den Fünfziger- und Sechzigerjahren stand dieser Slogan auf unzähligen Hauswänden und in jedem Schulbuch, aber glaubwürdig war er schon damals nicht, und mit dem Tod Chiang Kai-sheks verschwand er aus dem Straßenbild wie aus der offiziellen Rhetorik. Danach klammerte sich die KMT an die Gewissheit, das bessere China zu sein, dessen Erbe es zu bewahren galt – ein bereits eher konservatives als visionäres Selbstbild, an dem der wirtschaftliche Aufstieg der Volksrepublik bald zu nagen begann. Außerdem hat in den letzten zwei Jahrzehnten hier in Taiwan eine andere Erzählung Gestalt angenommen, erst im politischen Untergrund, aber mit der fortschreitenden Öffnung der Gesellschaft tritt auch sie offener hervor. 1996 stellt die KMT zwar noch den Präsidenten, sogar demokratisch legitimiert, aber der Bürgermeister von Taipei gehört der oppositionellen DPP (Democratic Progressive Party) an. Als ich vom Memorial zum Präsidentenpalast gehe, kann ich erste Spuren des sich vollziehenden Umschwungs besichtigen. Der Palast stammt aus der Kolonialzeit und war früher der Sitz des japanischen Generalgouverneurs, das Straßenstück davor wurde nach dem Abzug der Japaner umbenannt in „Lang-lebe-Chiang-Kai-shek-Straße“. Auf Chinesisch umfasst dieses Wortungetüm nur drei Zeichen, aber im März 1996 kam die nächste Umbenennung, und seitdem hat der Name sechs Zeichen und lautet Ketagalan-Boulevard. Das klingt überhaupt nicht chinesisch, denn der Name bezeichnet einen Ureinwohnerstamm, der lange vor den chinesischen Siedlern die Ebene bewohnt hat, in der das heutige Taipei liegt. Man muss das als politische Botschaft verstehen, beinahe als Kampfansage: Es gibt etwas, das auf dieser Insel tiefere Wurzeln hat und deshalb länger leben wird als die Erinnerung an einen chinesischen Diktator.
Es ist ein tolles Stück historisch und politisch aufgeladener Architektur: Am einen Ende des Boulevards der von den Japanern erbaute Präsidentenpalast, am anderen die Parteizentrale der KMT, ein unansehnlicher Zweckbau mit zwei vorstehenden Mauern, die den Hof einfassen und wie steinerne Greifarme auf den Palast gerichtet sind – unverfrorener kann man seinen Machtanspruch nicht symbolisieren. Dank des widerspenstigen Bürgermeisters führt der Weg vom Partei- zum Machtzentrum allerdings über eine Straße, die denen gewidmet ist, die schon vor den Chinesen hier waren, und verweist auf die Möglichkeit eines anderen, nicht chinesischen Taiwan. Dass Bürgermeister Chen Shui-bian vier Jahre später selbst in den Präsidentenpalast einziehen wird, davon träumen KMT-Kader im Frühjahr 1996 auch in ihren wildesten Albträumen nicht.
„Hitlers größter Fehler“
Eine Woche verbringe ich in Taipei, bevor ich zurück nach Hongkong fliege. Der Eindruck, den ich mitnehme, ist so tief, dass ich bereits kurz nach der Rückkehr nach Deutschland einen Antrag beim DAAD stelle: zwölf Monate Sprachstudium am Mandarin Training Center der Pädagogischen Hochschule Taiwans. Der Antrag wird bewilligt, und im Spätsommer 1997 bin ich wieder in der Stadt. An der Xinhai Lu – der Straße der Revolution von 1911 – beziehe ich ein kleines Häuschen auf dem Dach eines Hochhauses. Solche meist illegal errichteten Wohneinheiten sind in Taipei keine Seltenheit. Jeden Abend schaue ich von dort auf den rötlichen Nebel über der Stadt und wüsste keinen Ort, an dem ich lieber wäre. Bald habe ich eine amerikanische Freundin und einen internationalen, hauptsächlich aus anderen Sprachstudenten bestehenden Bekanntenkreis. In Nanjing gab es nur wenige Möglichkeiten, abends auszugehen, jetzt ist das Angebot größer. Fortyfive, Roxy Plus, Spin und Brown Sugar heißen beliebte Treffpunkte, außerdem gibt es in diesen Jahren vor Taiwans WTO-Beitritt, als geistiges Eigentum noch allen gehört, sogenannte „MTVs“: Videotheken mit eigenen Vorführräumen, wo man sich einen Film aussucht und eine der winzigen Kabinen zugewiesen bekommt, die mit dünnen Holzwänden voneinander getrennt sind, sodass man außer dem eigenen Film auch mitbekommt, was nebenan geschaut wird – oder was das studentische Publikum sonst tut, wozu in den Vier- und Sechsbettzimmern der Wohnheime keine Gelegenheit besteht.
Das politische Leben Taiwans verfolge ich in diesem Jahr nicht besonders aufmerksam, dafür entwickle ich allmählich ein Ohr für die verschiedenen Dialekte und Zungenschläge, die mir auf der Straße auffallen. Taipei ist das politische und wirtschaftliche Zentrum der Insel und die „chinesischste“ Stadt Taiwans, viele Bewohner sind erst während des Bürgerkriegs hierher geflohen. Taiwanisch – bzw. Minnanhua, den Dialekt, der auch in einigen Küstenregionen des Festlands gesprochen wird – hört man relativ selten, dafür wird die Bandbreite an Dialekten umso größer, je älter die Menschen sind. Am größten scheint sie bei den Veteranen zu sein, die vor Teestuben und Nudelküchen sitzen und augenscheinlich nichts zu tun haben. Viele von ihnen sind in jungen Jahren mit nichts als ihrer Kleidung am Leib nach Taiwan gekommen, abgeschnitten von den Familien, die auf dem Festland zurückblieben. Jahrzehntelang gab es nicht einmal Post- oder Telefonverbindungen, das Reiseverbot wurde erst 1987 aufgehoben. Nicht wenige dieser Männer haben sich als Teenager von Eltern und Geschwistern verabschiedet und sie, wenn überhaupt, als
Ruheständler wiedergesehen.
Einmal, als ich in einer kleinen Nudelküche Guotie esse – gefüllte gebratene Teigtaschen –, setzt sich ein weißhaariger Mann zu mir und fragt ohne Umschweife, woher ich komme. Sein Tonfall klingt, als hätte ich mich in sein Haus geschlichen und müsste ihm nun Rede und Antwort stehen. Zur dunklen Hose trägt er ein verwaschenes weißes Unterhemd, den Akzent verstehe ich nur, weil ich während des Studiums in China ein kurzes Praktikum in Peking absolviert habe; jedes zweite Wort endet in einem gutturalen Laut, der einem breit gerollten texanischen r ähnelt. Meine Antwort nimmt er nickend zur Kenntnis, dann hebt er den Zeigefinger und sagt, was er einem jungen Deutschen offenbar schon immer mal sagen wollte: „Weißt du, was Hitlers größter Fehler war?“
Ich hätte eine Antwort, bin aber gespannt auf seine. „Nein, keine Ahnung.“
„Dass er sich mit England eingelassen hat. Das hat ihm das Genick gebrochen. Mit diesem Churchill ist nicht zu spaßen.“
Über Hitler lerne ich in den folgenden Minuten nichts Neues, beginne aber zu ahnen, welche geistige Welt meinen Gesprächspartner fünfzig Jahre nach Kriegsende noch immer gefangen hält. Sein Auftreten legt nahe, dass er zur Schicht der Herrschenden gehört, aber die Kleidung verrät seinen tatsächlichen Status. An manchen Orten der Stadt gibt es regelrechte Slums, wo alte Armeeangehörige in Blechhütten und Verschlägen leben; Entwurzelte, die in Taiwan nie Fuß gefasst haben und die jetzt, da sich der politische Wind zu drehen beginnt, vollends den Boden unter den Füßen verlieren. Alles, was ihnen bleibt, ist die Erinnerung an eine untergegangene Welt, die ihnen zwar übel mitgespielt hat, die sie aber immerhin zu verstehen glaubten.
Einer meiner Sprachlehrer an der Uni gehört ebenfalls zu dieser Generation. Herr Hsu wurde als junger Mann zum Kriegsdienst gezwungen und kam nach dem Krieg allein nach Taiwan. Lange Zeit hat er sich mit Jobs über Wasser gehalten, die keinen Anspruch auf eine Rente begründeten, also muss er mit über siebzig Jahren noch jeden Tag mit dem Bus von Keelung nach Taipei fahren, was eine Stunde dauert, und uns Ausländern Chinesisch beibringen. Manchmal löst sich sein Blick vom Lehrbuch, und er beginnt übergangslos von früher zu sprechen. Der Shandong-Dialekt, den er sonst didaktisch sinnvoll zu unterdrücken versucht, wird immer stärker, bis wir Studierende nur noch Bruchstücke verstehen. Niemand wagt es, ihn zu unterbrechen, alle warten auf den erlösenden Gong. Dann kehrt Herr Hsu in die Gegenwart zurück, nickt ein paarmal vor sich hin und sagt: „So viel für heute. Bis morgen.“
Irgendwann ist auch dieses Jahr vorbei, und ich fliege zurück nach Deutschland, um in Berlin mein Studium abzuschließen. Nach dem Magister folgt ein einjähriger Aufenthalt in Tokio, der mich oft an die Zeit in Taiwan erinnert. Viele Kommilitonen an der Waseda Universität kommen von dort und finden es interessant, in Japan auf einen Deutschen zu stoßen, mit dem sie Chinesisch sprechen können. Je besser ich das Land kennenlerne, desto mehr Gemeinsamkeiten mit Japans früherer Kolonie fallen mir auf. Abends sitze ich in meiner kleinen Wohnung in Shinjuku und schaue Baseball im Fernsehen; ein Sport, in den Japaner und Taiwaner gleichermaßen vernarrt sind und den ich zwar nicht verstehe, aber auf den wenigen Kanälen meines Geräts kommt oft nichts anderes. Dass Baseball eins der wichtigsten Geschenke der Kolonialzeit ist, anhand dessen man die gesamte Mentalitätsgeschichte Taiwans im 20. Jahrhundert erzählen kann, weiß ich zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Auf das Jahr in Tokio folgt die Promotion in Berlin. Kurz nachdem ich im Sommer 2004 auch die abgeschlossen habe, besuche ich, wie es sich für einen frischgebackenen Doktor der Philosophie gehört, zum ersten Mal ein Jobcenter – so heißen die Arbeitsämter inzwischen. Ein Antrag auf Hartz IV war in meinem Lebensentwurf zwar nicht vorgesehen, aber man soll ja flexibel sein. Gewöhnt an schwer zu vermittelnde Fälle, fragt die Beraterin als Erstes: „Wie sieht’s denn aus, haben wir zumindest eine abgeschlossene Schulausbildung?“
Da muss ich kurz schlucken. „Ich schon“, murmle ich schließlich verstimmt.
Schlagartig wird mir klar, dass ich in Deutschland vorerst keine Zukunft habe und erneut die Koffer packen muss. Wohin diesmal? Der letzte Aufenthalt in Taiwan liegt sechs Jahre zurück, trotzdem ist es eine naheliegende Wahl. Ich verfüge über (bescheidene) akademische Kontakte und weiß, dass Fragen der Interkulturalität, die mich als Philosoph interessieren, an taiwanischen Universitäten zum Mainstream gehören, anders als in Deutschland. Also los!
Die wilden Jahre der taiwanischen Demokratie
Anfang 2005 bin ich zurück in Taipei und staune über die Veränderungen. Dank eines neuen U-Bahn-Systems ist die Luft deutlich besser als früher, außerdem gibt es ein neues Wahrzeichen, das nach der Anzahl seiner Stockwerke benannte 101-Hochhaus im Osten der Stadt. Drum herum wurde ein ganzes Stadtviertel aus dem Boden gestampft, mit Shoppingmalls und glitzernden Fassaden, so als wollte Taipei mit dem rastlosen Wandel auf dem chinesischen Festland konkurrieren. Politisch allerdings entwickeln sich die Dinge in eine ganz eigene Richtung. Zum ersten Mal hat Taiwan einen Präsidenten, der nicht der KMT angehört. Chen Shui-bian, der ehemalige Bürgermeister von Taipei, ist seit seiner Wahl darum bemüht, dem Land eine neue Identität zu geben, gegen den erbitterten Widerstand der alten Elite. Da die KMT die Mehrheit im Parlament stellt und sich auf einen Beamtenapparat verlassen kann, der ihr treu ergeben ist, bleibt es häufig bei Symbolpolitik. Überall auf der Insel werden Statuen von Chiang Kai-shek abgebaut, nach ihm benannte Parks und öffentliche Plätze erhalten neue Namen. Andere Maßnahmen reichen tiefer und sind darauf angelegt, ihre Wirkung mit der Zeit zu entfalten. Schulbücher werden umgeschrieben, das Taiwanische erscheint auf dem Lehrplan, die Kultur der Ureinwohner findet ungewohnte Beachtung, kurz: Alles, was in Taiwan nicht chinesisch ist, erfreut sich neuer Wertschätzung. Allerdings ruft jede dieser Maßnahmen Proteste hervor, Schmähungen in der KMT-treuen Presse und hitzige Parlamentsdebatten, die manchmal zu Raufereien ausarten. Chens Amtszeit dauert von 2000 bis 2008, es sind die wilden Jahre der taiwanischen Demokratie. Der eiserne Griff der Diktatur hat sich gelöst, und zum Vorschein kommt ein tief gespaltenes Land.
Mein Leben ist davon nicht direkt betroffen. Als Postdoc arbeite ich in diesen Jahren an verschiedenen Universitäten und Forschungseinrichtungen, hangle mich von einem befristeten Vertrag zum nächsten, halte Vorträge, schreibe Aufsätze und muss gelegentlich als Dozent aushelfen – kein Vergnügen, da alle Studierenden die Unterrichtssprache besser beherrschen als ich. Zeitweise liegt mein Büro in einem alten Backsteingebäude der National Taiwan University, von den Japanern als Kaiserliche Hochschule Taihoku (Taipei) gegründet, und ab und zu besuche ich Konferenzen an der Academia Sinica, dem Top-Forschungsinstitut des Landes, das im Zuge der großen Flucht während des Bürgerkriegs nach Taiwan verlegt wurde. Wie geschichtsträchtig diese Orte sind, ist mir kaum bewusst, ich habe andere Dinge im Kopf. Nachts und am Wochenende schreibe ich einen Roman namens Grenzgang, der – wo sonst? – in Oberhessen spielt und mit meinem taiwanischen Umfeld nicht das Geringste zu tun hat. Hinsichtlich der politischen Auseinandersetzungen jener Jahre bin ich Zuschauer, allerdings mit Logenplatz.
Meine Wohnung liegt an der Ren’ai Lu, der achtspurigen, von Palmen gesäumten Achse, die vom Präsidentenpalast zum Rathaus führt. Gegen Ende von Chens Amtszeit wird beinahe jedes Wochenende für oder gegen ihn demonstriert, und immer ziehen die Massen direkt vor meinem Haus vorbei. Mal dominieren die blauen Fahnen der KMT, mal die grünen von der DPP, deren Unterstützer in riesigen Buskonvois aus dem Süden der Insel anreisen. Einige Male marschiere ich mit, zum Beispiel, um gegen das sogenannte Anti-Sezessions-Gesetz zu protestieren, mit dem das Regime in Peking die rechtliche Grundlage für eine militärische Intervention in Taiwan legen will. Offenbar bekommt man in China mit, dass auf der anderen Seite der Taiwanstraße die Zeichen nicht auf Wiedervereinigung stehen; unter Chen Shui-bian weniger denn je.
Der Mann ist Anwalt und ein Kind der lange Zeit illega-
len Bürgerrechtsbewegung. Was bei uns früher APO hieß, formierte sich in Taiwan als Dangwai, wörtlich „außerhalb der Partei“, womit die KMT als einzige zugelassene Partei gemeint war. Bekannt wurde Chen als Verteidiger im sogenannten Kaohsiung-Zwischenfall, dem letzten großen politischen Prozess, mit dem 1980 die demokratische Opposition mundtot gemacht werden sollte. So wie mehrere seiner Mitstreiter saß er zwischenzeitlich selbst im Gefängnis, allerdings nur einige Monate. Aus dem Süden der Insel stammend, spricht er lieber Taiwanisch als Chinesisch und konnte nur Präsident werden, weil sich das gegnerische Lager zerstritt und zwei Kandidaten aufstellte, die einander Stimmen wegnahmen. Bei taiwanischen Präsidentschaftswahlen gilt die einfache Mehrheit, und Chen bekam 39 Prozent.
Für die alte Elite war die Wahl ein Schock. Zögerlich hatte sich die KMT auf den Pfad der Demokratisierung begeben, um ihrer Herrschaft Legitimation zu verleihen und internationale Anerkennung zu erlangen – aber doch nicht, um die Macht zu verlieren! 2004 wurde Chen mit hauchdünner Mehrheit wiedergewählt, nachdem es am Abend vor der Wahl einen Attentatsversuch auf ihn gegeben hatte, von dem die KMT bis heute behauptet, er sei von ihm selbst inszeniert worden. Die Umstände sind mysteriös genug, der mutmaßliche Täter wurde später tot aufgefunden, aber ob er sich selbst umgebracht hat oder ermordet wurde, konnte nie geklärt werden. Spätestens mit dieser Wahl betrachtete die KMT die Präsidentschaft Chens als illegitim und ergriff jede Möglichkeit, um seine Politik durch ihren Beamtenapparat und die eigene Mehrheit im Parlament zu torpedieren. Ohnehin verfügte die DPP, die jahrzehntelang von den Schaltstellen der Macht ausgeschlossen gewesen war, nicht über genügend Experten und war intern zerstritten über die Frage, wie offensiv sie das Ziel der taiwanischen Unabhängigkeit angehen sollte. Darin nämlich bestand das Kernanliegen der Partei, dessen Umsetzung jedoch bis auf Weiteres eine außenpolitische und diplomatische Unmöglichkeit darstellt.
Manchmal, wenn ich vom Dach aus den Demonstrationen zusehe, leistet meine Vermieterin mir Gesellschaft. Als über achtzigjährige Dame, die noch in der Kolonialzeit zur Schule gegangen ist und besser Japanisch als Chinesisch, am liebsten aber Taiwanisch spricht, trägt sie im Freien stets einen Sonnenhut mit dem Konterfei des Präsidenten. Dass er für sie ein Held ist, hat weniger mit bestimmten politischen Maßnahmen zu tun als mit dem, wofür er als Person steht: den Kampf gegen die Alleinherrschaft der KMT und für ein Taiwan, das nicht das bessere China sein will, sondern ein demokratisches, im Idealfall unabhängiges Land. Für alles, was dem Präsidenten nicht gelingt, hat sie eine bündige Erklärung: Die KMT lässt ihn nicht.
Chen Shui-bians zweite Amtszeit ist ein einziger Tumult. Es gibt Korruptionsvorwürfe und Verfahren gegen enge Vertraute, Rücktrittsforderungen werden nicht nur vom politischen Gegner erhoben, sondern auch von ehemaligen Weggefährten, und zeitweise wachsen sich die Massenproteste zu einer regelrechten Belagerung des Präsidentenpalasts aus. Kaum hat Chen diesen verlassen und seine Immunität verloren, wird er wegen Korruption und Amtsmissbrauch angeklagt. Seine Anhänger sprechen noch heute von einem politischen Prozess, einem Racheakt der KMT, die bei der nächsten Wahl mit großer Mehrheit die Macht zurückerobert. Als ich Taiwan im Frühsommer 2011 verlasse – wieder nur vorübergehend, wie sich bald zeigen sollte –, sitzt der frühere Anwalt im Gefängnis. Das traurige Ende einer beachtlichen und sehr taiwanischen Karriere.
„Die 224 Seiten haben es in sich.“
„Die Gebrauchsanweisung ist eine hervorragende Einführung, die immer wieder zurückkehrt zu Thomes eigener Annäherung an das Land.“
„Thome erzählt kundig und unterhaltsam von seiner Liebe zum geschichtsträchtigen Inselstaat im Pazifik. Und die spürt man in jeder Zeile.“
„Das Buch ist sehr persönlich verfasst und darüber hinaus sehr aktuell.“
„Stephan Thomes Buch steckt voller faszinierender historischer Pointen.“
„Der studierte Sinologe, Religionswissenschaftler und Philosoph schlägt hier interessante Brücken zu Kultur, Weltansicht und Geschichte und verbindet diese mit seinen ganz persönlichen Erlebnissen und Eindrücken vor Ort.“
„Mit viel Einfühlungsvermögen bringt uns der Autor seine Wahlheimat mit all ihren Marotten näher. Absolut lesenswert!“
„Mit leichter Feder und auf dem neuesten Informationsstand fesselnd beschrieben.“
„Dieses wunderbare Buch des ausgewiesenen Taiwan-Kenners ist ebenso unterhaltend wie informativ, ein Lesevergnügen und jedem zur Vorbereitung zu empfehlen, der eine Reise auf diesen herrlichen Inselstaat plant.“










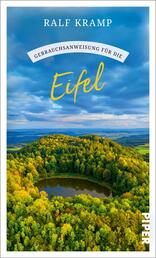

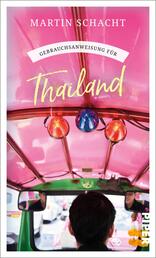
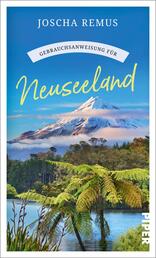

















DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.