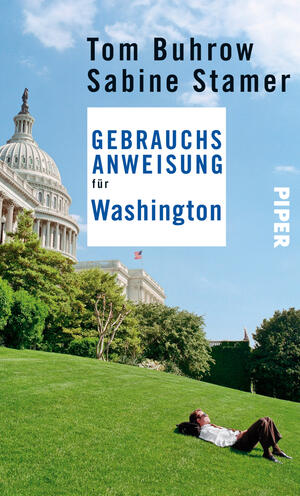
Gebrauchsanweisung für Washington - eBook-Ausgabe
„Ein erfrischendes Porträt über eine Stadt, die mehr zu bieten hat, als die Allgemeinheit glaubt.“ - Westfälische Nachrichten
Gebrauchsanweisung für Washington — Inhalt
Washington ist das Zentrum der Macht. Hier denken sich Strategen, Berater und Lobbyisten Weltpolitik aus und setzen sie um. Washington ist aber auch die familienfreundlichste Metropole der USA und kultiviert ihre grüne Seite. Zehn Jahre lang war sie die Heimat von „Tagesthemen “-Moderator Tom Buhrow und seiner Frau Sabine Stamer. Hier haben sie ihre Kinder bekommen, von Wahlkampf und Affären im Weißen Haus berichtet, vor dem Kapitol gepicknickt und Hamsterkäufe vor Schneestürmen mitgemacht. Sie entschlüsseln Tischmanieren und Konversationsregeln; verraten, was sich hinter dem „G-word“ verbirgt und was nach Thanksgiving montags passiert. Warum „D.C.“ als Zusatz so wichtig und ein weißer Bürgermeister hier undenkbar ist.
Leseprobe zu „Gebrauchsanweisung für Washington“
Diissii im Aufwind
Ode an die Stadt, die zehn Jahre lang unsere Heimat war
Washington D. C. ist staatstragend und rebellisch, ernst und leicht, ehrwürdig und funky, sicherheitsfanatisch und locker, historisch und futuristisch, kulturell und kultig, bieder und cool. Die Stadt hat seit ihrer Gründung die Aufgabe, Widersprüche in sich zu vereinen. Sie gehört zu den Nordstaaten ebenso wie zu den Südstaaten. Das merkt man schon am Wetter: tropisch heiß und feucht im Sommer, manchmal auch südlich milde Winter, nicht selten aber auch nördlich kalt mit [...]
Diissii im Aufwind
Ode an die Stadt, die zehn Jahre lang unsere Heimat war
Washington D. C. ist staatstragend und rebellisch, ernst und leicht, ehrwürdig und funky, sicherheitsfanatisch und locker, historisch und futuristisch, kulturell und kultig, bieder und cool. Die Stadt hat seit ihrer Gründung die Aufgabe, Widersprüche in sich zu vereinen. Sie gehört zu den Nordstaaten ebenso wie zu den Südstaaten. Das merkt man schon am Wetter: tropisch heiß und feucht im Sommer, manchmal auch südlich milde Winter, nicht selten aber auch nördlich kalt mit Schneebergen und Glatteis. Washington ist aufregend und entspannend, eine Metropole mit ländlicher Idylle, politisches Hauptquartier mit exotischen Nischen. Es entwickelt und verändert sich seit Beginn der 1990er-Jahre in Riesensprüngen.
Deutsche Touristen stellen sich Washington oft ein bisschen vor wie die frühere deutsche Hauptstadt Bonn: etwas verschlafen und provinziell, viel trockene Politik, wenig pralles Leben. Wenn uns Freunde besuchten, so stellten sie am Ende ihres Aufenthaltes häufig fest: „Eigentlich sind wir nur euretwegen nach Washington gereist, aber nachdem wir die Stadt gesehen haben, wollen wir unbedingt wiederkommen.“ Washington hatte schon immer mehr zu bieten als Büros, Politik und Business. Wir lieben diese Stadt, natürlich: Wir haben hier unsere Familie gegründet, unsere Töchter sind hier geboren, unsere kleinen – inzwischen großen – Amerikanerinnen.
Wir haben zehn wunderbare Jahre hier verbracht, eine andere Kultur kennengelernt, mit unserer deutschen und der europäischen so verwandt – und doch so anders. Wir haben Herausforderungen bestanden, zu Hause und auf Reisen, beruflich und privat. Wir haben viele neue Freunde gewonnen, alteingesessene Washingtonians und solche, die – wie wir – von Arbeit, Politik oder der Liebe für ein paar Jahre in die Stadt gespült wurden. Wir kennen nur wenige, die gerne gegangen sind. Natürlich nicht, denn Washington ist eine wunderbare Stadt : abwechslungsreich, quirlig hier und beschaulich dort.
Wir haben die reichen und die armen Viertel dieser Stadt kennengelernt, die Schulen und die Krankenhäuser, die ausgedehnten Parks und die bunten Märkte, die Restaurants und die Bars, die großen Einkaufszentren und die vielen Sehenswürdigkeiten, Galerien und Museen jeder Art. Wir sind durch den Dumbarton Oaks Park spaziert: im Frühling ein Meer von Tulpen, im Sommer Rosen, im Herbst Astern in üppiger Pracht. Über den Eastern Market sind wir gern gebummelt, haben die leckeren Spezialitäten unterschiedlichster Herkunft probiert. Die Ausstellungen in der Phillips Collection, einer privat geführten Galerie, waren immer einen Besuch wert, nicht nur wegen der phantastischen Bilder großer Impressionisten, sondern auch wegen der angenehm entspannten Atmosphäre. Man muss keine Kinder in Washington geboren oder länger dort gelebt haben, um diese Stadt zu lieben. Denn alles ist möglich in der Hauptstadt der Vereinigten Staaten! Sie hält für jeden etwas bereit. Viel Grün zum Joggen, Radeln oder Skaten, viel Wasser zum Bootfahren oder Angeln. Musikbegeisterte finden Jazzkeller, Blueskneipen oder Sinfoniekonzerte, ganz nach Belieben.
Verließen wir das ARD-Studio in Georgetown durch die Hintertür, landeten wir geradewegs in einer schmalen Gasse. Hier zwischen hupenden Lieferwagen, die sich gegenseitig blockierten, und überlaufenden Müllcontainern, die unappetitliche Gerüche verbreiteten, befand sich der Eingang der Blues Alley, eines berühmten Blues- und Jazzclubs mit großer Tradition. Geduldig warten die oft fein gekleideten Besucher in der düsteren Seitenstraße abends auf den Einlass. Verließen wir das Studio durch den Vordereingang in der M Street, konnten wir direkt in einen Bus einsteigen, der uns in zehn Minuten zum Kennedy Center brachte, wo von Opern über Sinfoniekonzerte bis zur Experimentalmusik jeden Abend etwas anderes geboten wird. Nicht nur Musikfans, auch Technik- oder Kunstliebhaber, politisch oder historisch Interessierte, alle finden reichhaltiges geistiges Futter in Museen, die zum großen Teil nicht einmal Eintritt fordern. Mit der Library of Congress ist in D. C. zum Beispiel die Bibliothek mit den meisten Büchern der Welt beheimatet: einunddreißig Millionen Druckwerke in vierhundertsiebzig Sprachen, darunter die Gutenberg-Bibel und – eher ein Kuriosum – Adolf Hitlers Sammlung vom Obersalzberg, obendrein Millionen von Handschriften, Fotos und Karten, das alles verteilt auf drei Gebäude, eins davon ein palastartiger Renaissancebau mit marmorner Eingangshalle.
Auch was das Kulinarische angeht, hat die Stadt einiges vorzuweisen. Es gibt wohl kaum eine Nation der Erde, die nicht mit wenigstens einem Restaurant vertreten wäre. Aus Europa kommend, sollte man sich vor allem der amerikanischen Küche zuwenden, sei es der althergebrachten südamerikanischen Kost, wie sie im Georgia Brown’s serviert wird (die Clintons fühlten sich hier wohl), oder der New American Cuisine, modernen Menus mit multiethnischem Einschlag, wie sie zum Beispiel im Café Atlántico oder im Oval Room (von Condoleezza Rice bevorzugt) serviert werden. Die Politik sorgt nicht nur für viele graue Anzüge im Straßenbild Downtowns, sondern auch für ethnische Vielfalt auf allen Ebenen. Einrichtungen wie das Busboys and Poets befriedigen gleich rundherum alle Bedürfnisse auf einen Schlag: Es gibt Bücher, Lesungen und Diskussionen, CDs und Konzerte, obendrein Kaffee und was zu essen.
Die Amerikaner nennen ihre Hauptstadt nicht einfach Washington. Das würde nämlich zu zahlreichen Verwechslungen führen. Es gibt den Gründungsvater Washington, den Bundesstaat Washington im äußersten Nordwesten des Landes, mehrere Berge, Seen und Parks sowie mindestens fünfundzwanzig andere Städte in den USA, Kanada und England, die Washington heißen. Offensichtlich sind den Pionieren bei der Besiedelung des Landes auf die Schnelle nicht genügend Namen eingefallen. Deshalb ist es heute äußerst wichtig, den Städtenamen immer mit den Initialen für den jeweiligen Bundesstaat zu verbinden. D. C. für District of Columbia. Und so spricht man von der Hauptstadt gemeinhin: Diissii. Dann weiß jeder, was gemeint ist. Insider sagen zur Abwechslung auch: the District.
Die Washingtonians sind offen und höflich, immer bereit zu einem freundlichen Gespräch, obwohl sie, always busy, ständig unter Zeitdruck stehen. „How do you like D. C.?“ ist eine der meistgestellten Fragen, kommt gleich nach „How are you?“ und „Where do you come from?“ Amerikaner sind Meister des Small Talks. Sie wissen schon als Kinder, wie man ein Gespräch beginnt. Als Antwort wird freilich keine ausgewogene Analyse erwartet. Es ist einfach eine Einladung, etwas Freundliches zu sagen. Wer die Frage zu ernst nimmt, ist schnell auf dem falschen Gleis, denn vieles dreht sich schlicht darum, Gelegenheiten zu schaffen, nett zueinander zu sein. Ob man nun auf die Frage nach dem Wohlbefinden ein überschwängliches „Great! Wonderful! Couldn’t be better!“ parat hat, ein verhaltenes „Just doing fine“ oder gar mit einem „Hangin’ in there …“ andeutet, dass die Stimmung nicht auf dem Höhepunkt ist – auf das Lächeln kommt es an und darauf, dass man überhaupt etwas sagt. Dass man signalisiert: Ich sehe dich, ich bin dir freundlich gesinnt. Es mag nicht mein bester Tag sein, aber mit dir hat das schließlich nichts zu tun. Natürlich darf man, bei einer Freundin oder einem guten Bekannten, auch durchaus mal von Sorgen und Ärger berichten und wird sicherlich auf Mitgefühl stoßen: „Oooh, that’s too bad!“ Doch wird das amerikanische Gegenüber eher früher als später eine Wende zum Positiven finden, den Blick nach vorne richten oder einfach zu einem anderen Thema übergehen.
So begann auch unsere Amerika-Zeit gleich auf dem Flughafen in Washington/Dulles mit dem Austausch von Nettigkeiten. Das war im Frühjahr 1994, lange vor den Anschlägen des 11. September 2001, in den USA meist nur kurz Nine Eleven genannt. „Was ist der Zweck Ihres Aufenthaltes?“, fragte die Dame von der Einwanderungsbehörde und war mindestens ebenso begeistert wie wir, dass Tom als Korrespondent für einen deutschen Fernsehsender nach Washington versetzt wurde: „That is wonderful!“ Der Beamtin stand das Entzücken ins Gesicht geschrieben. In Diissii zu leben – das muss ja wohl das Größte sein, das einem passieren kann. Heute sind die meisten Kontrolleure der Einwanderungsbehörde reservierter und vollauf damit beschäftigt, jedem Ausländer Fingerabdrücke und Fotos abzuverlangen. Nine Eleven hat das Leben hier sehr verändert. Fast ungehindert ließen sich früher jene bedeutungsvollen Orte besuchen, an denen weltpolitische Entscheidungen getroffen wurden. Einfach Geduld haben, anstehen und dann nach einer kurzen Taschenkontrolle durchs Weiße Haus oder das Pentagon zu streifen, das geht leider nicht mehr. Die Sicherheitsstandards wurden angehoben. Zum Glück hat sich aber die patriotische Bunkermentalität, die sich nach den Anschlägen zunächst breitmachte, weitgehend verflüchtigt.
Washington ist viergeteilt, ausgehend vom Kapitol. Wo der Mittelpunkt durch einen Stern im Boden markiert ist. Von hier aus trennt sich das Terrain in vier Quadranten: Nordwest (NW ), Nordost (NE ), Südwest (SW ) und Südost (SE ). Dabei bildet der Nordwesten den bedeutendsten Bezirk: Hier befinden sich die meisten Büros, Geschäfte und Sehenswürdigkeiten, Restaurants und Hotels, das Weiße Haus und die besseren Wohngegenden. Für Ortsfremde ist es nicht besonders schwierig, sich zurechtzufinden, denn die Stadtplaner haben einfach in regelmäßigen Abständen waagerechte und senkrechte Linien aufs Papier gebracht und dann – vielleicht damit es nicht allzu eintönig wirkt – ein paar dicke Diagonalen dazwischen gezogen. Die von Nord nach Süd verlaufenden Straßen wurden nummeriert (First, Second Street etc.), während die von Ost nach West gehenden nach dem Alphabet benannt sind (A Street, B Street etc.). Nur die Diagonalen (nach und nach auch ein paar andere Straßen) bekamen richtige Namen. Auch hier mangelte es wohl in den Anfängen der Neuen Welt an bedeutenden Persönlichkeiten, die es verdient hätten, als Namensgeber zu fungieren. Ebenso wie es wichtig ist, einen Städtenamen mit dem entsprechenden Bundesstaat zu verbinden, muss man unbedingt dazu sagen, ob man die P Street, NW, oder die P Street, SE, meint. Dazwischen könnten nämlich ein Dutzend Kilometer oder gar mehr liegen. Einmal abgesehen davon, dass der Southeast mit Northwest so gut wie gar nichts gemeinsam hat außer Straßennamen. Aber dazu später mehr.
Im Mittelpunkt – und das gilt sowohl geografisch, als auch sozial und politisch – liegt die National Mall. Das ist nicht, um eventuellen Missverständnissen vorzubeugen, das zentrale nationale Einkaufszentrum.1 Die Mall ist eine fünf Kilometer lange Rasenfläche, sandwiched (wie die Washingtonians das so praktisch ausdrücken) zwischen der Constitution und der Independence Avenue, flankiert von Museen und Denkmälern, belagert von Hotdog-Ständen und T-Shirt-Verkäufern. Die National Mall ist das Herz der Stadt, in gewissem Sinne sogar das Herz der Nation. Sie ist ein populäres Ziel für Stadtbesichtigungen und Schulausflüge ebenso wie für Lunch-Pausen, sie wird angesteuert von Touristen, Schulklassen und Demonstranten. Sie ist das Feld für Massenveranstaltungen.
Der wohl größte Andrang herrschte hier an einem sehr kalten Tag im Januar 2009. Eine riesige Menge strömte herbei, um der Amtseinführung des 44. Präsidenten, Barack Obama, beizuwohnen. So viele Menschen hatten sich niemals zuvor auf der National Mall versammelt. Mit der Parole „Yes, we can!“ hatte zum ersten Mal ein Schwarzer den Wahlkampf gewonnen. Ein historisches Ereignis, dem zwischen achthundertfünfzigtausend und knapp zwei Millionen Menschen (so die Schätzungen) beiwohnen wollten. Fast ein halbes Jahrhundert zuvor hatte hier ein anderer Mann eine weltbekannte Rede gehalten: Martin Luther King, Führer der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, verkündete zum Abschluss des March on Washington vor zweihundertfünfzigtausend Demonstrantinnen und Demonstranten zu Füßen des Lincoln Memorial: „I have a dream …“ Da war Barack Obama erst zwei Jahre alt. Nun ist mit ihm ein Teil dieses Traums von der Gleichberechtigung wahr geworden.
Auf der National Mall finden sich die politischen Kräfte der Nation, die etablierten und die protestierenden. Besucher gewinnen von hier aus den ersten Überblick über die fremde Stadt. Hier können sie sich treiben lassen, das Leben beobachten und dabei eine erste Ahnung davon bekommen, was Washington geprägt hat und heute ausmacht. Rund achthunderttausend erschienen 1995 zum Million Man March des umstrittenen Führers der Schwarzen-Organisation Nation of Islam, Louis Farrakhan, berühmt und berüchtigt für seine antisemitischen und sexistischen Sprüche. „Heute Morgen wissen eine Million schwarzer Frauen, wo sich ihre Männer befinden“, triumphierte eine Rednerin auf der Kundgebung. Na, wenn das kein Erfolg ist …! Fünf Jahre später versammelte sich eine halbe Million Frauen am Muttertag mit der Forderung nach strengeren Waffengesetzen, um ihre Kinder zu schützen. 1996 bedeckten dreihunderttausend Homosexuelle den gesamten linken Flügel des Rasens mit einem riesigen Quilt, einem typisch amerikanischen Flickenteppich. Fünfhunderttausend demonstrierten 1971 gegen den Vietnamkrieg, hunderttausend verlangten 2005 den Rückzug aus dem Irak: „Bring them home!“, skandierten sie.
Das Lincoln Memorial, das hinter dorischen Säulen den 16. Präsidenten in einer Art griechischem Tempel präsentiert, markiert das westliche Ende der Mall. Am Fuße des weißen Marmorthrons bleibt einem nichts anderes übrig, als ehrfürchtig zu Abraham Lincoln hinaufzuschauen. Sicherlich zu Recht, ist ihm doch zu verdanken, dass er die Vereinigten Staaten zusammengehalten hat, womit der Grundstein zum Aufstieg zur Weltmacht gelegt wurde. Aus der Mitte der langen Rasenfläche ragt ein Obelisk, das Washington Monument; es erinnert an die Anfänge, den ersten Präsidenten George Washington. Das Erdbeben im August 2011 hat einen Riss in der Spitze verursacht und eine vorübergehende Schließung erforderlich gemacht. Normalerweise führt ein Fahrstuhl hoch hinauf zur Aussichtsplattform, die einen phantastischen Rundblick ermöglicht. Hinaufklettern darf man nicht. „Climbing the 897 steps is verboten …“, stand in einem amerikanischen Reiseführer. Verbieten, das gilt hier als typisch deutsche Tätigkeit, so typisch, dass das deutsche Wort „verboten“ in die amerikanische Sprache eingegangen ist.
Am östlichen Ende der National Mall steht das Kapitol, überwacht von einem Hügel aus die Stadt. Hier wird der Wille des Volkes diskutiert und formuliert. Dieser honorigen Aufgabe zum Trotz lästern viele Washingtoner, es sehe aus wie eine Hochzeitstorte. Nichts darf in der amerikanischen Hauptstadt höher gebaut werden als das Kapitol, deshalb gibt es nur einen einzigen Wolkenkratzer, das Cairo Apartment Building in der Q Street in der Nähe des Dupont Circle. Mit seinen zwölf Stockwerken und fünfzig Metern Höhe scheint es für heutige Verhältnisse nicht gerade beeindruckend hoch. Als es 1894 erbaut wurde, erzielte es allerdings durchaus Wirkung, und zwar so nachdrücklich, dass der Kongress beschloss, die Höhe von Neubauten in der Stadt zu begrenzen. Hochhäuser gibt es daher nur in Rosslyn, am anderen Ufer des Potomac, direkt gegenüber von Georgetown. Das gehört nämlich zu Virginia und nicht zum District of Columbia.
Nicht nur Wolkenkratzer sind in Washington „verboten“, sondern auch eine Menge anderer Dinge, das haben wir schnell gelernt. Viele denken, im Land der unbegrenzten Freiheit dürfe jeder machen, was er will. In mancher Beziehung ist das auch so: Sie können in Washington viel unkomplizierter als in einer deutschen Stadt die Arbeitsstelle oder gar den Beruf wechseln, ein Unternehmen gründen, Leute einstellen, wieder entlassen, ein Haus bauen oder abreißen.
Mit der Zeit allerdings machten wir aber die Erfahrung, dass das freizügige Amerika doch recht viele Verhaltensmaßregeln für uns parat hält. Für den Umgang miteinander gibt es recht klare Regeln. Man mäht seinen Rasen. Man drängelt nicht, und wenn man aus Versehen jemandem zu nahe kommt, sagt man unbedingt: „Excuse me!“, auch wenn man ihn gar nicht berührt. Man schaut sich an, man grüßt sich oft, auch ohne einander zu kennen. Man trinkt keinen Alkohol auf der Straße, raucht nicht in geschlossenen Räumen und beachtet den Dresscode. Der Unterschied ist nicht, dass die Liste der Verbote hier kürzer wäre als in einem anderen Land. Aber eins fällt auf: Fast immer wird freundlich darauf hingewiesen. Na gut, wir reden hier nicht von Polizisten, die gerade einen Verdächtigen aufs Pflaster nageln. Kommen Sie besser nicht auf die Idee, mit einem Gesetzeshüter zu diskutieren, so nach dem Motto: „Aber Herr Officer, ich müsste ganz dringend nach links, könnten Sie nicht eine Ausnahme machen?“ Missachtung ihrer Anweisungen nehmen sie nicht mit Humor.
Die Stadt selbst ist eigentlich nicht groß, hat streng genommen nur rund sechshunderttausend Einwohner. Der Großraum Washington jedoch, der mehrere Landkreise der angrenzenden Staaten Maryland, Virginia und West Virginia umfasst, beherbergt wesentlich mehr: an die 5,5 Millionen Bewohner. Man spricht von der Washington Metropolitan Area, kurz Metro Area. Es ist der siebtgrößte Ballungsraum der Vereinigten Staaten. Wer ein engeres Gebiet bezeichnen, sich aber nicht an die offiziellen Grenzen des Distrikts halten möchte, sagt inside the beltway, womit das Terrain gemeint ist, das sich innerhalb der kreisförmigen Stadtautobahn befindet.
Wovon leben die Menschen hier? Sehr viele multinationale Unternehmen haben einen Sitz in der Gegend. Maryland gilt als Zentrum für Biotechnologie, Nord-Virginia als Hightech-Korridor. Auch die Rüstungsindustrie sucht die Nähe zur Hauptstadt. Im District of Columbia selbst ist die Bundesregierung der größte Arbeitgeber, gefolgt von Unternehmen, die auf verschiedenste Weise mit Regierung und Verwaltung verknüpft sind und dem politischen Apparat zuarbeiten. Auch der Tourismus ist ein wichtiger Faktor. Er schafft schätzungsweise sechsundsechzigtausend Arbeitsplätze in der Stadt.
Diissii hat sich aus vielen Gründen und in vielerlei Hinsicht in den letzten zwei Jahrzehnten sehr gewandelt. Nehmen wir als Beispiel Georgetown, ein sehr beliebtes und lebhaftes Viertel, mit charmanten townhouses, vielfältigen Restaurants und Boutiquen. Als wir 1994 dorthin zogen, standen auf den beiden Hauptstraßen, der Wisconsin Avenue und der M Street, viele Ladenlokale leer. Als wir sechs Jahre später wegzogen, war alles verpachtet und vermietet, der Boutiquenstrip auf der M Street zog sich mittlerweile bis hin zur Key Bridge. Bei unserer Rückkehr nach D. C. 2002 (nach einem knapp dreijährigen Intermezzo in Paris) war gar nicht daran zu denken, eine Wohnung oder ein Haus in Georgetown zu finden. Überhaupt war der Mietund Immobilienmarkt in den attraktiven Vierteln der Stadt wie leer gefegt, alles vergeben. Heute wiederum machen sich die Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise bemerkbar. Wieder stehen Gewerbeflächen leer, Mieter werden gesucht, Hinweise kleben in den Schaufenstern: „For rent“. Das sündhaft teure Antiquitätengeschäft in der O Street/Ecke Wisconsin Avenue ist verschwunden, mit ihm der Laden, der Accessoires fürs überspannte Luxus-Hündchen anbot.
Doch insgesamt gesehen hat Washington der Wirtschafts- und Finanzkrise beispielhaft getrotzt. Die Arbeitslosenquote liegt unter dem amerikanischen Durchschnitt. Tatsächlich verzeichneten die Preise für Wohnimmobilien sogar einen leichten Anstieg, während ringsum in weiten Teilen des Landes der Immobilienmarkt zusammenbrach. Kommerzielle Liegenschaften mussten leichte Einbußen hinnehmen, blieben aber vom katastrophalen Abwärtstrend verschont. Dazu haben Regierungsprogramme beigetragen, aber vor allem ist es der Attraktivität der Stadt zu verdanken. Auf der Suche nach neuem Wohnraum erobern Berufseinsteiger und junge Familien pionierartig Viertel der Stadt, in die sich lange kein „anständiger“ Bürger mehr getraut hat. Wo noch vor zehn Jahren Billigbier über vergitterte Verkaufstresen geschoben wurde, wird heute Latte macchiato serviert. Früher hätten wir unseren Freunden auf jeden Fall abgeraten, sich nach einem Besuch auf dem Eastern Market in der Umgebung umzuschauen. Zu gefährlich! Heute gibt es dort nette Cafés, im Sommer sitzen die Leute friedvoll und entspannt am Straßenrand. Das Viertel, Capitol Hill, hat sich zur beliebten Wohngegend für junge Familien entwickelt. Gefahrlos kann man Spaziergänge vorbei an hübsch restaurierten Häusern unternehmen und sich fühlen wie die Hauptfigur in einer kitschigen Novelle des Viktorianischen Zeitalters.
Die gentrification2 erobert die Stadt in rasendem Tempo. Trotz diverser Gegenmaßnahmen vertreibt dieser Prozess die Alteingesessenen, die sozial Schwächeren. Aber er vertreibt auch die Drogendealer und Einbrecher, bringt Farbe an die Hauswände, fegt den Schmutz von den Straßen, sorgt für Geschäfte, Wohnraum und Arbeitsplätze. Mit anderen Worten: Diese Entwicklung möbelt Stadtteile auf, die bisher in Trostlosigkeit und ohne Perspektive vor sich hin gammelten.
D. C. befindet sich im Aufwind. Es ziehen deutlich mehr Leute in die Stadt hinein als hinaus. Zum ersten Mal seit den 1940er-Jahren wurde die Sechshunderttausend-Marke wieder überschritten. Die neuen Bewohner sind im Durchschnitt zahlungskräftiger als jene, die weggehen. In Statistiken, die Einkommen, Bildung oder Lebenserwartung beziffern, rangiert Washington immer ganz oben. Washington Metropolitan Area gilt als das wohlhabendste Gebiet der Vereinigten Staaten. Auch bei Umfragen zur Lebensqualität nimmt Diissii immer Spitzenpositionen ein. Die Washingtonians haben die höchste Lebenserwartung im ganzen Land, gut dreiundachtzig Jahre. Das trifft aber nur für die weißen Einwohner zu. Ein Afroamerikaner in D. C. kann hoffen, einundsiebzig Jahre zu werden. Seine durchschnittliche Lebenserwartung beträgt elf Jahre weniger und ist so niedrig wie nirgendwo sonst im Land. Was für ein Gegensatz! Sehr nachdenklich stimmt auch, dass die Stadt die höchste Kindersterblichkeit der Nation aufweist. Ebenso gibt es zu denken, dass das statistisch hohe Bildungslevel offensichtlich nicht zu Hause erworben wurde. Der Distrikt kämpft mit einer sehr hohen Zahl an Schulschwänzern und Schulabbrechern. Diese Probleme finden sich fast ausschließlich in der schwarzen Bevölkerung der Stadt. Wettgemacht wird das durch viele Neuankömmlinge mit abgeschlossener Berufsausbildung und akademischem Grad.
Die Amerikaner wettern gerne über „die da in D. C.“, die vom Volk abgehobenen Machthaber. Jeder Kandidat für ein politisches Amt in der Hauptstadt stellt sich als vom Politklüngel unverdorbener Außenseiter dar. Schon die Gründungsväter wollten keine feste Elite. Nur in der Weite des Landes manifestiert sich nach dieser Lesart der unverdorbene Volkswille. Wer zu lange in Washington bleibe, sei verdorben, heißt es schon lange. Dann aber, einmal gewählt, entscheiden sich die meisten Politiker heute für ein Leben in Washington, haben sie auch vorher noch so laut auf die Zentrale geschimpft. Selbst nach Ablauf der Amtszeit kehren nur wenige in ihre Heimat zurück. So schlecht lebt es sich offensichtlich nicht in Diissii!
Jedes Jahr ziehen fünfzehn Millionen amerikanische Touristen nach Washington wie an einen Wallfahrtsort, um ihre Hauptstadt zu studieren und zu bewundern. Sie wollen sehen, wo ihr Präsident residiert, das Parlament tagt, oder beobachten, wie im Bureau of Engraving and Printing US-Dollars gedruckt werden. Sie erweisen John F. Kennedy die Ehre an seinem Grab auf dem Arlington National Cemetery. Sie bewundern frühere Präsidenten in Stein gemeißelt rund um die National Mall. Einem einzigen Nichtpräsidenten wurde nun auch die Ehre zuteil, auf der Mall als Denkmal verewigt zu werden, dem Bürgerrechtler Martin Luther King jr. Die von dem chinesischen Bildhauer Lei Yixin entworfene Anlage aus Granit symbolisiert die Leitideen der Bürgerrechtsbewegung: Gerechtigkeit, Demokratie und Hoffnung. Mit einem eigenen Museum hat sich unlängst auch eine andere bedeutende Minderheit einen zentralen Platz in der Hauptstadt reserviert: Das National Museum of the American Indian zeigt die Geschichte der indianischen Ureinwohner in einem markanten, kurvenreichen Natursandsteinbau.
Die Amerikaner sind stolz auf die Wahrzeichen ihrer Nation. Aber sie lieben auch Besonderes und Futuristisches, und sie lassen sich gerne unterhalten. So findet sich in D. C. neben eher gravitätischen, staatstragenden Sehenswürdigkeiten auch eine ganze Reihe von ausgefallenen und vergnüglichen Einrichtungen. Die Tickets für den Flugsimulator im Air & Space Museum sind schon morgens ganz flugs ausverkauft. Die Dinosaurierhalle im National Museum of Natural History erfreut sich ebenso großer Beliebtheit wie der Insektenzoo dort. Das Newseum, ein gigantisches Medienhaus, gilt als das interaktivste Museum der Welt. Hier lässt sich ausprobieren, wie man sich selbst als Moderator oder Redakteur bewähren würde. Mehrere Hundert Zeitungen aus aller Welt schicken täglich ihre Titelseiten ans Newseum, wo sie jeden Tag aufs Neue gezeigt werden und verglichen werden können. In den Sommermonaten herrscht bei den rund hundertfünfzig Denkmälern und fünfzig Museen großer Andrang. Zu den Touristenzielen mit den längsten Warteschlangen gehört das Holocaust Memorial Museum, das mit sechsundzwanzigtausend authentischen Artefakten die Vernichtung der Juden durch die Nazis nachzeichnet. Geschichte zum Anfassen, sehr berührend, nicht leicht zu verkraften.
Diesen Sehenswürdigkeiten und dem immensen Interesse der Amerikaner an Washington D. C. steht die recht mickrige Zahl der internationalen Besucher gegenüber: nur rund anderthalb Millionen jährlich. Wer von weit her kommt und die USA bereist, gibt in der Regel anderen Städten und Regionen den Vorzug. Washington D. C. gehört nicht zu den Top-Reisezielen. Absolut zu Unrecht, finden wir! D. C. is amazing, fabulous, outstanding, terrific, wonderful, was alles nicht mehr und nicht weniger heißt als: Diissii ist super!

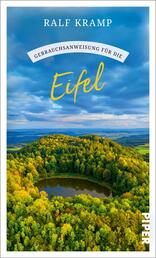
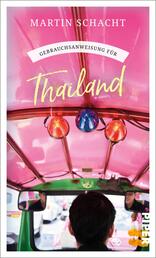
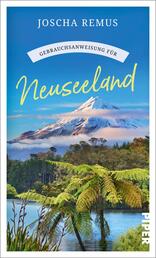





DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.