
Gebrauchsanweisung für Werder Bremen - eBook-Ausgabe
„Lesenswert nicht nur für ›lebenslang Grün-Weiße‹.“ - Rhein-Neckar-Zeitung
Gebrauchsanweisung für Werder Bremen — Inhalt
Würde Sympathie über Fußballspiele entscheiden, wäre Werder Bremen die Nummer eins der Bundesliga. Die Fanliebe zum 1899 gegründeten Traditionsverein reicht weit über die Grenzen des Weserstadions hinaus, und auch Julia Friedrichs trägt das Vereinswappen, die Raute, auf dem Herzen. Voller Leidenschaft durchlebt sie in ihrem Band die wechselvolle Geschichte des „grün-weißen“ Bundesligisten: das Goldene Zeitalter unter Otto Rehhagel und die berühmten „Wunder von der Weser“. Das leidige Schicksal eines Fast-ganz-großen-Vereins, dem immer wieder Spieler wie Özil, Diego oder Klose abhandenkommen, und dramatische Abstiegskämpfe, die sich in letzter Sekunde entscheiden. Sie folgt ihren Helden ins Trainingslager, spricht mit Anhängern der Bremer Ultraszene, und am Ende ist zweifellos klar, warum man so einem Klub lebenslang die Treue hält.
Leseprobe zu „Gebrauchsanweisung für Werder Bremen“
Warum Werder?
Noch vier Tage bis Weihnachten, aber für mich ist heute schon ein heiliger Abend. Die Lichterketten glitzern. Die Straßenbahn ist überfüllt. Wir steigen aus und laufen im grün-weißen Strom durchs Bremer Viertel. Mein Sohn hält meine Hand ganz fest, er trägt seinen kleinen Schal um den Hals, ich den meinen, größeren. Er blickt links und rechts und geradeaus und staunt darüber, wie viele gemeinsam mit uns diesen Weg laufen. Er sucht nach Fans, die andere Farben tragen, und findet doch nur Grün und Weiß. Da tauchen die schrägen Flutlichtmasten [...]
Warum Werder?
Noch vier Tage bis Weihnachten, aber für mich ist heute schon ein heiliger Abend. Die Lichterketten glitzern. Die Straßenbahn ist überfüllt. Wir steigen aus und laufen im grün-weißen Strom durchs Bremer Viertel. Mein Sohn hält meine Hand ganz fest, er trägt seinen kleinen Schal um den Hals, ich den meinen, größeren. Er blickt links und rechts und geradeaus und staunt darüber, wie viele gemeinsam mit uns diesen Weg laufen. Er sucht nach Fans, die andere Farben tragen, und findet doch nur Grün und Weiß. Da tauchen die schrägen Flutlichtmasten im Winterdunst hinter den alten Kapitänshäusern auf: das Weser-Stadion, der Ort, um den so viele meiner Gedanken kreisen. Heute Abend spielt Werder Bremen im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den SC Freiburg. Zum ersten Mal geht mein Sohn an meiner Hand mit ins Stadion. Für mich ein großer Moment.
Ich stamme nicht aus Bremen, sondern aus dem fußballerischen Nirgendwo, dem westlichen Münsterland. Es gibt keine familiäre Bande zwischen mir, der Stadt und dem Verein, weder meine Mutter noch mein Vater führten mich an der Hand ins Stadion, niemand verband mein Schicksal auf immer mit dem des Vereins. Das mit Werder und mir ist keine Zwangsehe, sondern eine Liebesheirat. Ich wählte den Verein aus freiem Herzen.
Unsere Liebe begann damals so, wie echte Romanzen anfangen müssen: im Rausch. Werder warb mit aller Macht. Wurde Meister, wurde Pokalsieger. Ließ atemberaubende Fußballer auflaufen: Johan Micoud, den König, dann Diego, den Zauberer, dann Mesut Özil, den Hochbegabten. Dabei blieb der Verein stets bodenständig und bescheiden, war so viel smarter und sympathischer als der stockreiche Großkotz aus München und doch kaum weniger erfolgreich. In solchen Zeiten, wenn alle deinen Verein respektieren, wenn große Spiele stets Flutlichtspiele sind, wenn es immer um Titel und Pokale geht, fällt die Liebe leicht und muss nie erklärt werden.
Heute dagegen, 15 Jahre später, da die großen Erfolge verblasst sind, höre ich oft diese Frage nach dem Warum. „Warum Werder?“, wollen Freunde und Fremde wissen. „Warum?“, fragt mein Vater. „Warum?“, fragt oft auch der, der sich jetzt mit mir durch die Sicherheitsschleuse schiebt, mein siebenjähriger Sohn. Tja, warum? Warum habe ich mein Herz verschenkt? Warum an genau diesen Verein?
Mein erster Reflex ist, diese Fragen trotzig zurückzuweisen. Wer will schon Liebe erklären?
Es ist, wie es ist, könnte ich poetisch, aber abgegriffen antworten. Auch wenn Vernunft, Angst und Stolz vor Unsinn, Schmerz und Lächerlichkeit warnen. Die Liebe liebt und damit basta.
Aber weil ich weiß, dass das die Wenigsten befriedigt, will ich Gründe nennen, die die Wahl Werder logisch, ja, unausweichlich scheinen lassen.
Kurz vor dem Anpfiff. Gerade ist die Aufstellung eingeblendet worden. Mein Sohn hat aufmerksam zugeschaut. Natürlich kennt er jeden Spieler. Er hat mit dem Kicker lesen gelernt, im Zug haben wir drei Stunden Fußballquartett gespielt, und über seinem Bett hängen Poster aus der Bravo Sport.
Aber wie es klingt, wenn Stadionsprecher Scholli ankündigt: „Mit der Nummer 12“, und vierzigtausend antworten: „Das sind wir. Das sind wir“, das hört er heute zum ersten Mal. Er hat noch nie gesehen, wie Tausende grün-weiße Bänder gen Himmel gereckt werden, war noch nie dabei, wenn ebenso viele Menschen singen: „Hebt die Hände hoch, zeigt den Werder-Schal.“
Wir gegen die. Ich bin in keiner Partei, glaube an keinen Gott. In keinem anderen Zusammenhang würde ich derart simple Zuschreibungen akzeptieren. Im Fußballstadion aber genieße ich es, genau zu wissen, wo ich hingehöre und wo nicht, die Komplexität der Welt da draußen hinter mir zu lassen. Glücklicherweise hat Werder Bremen mir in unserer Beziehung selten das Gefühl gegeben, mich falsch entschieden zu haben. Alles in allem, und das kann nun wirklich nicht jeder nach 15 Jahren Beziehung sagen, sind wir glücklich. Der Verein hat Eigenschaften, die ich auch an Menschen mag. Er ist besonnen, treu, warmherzig. Er ist kein Blender oder Schwätzer, aber durchaus smart. Er misstraut Hypes, ist im Zweifel eher gut als groß, in perfekten Phasen aber beides zusammen. Werder Bremen wirkt wie ein freundlicher Schweinswal im Haifischbecken Profifußball.
Auch im Alltag läuft es zwischen uns: Der Verein taktet meine Jahre, meine Woche verlässlich. Ab Donnerstag bin ich angespannt. Ab Freitag oft gedanklich abwesend. Am Samstag eigentlich unfähig, anderes zu tun, als die Spiele zu verfolgen. Leider viel zu selten live im Stadion.
Werder und ich führen eine Fernbeziehung. Wir sehen uns nicht oft, aber wenn, fiebere ich dem Treffen über Wochen entgegen. Dazwischen versuche ich die Schmerzen der körperlichen Distanz mit den verschiedensten elektronischen Hilfsmitteln zu lindern: bewegte Bilder auf Sky, Ticker auf Twitter, News im Netz.
Noch wenige Minuten bis zum Anpfiff. Auf der Anzeigetafel über der Ostkurve wird eine beachtliche Statistik eingeblendet: Seit 1988 hat Werder Bremen kein DFB-Pokal-Spiel zu Hause verloren. Mein Sohn schaut bewundernd zu mir hoch. „Wirklich?“, fragt er. Ich nicke. Er: „Wow.“
Ist es verzeihlich, dass ich ihm in diesem Moment eine entscheidende Information verschweige? Natürlich war Werder in vielen Jahren ein Pokal-Team, unschlagbar vor allem im Weser-Stadion. Aber diese Serie gründet auch darauf, dass es Werder in vielen Jahren gar nicht erst zu einem Pokal-Heimspiel brachte, weil es die Mannschaft bereits in der ersten Runde gegen unterklassige Gegner auf deren Plätzen dahinraffte. Und so erzählt diese Statistik in Wahrheit eine ganz andere, leider wahrere Geschichte als die, die ich meinem Sohn verkaufen will: Werder ist immer noch Mythos, Legende, Tradition, aber leider oft auch ernüchternde Gegenwart.
In schwachen Momenten, wenn ich auf der Heimfahrt nach einer erneuten Niederlage mit leerem Blick in den frühen Samstagabend starre, mich nach Punkten sehne, rechne und rechne, wenn ich flehe, dass dieses dumpfe Gefühl im Magen, das mich, steht Werder zu nah am alles entscheidenden unteren Tabellenstrich, stets begleitet, verschwinden möge, frage auch ich mich: Warum eigentlich Werder?
Mein Sohn hat sein erstes Fußball-Fanjahr, wie konnte es anders sein, in Grün-Weiß erlebt. Allerdings als ständiger Zeuge von Niederlagen, nach denen er weinte und seine Mutter fluchte. Er war – kaum alt genug, um in die Schule zu gehen – erleichtert, als ich ihm sagte, dass es okay sei, wenn er sich einen Zweitverein wähle. Er sei dann jetzt Fan von Dortmund und Werder, sagte er. Dann hätte er einen guten Verein und einen schlechten. Ich nickte müde: „Okay. Verstehe ich.“ Liebe kann nicht erzwungen werden.
Aber wenn sie echt ist, vergeht sie auch in schlechten Zeiten nicht. Während um mich herum in diesem zweiten Jahrzehnt der 2000er viele in Achtsamkeitskurse pilgerten oder sich von Weltflucht-Magazinen auffordern ließen, das kleine Glück schätzen zu lernen, konnte ich mir beides sparen. Mein Verein hat mich Demut gelehrt.
Werder Bremen versucht sich seit Jahren an einer der schwersten Aufgaben, der sich Helden stellen können: mit Anstand zu verlieren, in Würde zu scheitern, den Boden zu spüren, um dann wieder emporzuklettern. Dankbarer für den Erfolg als jemals zuvor.
Vieles davon ist uns gut gelungen. Anders als andere absackende Traditionsvereine aus dem Norden der Republik hat man in Bremen selbst in den Krisen Maß und Anstand bewahrt. Das hat mich noch enger an Werder gebunden. Siegen kann jeder. Aber ich habe mich auch während vieler Niederlagen nie für meinen Verein schämen müssen. Auf die entscheidende Pointe allerdings, den sportlichen Aufschwung, warte ich nun seit fast zehn Jahren.
Der Anpfiff an diesem Dezemberabend ist erst zwei Minuten her, als Jérôme Gondorf auf Ishak Belfodil passt. Zwei Spieler, die die Saison bislang nicht geprägt haben, um es vorsichtig auszudrücken. Zwei, die auch deswegen bei Werder Bremen spielen, weil andere nicht bezahlbar waren.
Aber Belfodil, kaum möglich, trifft! Da ist es, dieses Glück, nach dem jeder Fan lechzt, das in dem Moment, in dem der Ball im richtigen Netz zappelt, vom Bauch ins Herz und dann ins Hirn schießt, wo es sich über Tage festsetzen wird. Dieses Glück, das so wertvoll ist, vor allem bei Vereinen wie Werder, für deren Fans der Torschrei längst nicht mehr selbstverständlich ist.
Liebe kann man nicht erklären. Man spürt einfach, wenn sie da ist.
Mein Sohn verfolgt das Spiel an diesem Abend elektrisiert. „Der Schiri könnte mit Nachnamen Fehlentscheidung heißen“, zürnt er. „Zieh ab!“, schreit er, als Thomas Delaney sich dem Freiburger Tor nähert. Am Ende gewinnt Werder auch aufgrund einer Fehlentscheidung des Schiedsrichters mit 3:2. Wir tanzen.
Das nächste Pokalspiel werde ich in einer Kölner Sportbar gucken. Werder wird nach einer bravourösen halben Stunde 2:0 führen, bevor die ehemaligen Bremer Julian Brandt und Karim Bellarabi das Match für Leverkusen drehen werden. Ich werde traurig, doch mit erhobenem Kopf im leeren U-Bahnhof auf die Bahn warten. Allein, aber trotzdem mit all den Fans verbunden, die in diesen Momenten exakt dasselbe fühlen. Egal, wo sie diese Nacht verbringen werden.
Wenn Sie zweifeln und zögern, ob Werder Bremen der richtige Verein für Sie sein könnte, glauben Sie mir: Es kann keinen besseren geben. Ich stamme aus dem fußballerischen Niemandsland. Ich hätte jeden haben können. Ich bin mir sicher, die einzig richtige Wahl getroffen zu haben.
Im Fluss geboren
Werder Bremen wurde im letzten Jahr des 19. Jahrhunderts gegründet. Damals war Deutschland eine Turnnation, stramm, soldatisch, diszipliniert. Der Tritt gegen den Ball galt als undeutsch. Ein Bonmot dieser Zeit lautete: „Mit dem Fuße tritt man den Hund oder den Proletarier.“ Sportpädagogen denunzierten den Fußball als „englische Krankheit“, die jedoch hoch ansteckend war. Immer mehr Jugendliche rannten über Kuhweiden und kickten. Aus Vergnügen, aber auch als Revolte gegen die autoritären Eltern.
Das Deutsche Kaiserreich feierte in jenen Jahren am 2. September den Sedantag. Ein nationalistisches und militärisches Prunkfest, das an den Sieg über die französische Armee in der Schlacht von Sedan 1870 erinnerte.
In Bremen, so wird berichtet, traten am Sedantag des Jahres 1898 ein paar Teenager der privaten Realschule von C. W. Debbe zum Tauziehen an. Es war eine Fachoberschule für Kaufmannsberufe, Ausbildungsstätte der besseren Bremer Kreise, die nicht nur Bilanzieren und Kalkulieren, sondern auch den aus Sicht der Lehrer dringend notwendigen Drill lehren sollte. Hieß es doch über den Debbe-Jahrgang, um den es hier geht: „Von Seiten der Lehrerschaft wurde vielfach Disziplinlosigkeit, Alkoholkonsum und das Interesse an Mädchen kritisiert.“ Diese Lümmel sollen das Tauziehen der Turnbewegung gewonnen haben, und ihr Preis, so will es die Legende, soll ein Lederball gewesen sein.
Nun war einer der Jungs der Sohn eines Wirts, dessen Kneipe auf der Weserinsel lag, dem Stadtwerder. Hierher fuhren sie am Nachmittag mit der Sielwallfähre und kickten auf den Wiesen der Insel. So war es nur logisch, dass sie fünf Monate später, am 4. Februar 1899, den aus ihrer losen Runde gegründeten Fußballverein „FV Werder“ nannten. Es war der zweite seiner Art in Bremen und von Beginn an der Verein der besseren Kreise, der Bürgerkinder. Jahrelang verlangte die Satzung von den Spielern eine höhere Schulbildung. Auf den meisten frühen Fotos tragen die Gründer als Statussymbol ihre Schülermützen. Selbst auf dem Platz balancierten sie ein grünes Käppchen auf dem Haupt. „Kopfspiel wurde anfänglich überhaupt nicht betrieben“, heißt es in den Vereinsnachrichten.
Der Beginn war provisorisch: Das Tor wurde von zwei Stangen markiert, als Latte diente ein Tau, und man fahndete noch nach Spielern, die auch, „wenn es regnet oder friert“, auf den Platz gingen und „nicht lieber zu Hause beim warmen Ofen“ blieben. Die Spielkleidung bestand aus einem weißen Hemd, einer gekürzten Stoffhose und ein paar alten Straßenstiefeln, unter die „der Hausschuster kunstvoll Klötze schlagen“ musste. Beim ersten Spiel der Mannschaft säumten gerade mal 18 Zuschauer den Wiesenrand. Egal. Der FV Werder gewann gegen den Bremer Sport-Club mit 1:0, und der Weg des Vereins von der Schülermannschaft zu einem der wichtigsten Klubs des Landes begann.
1903 feierte der FV Werder erstmals die Bremer Meisterschaft. Und zwar nicht irgendwie, sondern mit drei Mannschaften in allen drei existierenden Bremer Spielklassen. Ab 1905 kassierte man von den inzwischen Hunderten Zuschauern Eintrittsgelder. 1908 gab es den ersten Polizeieinsatz wegen Fankrawallen. 1909 gastierte mit Hartlepools United die erste Profimannschaft aus England beim FV Werder. Im selben Jahr eröffnete der eintausend Zuschauer fassende Tribünenplatz Peterswerder. 1913 gelang die Qualifikation für die gerade formierte norddeutsche Verbandsliga.
Dann kam der Krieg, und die vom patriotischen Wahnsinn erfassten Bürgerkinder waren sich nicht zu doof, eine Abteilung Handgranatenweitwurf zu gründen. Es sollte nicht der einzige Sündenfall bleiben.
Aber erst einmal blühten Verein und Fußballsport in den Weimarer Jahren. Die vormals überlangen Arbeitstage wurden auf acht Stunden verkürzt. Die Menschen hatten Zeit, und sie sehnten sich nach Vergnügen. In Scharen meldeten sie sich bei den Vereinen an. Hatte der DFB vor dem Krieg noch 190 000 Mitglieder, waren es 1924 fast viermal so viele. Der FV Werder nahm andere Sportarten auf und wandelte sich vom reinen Fußball- zu einem breit aufgestellten Sportverein. 1920 benannte man ihn folgerichtig in „SV Werder Bremen von 1899“ um und wagte, vom „Zuge der Zeit“ mitgerissen, gar die Eröffnung einer „Damen-Abteilung“.
Berauscht vom Wachstum, planten die Vereine Großstadien, wie man sie fortschrittsbegeistert nannte. In Bremen auf der Pauliner Marsch, dort, wo die Weser ihren berühmten Bogen macht, eröffnete 1926 der Allgemeine Bremer Turn- und Sportverein die ABTS-Kampfbahn, die wenig später, als den Betreibern Geld fehlte, übernommen und in „Weser-Stadion“ umbenannt wurde. Es waren Jahre, die den Fußball veränderten. Es spielten nicht nur viel mehr Menschen in den Vereinen, es schauten nicht nur viel mehr zu, es wuchsen nicht nur immer größere Arenen, es begann auch eine Debatte um eine Praxis, die man „finanziell unterlegten Vereinswechsel“ nannte. Kurz: Es waren die Anfangszeiten des Transfermarkts.
Zwar tönte man in den Werder-Nachrichten, man wolle mit diesen „ekelhaften Begleiterscheinungen der Liga“, die dazu führten, dass „von auswärts kommende Spieler wie Pilze aus der Erde schossen“, nichts zu tun haben. Aber inoffiziell wurde auch bei Werder gezahlt. Man erzählt von Spielprämien, die manchen Akteuren in der Kabine zugeschoben wurden. Zudem bot die dem Verein nahestehende Brinkmann AG Spielern, die über einen Wechsel nachdachten, einen Arbeitsplatz. Das trug sicher dazu bei, dass der Verein in den 1920er-Jahren erste größere Erfolge feierte.
Keinen Monat nach ihrer Machtergreifung übernahmen die Nationalsozialisten auch den Fußball. Am 24. Februar 1933 verboten sie Arbeitervereine und jüdische Klubs. Werder Bremen, als Verein bürgerlicher Söhne geboren, war ihnen unverdächtig und übernahm die Regeln der neuen Mächtigen schnell und ohne Widerstand. Werders erste Mannschaft hob die Hand vor dem Anpfiff zum Hitlergruß, bei Vereinseintritt wurden Ariernachweise verlangt, und den ersten Vorsitzenden nannte man „Vereinsführer“. Die Grün-Weißen färbten sich braun. Im Verein tummelten sich begeisterte NSDAP-Mitglieder und anpassungsfähige Opportunisten, die ein Verbot verhindern wollten und sich deshalb, wie sie formulierten, der „neuzeitlichen Sportpropaganda“ unterwarfen. Jüdische Werderaner, wie zum Beispiel Albert Rosenthal, Papierwarenhändler, seit 1904 Vereinsmitglied, wurden verschleppt und ermordet.
Für die Nazis war der Fußball eine erwünschte Unterhaltung der Massen. Er galt als „kriegswichtig“, und so hielten sie den Spielbetrieb bis zuletzt aufrecht. Erst am 18. März 1945 hieß es in der Zeitung: „Fliegeralarme verhindern das letzte in Bremen angesetzte Fußballspiel TuS Walle – Werder am Hohweg.“
Nachdem Deutschland befreit war, wollten die Alliierten nicht nur das Land demokratisieren, sondern auch die Vereine. „Frei von militärischen Bestrebungen und nationalsozialistischen Einflüssen“ sollten sie werden. Das Weser-Stadion wurde in „IKE-Stadion“ umbenannt, und viele Arbeiter lehnten sich gegen das Weiterbestehen des nazinahen Bürgervereins SV Werder auf. Man nannte sich also um: erst „Sportgemeinschaft Mitte“, dann, extrem umständlich und unbefriedigend, „Sportvereinigung Grün-Weiß von 1899“. Im März 1946 stimmte der Vorstand dafür, „dem Verein seinen alten Namen ›S. V. Werder v. 1899‹ wiederzugeben“.
Werders größter Konkurrent der Nachkriegsjahre war der Bremer SV, ein Verein aus dem Arbeiterviertel Gröpelingen. Es war der Kampf Reich gegen Arm, Bonzenklub gegen Proletenverein, den Werder ab Mitte der 1950er-Jahre gewann. Mit Mitteln, die viele Fans an den heutigen Bonzenklubs kritisieren: Weil Vertragsspieler nicht mehr als ein paar Hunderter im Monat verdienen durften, zahlte Werder Handgelder und lockte, dank seiner zahlreichen Mäzene, auch mit Arbeitsplätzen bei Bremer Unternehmen. „Die Menge will nicht edle Amateurvielfalt sehen, sondern erstklassigen Fußball“, sagte Geschäftsführer Hans Wolff. „Erstklassigen Fußball kann aber nur spielen, wer beruflich unbelastet ist. Wir nehmen unseren Spielern diese Sorge ab und bieten ihnen eine gesicherte Existenz.“
Der Norddeutsche Fußball-Verband fand das wenig löblich und verurteilte Werder in einem Fall. Funktionäre hatten dem Mittelfeldspieler und Außenstürmer Willi Schröder zehntausend Mark aus schwarzen Kassen gezahlt.
Ebendieser Schröder schoss Werder 1961 zum ersten großen Titel. 62 Jahre nachdem die Oberschüler ihren Lederball gewonnen hatten, holte der Verein im Endspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern den DFB-Pokal. „Das Ding wurde nicht mal live im Radio übertragen“, erinnert sich Ehrenpräsident Klaus-Dieter Fischer. „Im Weser-Kurier gab es nur ein kleine Meldung.“
Am 11. Januar 1963 gehörte Werder Bremen zu den neun Mannschaften, die vom DFB als erste in die neu gegründete Bundesliga berufen wurden. Zwar kassierte die Mannschaft im ersten Spiel gleich in der ersten Minute das erste Gegentor in der Historie der Liga (auch ein Rekord), aber das Team hatte mit Willi „Fischken“ Multhaup, dem feinen Mann, der stets im Anzug am Spielfeldrand stand, einen Trainer, der es konnte. Multhaup erfand den Libero, er baute ein ausgewogenes Team auf, in dem „Eisenfuß“ Horst-Dieter Höttges und Heinz Steinmann hinten dichtmachten, Max Lorenz zauberte, Arnold „Pico“ Schütz und Klaus Matischak trafen. Am 8. Mai 1965 verlas Stadionsprecher Richard Oßenkopp nach Abpfiff und Sieg im Weser-Stadion die Ergebnisse von den anderen Plätzen. Mit dem Timbre eines Zeitansagers verkündete er: „1. FC Köln gegen 1. FC Nürnberg 0:0.“ Die Spieler jubelten. Die Fans tobten. Werder Bremen war zum ersten Mal Deutscher Meister. Der Anfang von etwas Großem.
Es ließe sich nun von Triumph zu Triumph durch die Vereinshistorie wandern, es ließen sich seitenweise Geschichten erzählen, die von Wundern handeln, von Flutlichtspielen, von Helden. Geschichten, die in diesem Buch auch stehen werden. Aber nachdem wir den Verein nun sicher von seiner Gründung über die unrühmlichen Nazijahre zum ersten Titel geführt haben, verlassen wir die sepiafarbenen Erinnerungen. Wir wissen in Bremen, dass weder Siege noch Tradition in Punkten vergütet werden. Auch die Stuttgarter Kickers wurden im Jahr 1899 gegründet, Alemannia Aachen 1900, Tennis Borussia Berlin 1902, Rot-Weiß Oberhausen 1904, Waldhof Mannheim 1907. Eine lange Vereinsgeschichte schützt nicht vor dem Absturz. Die Wahrheit ist immer auf dem Platz, und zwar auf dem im Hier und Jetzt.
Trainingslager: Werder Fieselschweif
Um 9.10 Uhr an einem Sonntagmorgen ruckelt die Zillertalbahn in die namensgebende Bergschneise. Meine letzte Etappe: Gestern Nachmittag bin ich in Berlin in die S-Bahn gestiegen, dann in den ICE nach Hannover, danach habe ich die Nacht auf Liege 16 in einem Zug der Österreichischen Bundesbahn verbracht, tiefgekühlt von einer überambitionierten Klimaanlage. Aber die letzten Meter sind wunderschön: Links und rechts an den steinernen Hängen ziehen sich Tannenwälder empor. Braun gescheckte Kühe grasen in werdergrünen Wiesen. Die Gasthöfe heißen „Post“ oder „Alpenblick“ oder „Schöne Aussicht“, von ihren hölzernen Balkonen quellen bunte Blumen. Es ist ein schwülwarmer Hochsommertag. Weiße Schlieren hängen über den Gipfeln. Aber egal: Es ist Trainingslagerzeit, einer meiner Saisonhöhepunkte.
Die Gespräche mit Bekannten, die eher zu Minimalismus, Yoga oder Veganismus tendieren, verlaufen vor solchen Reisen meist ähnlich.
Ich: „Nächste Woche kann ich nicht, da bin ich in Österreich.“
Sie: „Urlaub oder Arbeit?“
Ich: „Ich besuche Werder im Trainingslager.“
Sie: „Wie?“
Ich: „Ich fahre zum Trainingslager von Werder Bremen, mache ich in jedem Jahr.“
Sie: „Mhm.“
Ich weiß, es ist ein Tick, ein Spleen, aber wer zuhört, dem kann ich ihn erklären. Das Sommertrainingslager hat einen ganz speziellen Reiz. Zu dieser Zeit löst sich der Profifußball aus seiner gewaltigen Kulisse, natürlich nur, um eine neue, aber eben ganz andere zu schaffen. Eine, in der er plötzlich nahbar wirkt, geschrumpft, aufs Wesentliche reduziert.
Im Trainingslager spielen die Profis auf einem Dorfplatz, zu dem sie meist zweimal am Tag radeln. Es riecht nach frisch gemähter Wiese. Die Stollen klackern auf gepflasterten Wegen, und die Spieler, die im Fernsehen stets wie übermenschliche Heroen wirken, spazieren normalsterblich groß an einem Häuflein wartender Fans vorbei, ziehen die Trainingsjacke aus und absolvieren ihre Übungen. Sie traben. Sie sprinten. Sie dehnen. Sie kicken.
Und nun stellen Sie sich vor, sie lehnen keine drei Meter entfernt am Rand dieses Platzes an einem Zaun, bei bestem Wetter, neben sich zwei Freunde, vor ihnen, greifbar nah, das Objekt, das sie alle drei brennend interessiert. Sie gucken zu und palavern. Was macht der neue Fitnesscoach anders? Wird die Übung mit dem Gummiband tatsächlich die Viererkette stabilisieren? Das Kurzpassspiel läuft immer besser, oder? Kann es Angenehmeres geben? Nicht viel.
Und so war ich in den vergangenen zehn Jahren in Bad Waltersdorf in der Steiermark, auf Norderney, in Neuruppin, in Blankenhain, in der Nähe von Weimar und eben im Zillertal.
Um Viertel vor zehn hält die Bahn in Zell am Ziller. Hier weitet sich das Tal. Die Hänge sind steil, aber nicht steinern. Auf den Wiesen weiden Schafe. Am Spielplatz im Ort pickt eine Hühnerschar. Die Marktgemeinde hat knapp zweitausend Einwohner. In dieser Woche ist sie das Zentrum der Werder-Welt. Am Verkehrskreisel in der Ortsmitte wehen fünf Werder-Fahnen. Vor dem Tourismusbüro ist aus weißen Steinen ein geschwungenes W auf einem Stück grüner Wiese gelegt. Die Apotheke und der „Gasthof Bräu“ haben geflaggt, ja sogar das „Kerzenstüberl“ verkauft Werder-Kerzen. Überall im Ort auf den schmalen Wegen sieht man zwischen Wiesen und Feldern Punkte in verschiedenen Grüntönen aufleuchten. Fangruppen, die die Trikots der vergangenen Spielzeiten tragen. Ein paar Junuzovićs sind unterwegs, ein Kruse, Pizarros natürlich, ein Özil, sogar einen Diego sichte ich.
Es ist eine ganz eigene Feriencamp-Atmosphäre, und Julia Düvelsdorf ist die Chefin der Rotte. Die blonden Haare zurückgebunden, Sonnenbrille auf, Werder-Hemd an, auf dem Arm die Songzeile „We can be heroes, just for one day“, lenkt sie die Fans souverän durch die Woche.
Siebenhundert Menschen, schätzt sie, seien wegen Werder ins Zillertal gefahren, immerhin mehr als neunhundert Kilometer von Bremen entfernt. „Was dieser Verein für viele Menschen bedeutet, verstehen Außenstehende nicht. Wenn man überlegt, durch was für ein Tal wir gegangen sind und vielleicht immer noch gehen, und dann sieht, wie treu die Werder-Fans sind, ist das wirklich unglaublich.“ Der Aufwand, den manche betreiben, sei unfassbar, fügt sie hinzu. Urlaubstage, Reisekosten, Tausende Kilometer im Auto oder in der Bahn. Alles für einen Fußballverein.
Da ist zum Beispiel diese Gruppe aus Freital in Sachsen, zwei Handvoll Männer, zwei Frauen. Vier-, fünfmal pro Saison fahren sie in einem Kleinbus knapp fünfhundert Kilometer nach Bremen. Jedes Heimspiel ist für sie ein Auswärtsspiel. Seit 15 Jahren machen sie das jetzt so.
„Warum sind Sie Werder-Fans?“, frage ich.
„Das hat mit dem Krieg zu tun“, sagt einer aus der Gruppe, im orangefarbenen Auswärtstrikot, bedeutungsvoll.
„Wie das?“
„Zwei große Helle“, bestellt sein Kollege. Er weiß, dass jetzt eine längere Geschichte folgen wird.
Also, setzt der Orangefarbene an, seine Familie stamme aus Pommern, auf der Flucht habe es sie zerrissen: Die eine Hälfte ging nach Niedersachsen, die andere Hälfte, in die er geboren wurde, nach Sachsen. 1988 durfte sein Vater zum ersten Mal zur Westfamilie reisen, ins kleine Syke, dreißig Kilometer von Bremen entfernt. Damals habe der Vater ein Spiel im Weser-Stadion gesehen. Die zweite Pokalrunde sei das gewesen, ein 6:1 gegen Bayreuth. „Vor dreitausend Zuschauern.“ Und dann sei diese Durchsage durchs Stadion geklungen: Alle, die heute hier seien, bekämen eine Freikarte für das Spiel, das sechs Tage später stattfinden werde – Europapokal der Landesmeister gegen den DDR-Rekordmeister Dynamo Berlin. Der Vater entsetzt: „Da muss ich schon wieder zurück in der DDR sein.“ Und so schaute er das 5:0 von Werder Bremen daheim. Es war das zweite vieler berühmter Wunder von der Weser. Der junge Thomas Schaaf machte nach Pass von Karl-Heinz Riedle das letzte Tor. „Pitschnass lag mein Vater auf dem Sofa“, erzählt der Orangefarbene. „Er war fix und alle.“
Spätestens ab da war das Band zwischen der sächsischen Familie und dem SV Werder Bremen unzerreißbar. Und nach und nach schlossen sich immer mehr Freitaler Kumpels diesem Bund an. „Wir haben uns eben alle für Werder entschieden“, sagen sie. „Es passt einfach.“
Zum zweiten Mal sind sie im Zillertal. Auf ihren iPads zeigen sie mir die Fotos. Alexander Nouri, in diesem Sommer noch unser Trainer, in ihrer Mitte, Frank Baumann, der Manager, mit der ganzen Gruppe, Max Kruse, der Sturmstar, mit Fahrradhelm. „Einmalig ist das hier“, sagen sie. „Das gibt es nur bei Werder. Wenn jetzt Bayern hier wäre: Die würden alles absperren.“
In der Tat gibt sich das Team alle Mühe, zu beweisen, dass Fannähe in Bremen keine Phrase ist. Die Spieler steigen wieder und wieder vom Rad, unterschreiben Trikots und Bälle und Fotos und Mützen, sogar die Bratwurstpappen vom Kiosk. Sie posieren für Gruppenbilder und Einzelporträts und Selfies, aufrecht oder im Knien. Nur einmal, im Neuruppiner Trainingslager, hörte ich, wie ein Nachwuchsspieler die unstillbare Gier nach Unterschriften verfluchte. „Die wissen doch gar nicht, wie ich heiße.“ Er solle nicht labern, mahnten ihn die Kollegen sofort.
Als ein Fan im Zillertal Torwart Michael Zetterer fragt, wie die Spieler es eigentlich aushielten, wenn nach dem Training alle auf sie zustürzten, um Fotos und Autogramme zu ergattern, antwortet der äußerst elegant: „Wir fragen uns eher, wie ihr Fans das ertragt, wenn wir immer so schwitzen und stinken und ihr uns so nah kommt.“
Am vierten Trainingslagertag ist das große Fanfoto angesetzt. Pünktlich um 9.45 Uhr bauen sich Hunderte Menschen Reihe um Reihe auf dem Trainingsplatz auf. Alte Paare, junge Paare, Kleinkinder, Teenager, die Sachsen sind auch da. Dann kommt die Mannschaft und stellt sich nicht etwa in Postermanier vor die Fans, sondern mischt sich unter sie. Die Stars legen die Arme auf die Schultern neben ihnen. Man ahnt, an wie vielen digitalen und analogen Wänden dieses Foto von nun an hängen wird.
Beim Grillabend mit dem Trainerteam, als feierlich grün-weiße Tischdecken auf den Biertischen liegen, steht ein Mann auf und spricht Worte, die später von anderen oft als richtig und wahr zitiert werden: „Ich möchte Danke sagen“, richtet er sich an Alexander Nouri und die anderen. „Ihr seid so zugänglich, so offen. Wir wissen alle, dass das bei anderen Vereinen nicht so aussieht.“ Zwei Tage später erneuert er, weil es so gut lief, dieses Lob auch noch mal im Fantalk mit drei Spielern. Da schaut Jérôme Gondorf, die neue Nummer 8, gerade erst aus Darmstadt gekommen, ihn an und sagt: „Ich weiß, was Werder den Fans bedeutet.“ Genau deswegen habe er sich für den Verein entschieden. Er kenne die Videos aus den Wochen, in denen der Abstieg drohte. „Bei anderen Mannschaften laufen die Fans gleich Barrikade. Ihr nicht. Das zeigt, dass der Verein intakt ist.“
Tosender Beifall. Diese Trainingslagerwoche ist eine große Feier des Zusammenhalts. Der sommerliche Schulterschluss zwischen Anhängern und Team. Und ein bisschen auch unter den Fans.
Am Dienstagmorgen um kurz vor neun versucht sich Julia Düvelsdorf am Almauftrieb. Mehr als 120 Menschen sind zur Fanwanderung gekommen, wollen gemeinsam von der Bergstation zur Kreuzjochhütte laufen. Man spürt, dass solche Zweitausender für die meisten unvertrautes Terrain sind. Ein schmaler Teenager mit Bartflaum wagt es kaum, den Blick aus der Kabine der Bergbahn ins Tal zu richten. „Schatz, wenn uns bestimmt sein sollte, dass wir abstürzen, dann geht es ganz schnell“, sagt seine ebenfalls verängstigte Mutter. „Wir sind aus Ostfriesland“, schickt sie erklärend hinterher. Kurz darauf, beim Aufstieg, flucht eine Bremerin: „Meine Waden sind so etwas nicht gewohnt.“ Sie habe sich bei den ersten Reisen ins Zillertal auch stets gefreut, wenn Wolken im Tal lagen, damit sie nicht ständig auf die Berge habe blicken müssen, tröstet Düvelsdorf. „Mittlerweile bin ich fast eine Bergziege.“ Und als solche klettert sie voran.
Schon am ersten Hang wird die Gruppe auseinandergerissen. Wer von oben herabblickt, wird mit einem großartigen Bild belohnt: Die Gipfel recken sich in den blauen Himmel, durchstoßen die wenigen tief hängenden Wolken, und davor zieht eine vielköpfige grüne Schlange auf Serpentinen die Almwiesen empor.
Die moderne Gesellschaft wird oft als zersplittert beschrieben. Mehr und mehr, so die Diagnose, sortierten sich Wohnviertel und Schulen und Betriebe und Hobbys nach Geld und Bildung. Tribalismus nennt das die Soziologie. Dem Fußball aber kann es gelingen, diesen Stämmen gemeinsames Lagerfeuer zu sein. Wenn er, wie an diesem Morgen am Berg, eine seiner besten Seiten zeigt, ist er Kitt, Schmiermittel, Gleichmacher.
Da ist der Bayer, dessen Sohn fast an jedem Wochenende gen Norden pilgert, meist allein, da es bei ihnen in der Ecke keine Werder-Fans gibt. „Dein Sohn ist uns immer willkommen“, sagt eine Frau. Ein Bremer erzählt mir von seiner Fangruppe. Zu der gehören ein Verwaltungsfachangestellter, ein Maurer, ein Ingenieur. Gäbe es den Fußball nicht, hätten sie nie zusammengefunden.
Und dann ist da Jörg, 52, Betriebsrat einer Bank. Wir laufen ein paar Meter nebeneinanderher, klappern den aktuellen Kader ab: Wird es der junge Jesper Verlaat schaffen? Wie lange dürfen wir uns noch an Max Kruse erfreuen? Schafft Maxi Eggestein in diesem Jahr den Durchbruch? Sofort ist jede Distanz dahin. Nach zehn weiteren Metern frage ich: „Woran merkst du eigentlich, dass du Werder liebst?“
„Wenn die Abstiegssorgen beginnen und du körperlich leidest“, antwortet Jörg sofort. „Wenn du Schüttelfrost hast und nicht mehr essen magst.“ In der vorvorletzten Saison habe er in den Wochen, in denen Werder ganz unten war, fünf Kilo abgenommen. Von Montag bis Donnerstag habe ihn die Arbeit ablenken können, aber am Freitag sei er zittrig geworden. „Und dann habe ich diesen Albtraum gehabt“, berichtet er. „Habe geträumt, dass Hoffenheim die Bayern besiegt und wir absteigen.“ Er sei nass geschwitzt aufgewacht und habe sich gesagt: „Jörg, du spinnst, du bist ein erwachsener Mann.“
Ich schaue zu ihm hinüber, ein Moment des kompletten Verstehens.
„Bei mir war es genauso“, sage ich und erzähle ihm von meinem Albtraum in den schlimmen Tagen im Frühjahr 2016 vor dem finalen Spiel gegen Frankfurt. Mich quälte damals im Schlaf ein seltsames Szenario: Ich träumte, dass auf dem Stadionrasen parallel zum Match ein Jahrmarkt stattfand und die Spieler zwischen Achterbahnen und Autoscootern passen und dribbeln mussten. Was schnell dazu führte, dass der Schiedsrichter die Partie abbrach und der DFB-Kontrollausschuss (so präzise war der Albwahn) das Spiel für den Gegner wertete. Auch ich wachte – wie Jörg – mit angstnasser Stirn auf. Liebe eben.
„Wer das nicht selbst erlebt, versteht es nicht“, sagt Jörg. Ich nicke und trotte zufrieden mit meiner Herde gen Tal.
Fanbetreuerin Julia Düvelsdorf hatte mir anvertraut, sie möge es kaum mehr sagen, weil es eine so abgenutzte Plattitüde sei, aber den zwölften Mann und die zwölfte Frau gebe es bei Werder tatsächlich. „Ich will nicht sagen, dass andere Fans ihre Mannschaften weniger lieben. Aber es gibt bei Werder diesen Spruch: Wir sind Werder, wir sind anders.“ Die Bindung zwischen Fans und Verein sei eng.
„So ist es“, höre ich auf der Wanderung immer wieder und sammle mögliche Erklärungen. Bremen, sagt eine Frau, sei nun mal eine Insel, umspült von Niedersachsen, getrennt von Bremerhaven. So etwas schweiße zusammen. Bremen sei eine gebeutelte, eine arme Stadt, die einen langen, quälenden Niedergang erlebt habe, sagt ein anderer. Da klammere man sich umso mehr an den Verein. Der Bremer sei besonnen, findet ein Dritter, sei keiner, der Hals-über-Kopf-Entscheidungen treffe. Wenn sich ein Bremer bindet, dann auf Dauer, ewig loyal.
Berauscht von der Idee, Teil von etwas Gutem und Großen zu sein, schaue ich beim Nachmittagstraining zu. Die Spieler üben das Kurzpassspiel in blauen und orangefarbenen Leibchen. „Ein Kontakt nur“, ruft Nouri, „hohe Intensität.“ Könnte man diesen Moment doch konservieren. Es ist, wie in jedem Sommer, der Zauber des Anfangs, die Zeit, in der noch alles möglich scheint. Die Zeit, in der ich vorsichtig wage zu träumen. Was, wenn es in diesem Jahr wirklich gelingen sollte, ein großes Team zu formen? Könnte es nicht eine richtig gute Saison werden? Vielleicht sogar eine sehr gute?
Natürlich bin ich gewarnt. Ich weiß, wie trügerisch diese Vorfreude ist, kamen die dumpfen Aufschläge doch zuletzt oft schon vor dem ersten Spieltag. Viermal schied Werder innerhalb von sechs Jahren in der ersten Pokalrunde aus, viermal gegen drittklassige Teams. 1:2 gegen den 1. FC Heidenheim, 2:4 gegen Preußen Münster, 1:3 gegen den 1. FC Saarbrücken, 1:2 gegen die Sportfreunde Lotte. Jedes Ergebnis ein Nadelstich, der die Seifenblasen des Sommers ganz schnell zum Platzen brachte. Trotzdem puste ich unverdrossen in jedem Jahr eine neue.

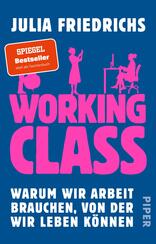


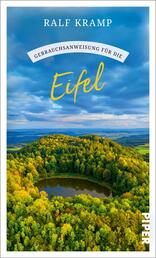

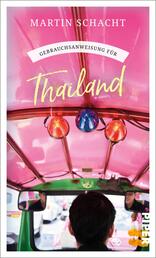
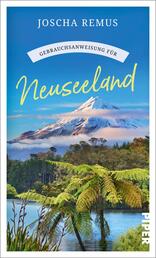





DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.