
Gebrauchsanweisung fürs Fahrradfahren - eBook-Ausgabe
„Das Buch des Münchner Autors [...] ist eine ebenso witzige wie verblüffende Hymne an die anmutigste und berauschendste Art der Fortbewegung.“ - Westfälische Nachrichten Ahlen
Gebrauchsanweisung fürs Fahrradfahren — Inhalt
Ob Fixie oder Retro-Drahtesel, Trekking- oder E-Bike – Sebastian Herrmann kennt vom täglichen Arbeitsweg bis hin zu Amateurrennen, Alpenüberquerungen und Donauradwanderungen alle Facetten des Daseins im Sattel. Er weiß um die Sucht nach Kilometern und die grausige Furcht vor dem Hungerast. Erzählt von skurrilen Rekorden und Klapprad-Weltmeisterschaften, würdigt die Protagonisten des Profisports und widmet sich neben dem Pedalneid und der Begeisterung für alte Stahlrahmen den existenziellen Fragen eines jeden Zweiradfans: Kann man in eng anliegender Funktionskleidung seine Würde wahren? Muss man an roten Ampeln tatsächlich halten, wenn man so umweltfreundlich unterwegs ist? Und wie reagiert man, wenn Diebe einem die große Liebe ausspannen? Eine ebenso witzige wie verblüffende Hymne an die anmutigste und berauschendste Art der Fortbewegung.
Leseprobe zu „Gebrauchsanweisung fürs Fahrradfahren “
Gib jemandem einen Fisch, und du ernährst ihn für einen Tag. Bring einem Menschen das Fischen bei, und du ernährst ihn ein Leben lang. Wenn du aber einem Menschen das Radfahren beibringst, wird er erkennen, wie dumm und langweilig das Fischen ist.
Desmond Tutu, südafrikanischer Geistlicher und Träger des Friedensnobelpreises
Morgens um halb drei vor der Haustür in einer Münch-
ner Vorstadt. Die Nacht hat ihren Namen nicht verdient, zwei, drei Stunden schlafloses Wälzen im Bett, bis der Wecker die Unruhe endlich beendet. Dann ein frühes Frühstück aus [...]
Gib jemandem einen Fisch, und du ernährst ihn für einen Tag. Bring einem Menschen das Fischen bei, und du ernährst ihn ein Leben lang. Wenn du aber einem Menschen das Radfahren beibringst, wird er erkennen, wie dumm und langweilig das Fischen ist.
Desmond Tutu, südafrikanischer Geistlicher und Träger des Friedensnobelpreises
Morgens um halb drei vor der Haustür in einer Münch-
ner Vorstadt. Die Nacht hat ihren Namen nicht verdient, zwei, drei Stunden schlafloses Wälzen im Bett, bis der Wecker die Unruhe endlich beendet. Dann ein frühes Frühstück aus Nudeln mit Tomatensoße, die am Vorabend übrig geblieben sind, dazu Kaffee und kribbelnde Nervosität, die sich ebenso als Vorfreude wie als Versagensangst deuten lässt. Draußen vor der Tür wartet der Nachbar, steht über den Lenker seines Rennrads gebeugt und fummelt an seinem GPS-Fahrradcomputer herum. Eine Begrüßung, ein Gähnen, noch ein Abschiedsselfie mit dem Handy, dann los, um die anderen Mitfahrer einzusammeln. Sechs Rennräder rollen schließlich über verwaiste Bundesstraßen in Richtung Süden. Das Hinterrad des Vordermanns dreht sich im Kegel des Lichts, Ketten surren, Fahrtwind rauscht in den Ohren. Die kühle Frische der Sommernacht und die Bewegung vertreiben die Müdigkeit, sechs Radler begeben sich in ihren je eigenen Tunnel. Nächster Halt Gardasee.
Unter ambitionierten Hobbyrennradlern in und um München zählt eine Gewalttour zum Gardasee zu den populären Einträgen im sportlichen Lebenslauf. Morgens los, hoffentlich abends ankommen und dabei spüren, was in den Beinen steckt.
Am Walchensee geht die Sonne auf, Frühstück im Inntal, am Brenner gibt es schlechten Kaffee, kurz nach Brixen platzt das Hinterrad eines Mitfahrers mit lautem Knall, eine ungeduldige Reparatur in der Mittagssonne, und von Bozen bis Rovereto bläst den Unermüdlichen ein elend heißer Wind entgegen. Dann, nach 19 Stunden und 406 Kilometern: Siegerfoto und Siegerbier am Gardasee. Geschafft. Schulterklopfen. Gut gemacht. Und jetzt, was kommt als Nächstes? 500 Kilometer am Stück? Noch mehr?
Wie bescheuert. Gerade durch das Ziel gerollt, die große Tour durchgezogen, und es dauert nicht lange, bis die Frage nach der nächsten Tortur auftaucht. Für Kollegen und Freunde steht sowieso längst fest: Der Typ ist sportsüchtig, ein Junkie in hässlicher Hose mit Gesäßpolster, der sein Dasein im Wesentlichen auf einem Fahrrad fristet. Das muss pathologisch sein! Diese Sicht passt ja auch gut ins Bild der Zeit. Überall wird gerannt, geradelt, geschwitzt. Männer in Funktionswäsche keuchen über Landstraßen, Frauen mit Yogamatten zählen fest zum Stadtbild. Wer etwas auf sich hält, läuft Ultramarathon, weil ein einfacher Marathon Sache der Massen ist.
Im Lichte dieses allgemeinen Fitnesswahns ließe sich die Eskalation des eigenen Treibens leicht als Selbstoptimierungszwang und Suchtverhalten abtun. Aber das ist langweiliger Unsinn. Ausdauersport kann zu einem Lebenselixier werden und eine Tour wie die zum Gardasee ein persönliches Fest sein. Die Steigerung der Dosis ist integraler Bestandteil dieser Schwitzerei, das Höher, Schneller, Weiter gehört automatisch dazu, egal auf welchem Niveau.
Der Einstieg in die Radkarriere hatte mit einer Überdosis begonnen. Die Mountainbiketour führte durch das Karwendelgebirge im Grenzgebiet zwischen Deutschland und Österreich, mündete in vollkommener Erschöpfung und war aus heutiger Perspektive geradezu lächerlich kurz. Es regnete, es brannte in den Beinen, es ging nichts mehr, gar nichts mehr. Die Verzweiflung war groß, und der im Übrigen grob verkaterte, aber trainiertere Begleiter komplettierte die Demütigung, indem er in den vielen Zwangspausen fröhlich auf den bleichen Fahrradneuling einplapperte, Zigaretten rauchte und dann fragte, ob es denn nun endlich weiterginge. Es ging nicht weiter, die Räder mussten geschoben werden, es wurde ein sehr langsamer Trauermarsch zum Übernachtungsquartier. Am Abend war die Entkräftung zu groß, um essen zu können, und die Erschöpfung zu tief, um in den Schlaf zu finden. Eine vollständige, nicht zu leugnende Niederlage – und der Beginn einer Leidenschaft: Radfahren.
Die bedingungslose Kapitulation im Karwendel und ein folgender Versuch der Wiedergutmachung markierten den Start einer, nun ja, Eskalationsspirale. Die zweite Runde durch die Berge gelang ohne Nahtoderfahrung. Aus kurzen Touren wurden lange; milde, mehrtägige Alpenüberquerungen steigerten sich zu langen, harten Alpenüberquerungen mit zehrenden Passagen, in denen das Fahrrad über Gletscher, über Schrofen hinauf- und auf der anderen Seite des Berges wieder hinabgetragen werden musste. Immer mehr Kilometer, mehr Höhenmeter, auf dem Mountainbike, auf dem Rennrad. Der tägliche Radweg in die Arbeit wuchs in dieser Zeit, von sieben Kilometern einfach, nach einem Umzug in die Vorstadt auf 23 und – wenn etwas mehr Zeit für die schönere Route drin ist – weiter auf 33 Kilometer. Jeden Tag, bei Wind und Wetter, hin und zurück.
Die Dosis steigt auch, weil – hier ist eine Drogenanalogie zulässig – der Sportler eine Toleranz entwickelt. Um das von ihm ersehnte Gefühl zu erlangen, muss er sich größeren Herausforderungen stellen. Das sollte nicht als verzweifelte Selbstoptimierung abgetan, sondern gefeiert werden, denn das Hochgefühl ist für Anfänger, Fortgeschrittene und Sportextremisten gleichermaßen erreichbar: Zum ersten Mal 50 Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen kann das gleiche Hochgefühl erzeugen, wie später zum ersten Mal 100 oder 200 Kilometer zu bewältigen. Mit der Fitness verschiebt sich der Standard, also das, was als normal gilt – für den Beobachter jedoch nicht, für ihn steigt nur das Befremden über das seltsame Tun.
Nun, zwölf Jahre nach der Einstiegsüberdosis, stehen als Höhepunkt 406 Kilometer an einem Tag im Lebenslauf. Sollte das Langstreckengelage als Ausdruck einer Sucht verstanden werden? Die Entzugssymptome bestehen jedenfalls nicht aus körperlichen Schmerzen, kaltem Schweiß, Übelkeit oder Orientierungslosigkeit. Bei Abstinenz meldet sich hingegen ein Sehnen, ein Drängen, der Berg ruft, oder es lockt eben der Asphalt – klinisch-pathologisch lässt sich das nur mit Mühe deuten. Unzufriedenheit trifft es besser, und das ist ein Gemütszustand, keine Krankheit. Es handelt sich um die ungestillte Sehnsucht, wieder das Glück auf dem Fahrrad zu erleben, das sich auf kurzen Fahrten zum See oder sogar zum Supermarkt ebenso einstellt wie bei den langen Versuchen, die eigene Grenze zu finden und zu überschreiten.
Ausdauersport liefert das Gefühl, Kontrolle zu erlangen. Er sortiert den Verhau des Alltags. Joggen oder Radfahren lüften den Kopf aus, es handelt sich um eine Art schweißtreibende Meditation. Mit jedem Schritt und jedem Tritt sortiert sich das Durcheinander im Schädel, das Gedankengestrüpp lichtet sich, und aus dem neuronalen Unterholz tauchen Ideen auf, Probleme lösen sich. Die Monotonie des Ausdauersports düngt den Geist und lässt Ideen erblühen – ein Zustand, nach dem sich Radler oder Läufer sehnen. Der Körper ist erschöpft, der Geist erfrischt. Ein motorisch induzierter Eskapismus, der Ideen gebiert und dabei den Drang nährt, diese Weltenflucht abermals anzutreten.
Der Hobbyradler beeindruckt sich zuallererst selbst, er erfährt unmittelbar am eigenen Körper, zu welchen ungeahnten Taten er imstande ist. Sport liefert Zahlen, die Leistung objektivierbar machen – 100 erradelte Kilometer sind 100 erradelte Kilometer. Das kann Quelle von Stolz sein, der sich von grüblerischen Zweifeln nicht so leicht erschüttern lässt – egal wie viele Sportler es gibt, die über diese Leistung nur milde lächeln, weil sie selbst zu viel größeren Taten imstande sind.
Vollbracht ist vollbracht, doch dann muss es weitergehen. Ein neues Ziel muss her. Länger, weiter, höher, schwerer, schöner als das eben erreichte. Die theoretische Chance des Scheiterns muss gegeben sein, sonst fehlt der Kitzel. Ein Kletterer wiederholt auch nicht immer wieder die eine Route, die er schon so oft durchstiegen hat, bis er seinen Lebensvorrat Magnesiapulver aufgebraucht hat. Stattdessen sucht er die nächste Wand, die ihn aufs Neue vor Schwierigkeiten stellt. Und ein Tennisspieler misst sich lieber mit einem ebenbürtigen Gegner als mit einer Gurke, gegen die er stets locker gewinnt. Das alles erscheint selbstverständlich. Aber ein Ausdauersportler, der einen langen Lauf antritt, für eine besonders lange Fahrt trainiert? Das öffentliche Urteil lautet da rasch: Der Typ muss sportsüchtig sein, denn das kann ja gar keinen Spaß machen oder Erfüllung bieten.
Menschen tun gerne die Dinge, in denen sie gut sind. Ein Musiker macht gerne Musik, ein Maler malt gerne, ein Radler radelt gerne. Es braucht nun wirklich keinen Psychologen, um das zu verstehen. Mit dem Fortschritt wächst das Bedürfnis weiterzumachen. Am Anfang kostet es Überwindung, joggen zu gehen; dann erfordert es Überwindung, nicht joggen zu gehen. Man nennt das Leidenschaft. Wenn der Läufer zwanghaft loshumpelt, obwohl er verletzt ist, ja, dann darf das als Sucht oder wenigstens als Zwang bezeichnet werden. Und wenn der Läufer oder Radler nur loszieht, um Gewicht zu verlieren, dann handelt es sich nicht um einen Sportler, sondern um einen Körperbesorgten, der im Extremfall an einer Essstörung leidet. Der ambitionierte Hobbyausdauersportler radelt oder läuft, weil er gerne radelt oder läuft. Dass er so sein Gewicht hält und nicht so arg aus dem Leim geht, stellt einen positiven Kollateralnutzen dar, aber kein primäres Ziel. Im Übrigen funktionieren zehrende Touren hervorragend als Begründung, warum das fette Essen und ein paar Bier dazu mal so was von verdient sind.
Ein Sommertag im Ötztal in Österreich. Der Wettbewerb trägt den Begriff „Challenge“ im Namen, weil sich die Teilnehmer mit Profisportlern messen. Na ja, fast zumindest, die Profis fahren ein paar Stunden nach dem Hobbypulk die gleiche Route – nachdem sie schon etwa 150 Kilometer extra gemacht haben. Die Strecke führt über gute 30 Kilometer das Ötztal hinauf und dann von Sölden bergauf bis auf den Rettenbachferner. Die enorm steile Gletscherstraße ist mehr Folterwerkzeug als Fahrbahn. Diesmal ist die Tagesform mies, dieses Biest von einem Berg lässt sich kaum niederkurbeln. Kurz vor der Ankunft auf etwa 2700 Metern Höhe kriselt der Kreislauf, der Blick ist irr. Ein paar Stunden später kommen die Profis ins Ziel, und sie sehen nicht besser aus: Manche fahren Schlangenlinien, anderen hängt schaumiger Speichel aus dem Mund, eine Horde Zombies. Die Profis leiden genauso wie die Amateure vor ihnen, sie fahren dabei nur wesentlich schneller.
Die Schmerzgrenze verschiebt sich, und irgendwann befindet sie sich in Regionen, die zu Beginn der Fahrradkarriere gefühlt weiter entfernt lagen als die nächste Galaxie. In der Nachbarschaft der Schmerzgrenze sitzt auch der Quell jener überwältigenden Emotionen, nach denen Ausdauersportler wenigstens einige Male im Jahr suchen: Nach 400 Kilometern im Sattel in der Serpentine oberhalb von Torbole auf den Gardasee zu blicken schnürt die Kehle vor Glück zu. Der Moment erschüttert, er überwältigt, und es fehlt nicht viel, um in Tränen auszubrechen. Die Schmerzen, der Zweifel, der Selbsthass, der Schwur, so etwas nie wieder zu machen, und die anderen miesen Gefühle, die zu so einer Tour gehören, sie explodieren im Rausch.
Ein Rausch, der wie alle Hochgefühle viel zu kurz anhält. Den folgenden Kater nennen Sportpsychologen ganz anglophil „Post-Goal-Depression“. Erlösung und Hochgefühl stürzen in sich zusammen. Eine Antiklimax, die sich am leichtesten bekämpfen lässt, indem ein neues Ziel identifiziert wird. Die nächste Herausforderdung, vielleicht wieder ein wenig länger, ärger, schmerzhafter.
Manche mögen das Sucht nennen, andere nennen es treffender: Radfahren. Zeit für eine Hymne auf die schönste aller Fortbewegungsarten! In diesem Sinne: Was interessiert das Geschwitz von gestern, wenn es heute wieder losgehen kann?
Zehntausende, die sich niemals hätten leisten können, ein Pferd zu kaufen, durchzufüttern und unterzubringen, kamen durch diese glänzende Erfindung
in den Genuss der schnellen Fortbewegung.
Frances Willard, US-Frauenrechtlerin
und Sozialreformerin (1839–1898)
Wer mit dem Rad durch verstopfte Städte pendelt, wird sehr wahrscheinlich andere Verkehrsteilnehmer anschreien. Etwa, wenn ein Autofahrer beim Rechtsabbiegen den Radler übersieht und fast ins Jenseits befördert; oder wenn ein Autofahrer den Radler so knapp passiert, dass zwischen Außenspiegel und Außenhaut kaum ein menschliches Haar passt. Solche lebensgefährlichen Begegnungen lassen Radler schäumen. Es ist ein täglicher Kampf ums Überleben, der ein starkes „Wir-gegen-sie-Gefühl“ weckt: Radfahrer gegen Autofahrer – sie scheinen natürliche Feinde zu sein. Doch eigentlich gehören sie zusammen, sie sind Familie: Ohne die Entwicklung des Fahrrads wäre das Automobil kaum denkbar gewesen. Der amerikanische Verkehrsforscher James Flink hat es so formuliert: „Keine vorherige technische Innovation – nicht einmal der Verbrennungsmotor – war für die Entwicklung des Automobils so wichtig wie das Fahrrad.“ Vielleicht lindert das die täglichen Hassgefühle im Straßenkampf ein wenig: Bei der nächsten Konfrontation mit einem Autofahrer einfach daran denken, dass die Blechkisten ohne das Fahrrad gar nicht da wären.
Die Erfindung des Fahrrads verhalf Techniken wie dem Kugellager, dem Differenzialgetriebe, dem Speichenrad oder dem Luftreifen zum Durchbruch. Das Fahrrad beförderte die Notwendigkeit, Leichtbaumaterialien zu entwickeln. Der kommerzielle Durchbruch des Rads trieb die Entwicklung standardisierter Massenfertigungsverfahren voran und schuf wesentliche Teile der industriellen Basis, aus der später die Autobranche entstand. Selbst der Straßenbau wurde einst von Radfahrern vorangetrieben – lange bevor es Autos gab, die diesen Raum für sich reklamieren konnten.
„Erst das Fahrrad, dann das Auto“, sagt auch Thomas Kosche vom Technoseum in Mannheim. Der Sammlungsleiter des Hauses hat die Ausstellung „2 Räder – 200 Jahre. Freiherr von Drais und die Geschichte des Fahrrades“ kuratiert. Und auch er versteht diese Aussage in dem Sinne, dass wesentliche technische Komponenten des Autos zunächst für das Fahrrad entwickelt wurden. Wie nahe sich die beiden Verkehrsmittel einst standen, verdeutlicht eine Ausgabe von „Meyers Konversations-Lexikon“ aus dem Jahr 1894: Gottlieb Daimlers Motorvierrad, eines der ersten Autos der Welt, wird darin ganz selbstverständlich unter dem Stichwort „Fahrrad“ präsentiert. Ohne Fahrrad kein Auto.
Zu Beginn dieser so konfliktreichen Verkehrsgeschichte rumpelte Karl Freiherr von Drais auf einer klobigen Laufmaschine von Mannheim aus auf der gepflasterten Chaussee in Richtung Schwetzingen; damals die beste Straße weit und breit. An jenem 12. Juni 1817 bot der Freiherr seinen Zeitgenossen einen wohl bizarren Anblick: ein Mann auf einer hölzernen Konstruktion, deren zwei Räder hintereinander angeordnet waren. Mit seinen Füßen stieß sich der Freiherr im Rhythmus vom Boden der Chaussee ab – wie seltsam! Aus heutiger Perspektive wecken Gerät und Fahrt des Freiherrn von Drais eher ein mildes Lächeln. War der Mann doch auf einer grobschlächtigen Variante jener Geräte unterwegs, auf denen heute kleine Kinder üben, die Balance zu halten: einem Laufrad. Dabei soll es sich um eine revolutionäre Idee gehandelt haben?
Ein hölzernes Laufrad als Keimzelle all der übermotorisierten Audis, BMWs und anderen Fabrikate ist nur schwer vorstellbar und vielleicht einer der Gründe, weshalb Freiherr von Drais als Erfinder geringere Lorbeeren erhalten hat als etwa Carl Benz oder Gottlieb Daimler. Ein anderer Grund könnte darin liegen, dass das Fahrrad als Idee so offensichtlich und bar jeden Geheimnisses erscheint, dass dessen Erfindung kaum wie eine große intellektuelle Leistung erscheint. Es löst eher Verwundern aus, dass erst so spät in der Geschichte jemand auf die Idee gekommen ist, dieses Gerät zu bauen.
Wie unfair! Allein der Gedanke, zwei Räder hintereinander statt nebeneinander anzuordnen, stellte eine kleine Revolution dar: Bei Drais’ Zeitgenossen weckte dies Unverständnis und Furcht. Der Begriff „Balancierangst“ tauchte damals auf. Wie sollte so eine Maschine fahren, ohne umzufallen? In der Natur existiert für dieses Prinzip kein Vorbild, der Erfinder ließ sich, wie er einmal schrieb, von Schlittschuhläufern inspirieren, die trotz dünner Kufen nicht umkippen. Und Drais erkannte ein wesentliches Element: Eines der beiden Räder muss frei lenkbar sein. Ansonsten verhält sich so ein Zweirad, als sei es in Straßenbahnschienen verkeilt – es stürzt zur Seite.
Hunger trieb seine Erfindung voran. Die Verwüstungen während der napoleonischen Kriege ließen die Preise für Getreide drastisch steigen. Und dann sorgte der Ausbruch des Tambora 1815 in Indonesien für das sogenannte Jahr ohne Sommer. Die monströse Explosion des Vulkans beförderte derartige Mengen Asche in die Atmosphäre, dass weltweit Ernten ausfielen. Menschen hungerten, und Pferde zu unterhalten wurde noch teurer als zuvor schon. Drais trieb die Idee an, einen mechanischen Ersatz zu konstruieren. Eine Maschine, die nicht gefüttert werden musste. „Das Pferd, das kein Heu braucht“ lautete eine französische Reklame aus der Frühzeit des Fahrrads. Ressourcenknappheit kurbelte die Erfindung des Fahrrads an; so wie in der Gegenwart das Rad als Verkehrsmittel auch aus ökologischen Gründen eine Renaissance erlebt. „Das Rad, das kein Benzin braucht“ würde die Werbung heute lauten.
Auf seiner Jungfernfahrt legte Drais 12,8 Kilometer zurück – innerhalb einer Stunde. Die Laufmaschine zeigte sich damit Postkutschen überlegen. Diese rumpelten mit Geschwindigkeiten von wenig mehr als drei Kilometern pro Stunde über die ziemlich erbärmlichen Straßen. Es war wie heute: Auf kurzen Distanzen bis fünf Kilometer ist das Rad in der Stadt auf jeden Fall das schnellste Verkehrsmittel. Damals übertrumpfte es die Postkutsche, heute rollen Radler geschmeidig an langen innerstädtischen Staus vorbei und kommen schneller voran. Konflikte zwischen Verkehrsteilnehmern gab es übrigens bereits zu Drais’ Zeiten. Sieben Monate nach der Jungfernfahrt verbot Mannheim den wenigen Fahrern der Laufmaschine, Bürgersteige zu nutzen – zum Schutz der Passanten. Der Radler als Rowdy, auch dieses Bild verfügt über eine lange Tradition.
Die Zweiräder des Freiherrn gerieten dennoch in Vergessenheit. Die Geräte waren trotz aller Vorzüge zu teuer, lediglich der Adel und das reiche Bürgertum verfügten über die nötigen finanziellen Mittel, sich so ein Spielzeug zu kaufen. Das änderte sich zunächst auch nicht, als die Laufmaschine in den 1860er-Jahren in Frankreich einen entscheidenden Schritt weiterentwickelt wurde. Der Wagenbauer Pierre Michaux oder Pierre Lallement – es herrscht Uneinigkeit darüber, welchem der beiden die Erfinderehre gebührt – statteten das Vorderrad als Erste mit Tretkurbeln aus, ein entscheidender Schritt in der Fahrradwerdung. Zugleich verblüfft es, dass es Jahrzehnte dauerte, bevor jemand Pedale an der Laufmaschine des Freiherrn von Drais befestigte. Ein Problem jedoch bremste die frühen Radfahrer im Wortsinne: Eine Pedalumdrehung entsprach einer Umdrehung des Rades. Das limitierte die Geschwindigkeit.
Die frühen Tretkurbel-Velozipede des Unternehmens Michaux & Cie wurden aus Gusseisen gefertigt oder geschmiedet. Die ohne Zweifel robusten Geräte wogen teils mehr als 40 Kilogramm, ein enormes Gewicht, das eine Fahrt zur Tortur mit Muskelkatergarantie machte. Kleiner Vorschlag: Um ein Gefühl dafür zu bekommen, einfach eine gusseiserne Pfanne in die Hand nehmen und über das Gewicht staunen. Genau, irre schwer. Trotzdem erlebte das Tretkurbel-Veloziped einen erstaunlichen Boom in Frankreich, Großbritannien und den USA. Dort lösten Konstrukteure in den 1870er-Jahren das Gewichtsproblem, indem sie hohle Gasrohre nutzten, um daraus Fahrradrahmen zu fertigen. Als dann Firmen wie Mannesmann die Herstellung nahtloser Stahlrohre perfektionierten, wurde das Fahrrad zu einem Produkt aus Hightechmaterial. Sehr früh arbeitete die Fahrradindustrie also mit Werkstoffen, die das Gewicht ihrer Produkte reduzierten.
Auch das Gewicht sogenannter Sociables, mehrrädriger Fahrräder, auf denen mehrere Personen in die Pedale traten, ließ sich so reduzieren und brauchbar machen. Carl Benz verwendete für seinen Wagen, den er 1886 in Mannheim vorstellte, ebenfalls Gasrohre. Er kopierte die Idee amerikanischer Fahrradbauer, um das Gewicht seiner Maschine gering zu halten – auf dass der Motor den Wagen bewegen konnte. Die Räder stammten im Übrigen aus der Hochradfabrik Kleyer in Frankfurt am Main, das erste Auto bestand größtenteils aus Fahrradkomponenten. Da klingt es schlüssig, dass die Konstruktionen von Benz und Daimler damals als Fahrräder oder Motor-Velozipede bezeichnet wurden.
Der Mensch neigt zur Trägheit: Man muss ja das Rad nicht ständig neu erfinden. Tatsächlich hat sich die Menschheit etwa 5000 Jahre lang nicht bemüht, das Rad wesentlich weiterzuentwickeln – bis Radfahrer schneller werden wollten. Jahrtausendelang stellten Handwerker Räder her, die auf Druck konstruiert waren. In die Nabe steckten sie hölzerne Speichen und befestigten daran die Felge. Darum legten sie einen glühenden Ring aus Metall, der sich beim Abkühlen zusammenzog und die Speichen gegen die Nabe drückte. Diese Räder waren schwer und klobig. Auf Zug konstruierte Speichenräder reduzierten das Gewicht: Die Drahtspeichen werden dazu an der Nabe eingehängt. Mit einer Schraube in der Felge ziehen sie an der Nabe – und stabilisieren so das Rad.
Mit der Neuerfindung des Rades, dem Zugspeichenrad, konnten Konstrukteure das Problem der beschränkten Geschwindigkeit angehen. Der Brite James Starley, der später als „Vater der Fahrradindustrie“ bezeichnet wurde, entwickelte ein Rad mit dünnen Metallspeichen in Massenproduktion. Dadurch wurden die Räder so leicht und stabil, dass sie in immer größeren Umfängen gefertigt werden konnten. Die Zeit der Hochräder brach an: Wenn eine Pedalumdrehung einer Radumdrehung entspricht, dann machen wir die Räder einfach immer größer, so die Überlegung. Starley präsentierte sein Modell namens Ariel, dessen Vorderrad einen Durchmesser von 1,25 Metern hatte.
Kurbeln und Radnaben dieser Modelle wurden zudem erstmals in großem Umfang mit Kugellagern ausgestattet. Das verringerte die Reibung bei der Raddrehung massiv. Auf diese Weise ließen sich mit Hochrädern Geschwindigkeiten von mehr als 30 Kilometern pro Stunde erreichen – und das eigene Leben aufs Spiel setzen. Stießen die auch „Dandy Horses“ genannten Geräte an ein halbwegs großes Hindernis, einen Stein, ein Schlagloch, dann stürzten die Fahrer aus beträchtlicher Höhe auf den Schädel und machten einen „Header“, wie die reichen britischen Schnösel das nannten, die sich damals ein solches Prestigeobjekt leisten konnten.
Am 7. November 1869 startete in Paris eines der ersten Radrennen der Geschichte. Es nahm den heutzutage so sagenhaft miesen Ruf des Radsports vorweg, denn James Moore errang den Sieg quasi durch technisches Doping. Die Strecke führte aus der französischen Hauptstadt bis nach Rouen, etwa 125 Kilometer, die auf schweren Rädern und holprigen Straßen bewältigt werden mussten. „Ich werde als Erster ankommen, oder ihr findet mich tot auf der Straße“, soll der ehrgeizige Rennfahrer vor dem Start gesagt haben. Woher seine Sicherheit rührte? Er fuhr als einziger Teilnehmer ein Rad, dessen Pedalachsen Kugellager enthielten. Sein Vorbild machte Schule: Es wurden auch Naben mit den Lagern ausgestattet, die von der Fahrradindustrie bald millionenfach hergestellt wurden.
Weitere wichtige technische Impulse kamen aus der Fahrradindustrie. Manche dieser Ideen zeigen: Die scheinbaren Langweiler sind oft die wirklichen Revolutionäre. Der Schweizer Hans Renold war so ein Typ. 1880 meldete er eine Kette zum Patent an, die heute Abermillionen Fahrräder antreibt und auch im Maschinenbau unersetzlich ist: die Rollenkette. Über die inneren Streben der Kette positionierte Renold bewegliche Hülsen. Simpel und revolutionär. Zum einen setzt sich darin ausreichend Schmiermittel fest, zum anderen verringern die Rollen die Reibung an den Ritzeln und reduzieren so den Verschleiß. Unscheinbar, aber irre wichtig. Renold, dessen Werk in Manchester lag, führte außerdem 1895 eine Firmenkantine ein, 1896 die 48-Stunden-Woche, duldete Betriebsräte und Gewerkschaften, gründete ein Sozialwerk und beteiligte seine Arbeiter am Firmengewinn. Ein echter Revolutionär.
Leichte, stabile Laufräder, gewichtsreduzierte Rahmen, Kugellager, später Naben mit Freilauf und Differenzialgetriebe: Wichtige Zutaten für die Entwicklung des Automobils hatte die frühe Fahrradindustrie damit ins Ersatzteillager der Motoristen gelegt. Der Durchbruch kam mit der Erfindung des Nieder- oder Sicherheitsrades sowie dessen anschließender Produktion als erstes individuelles Massenverkehrsmittel. Der Brite John Kemp Starley, Neffe des Speichenradkonstrukteurs James Starley, verlegte den Schwerpunkt des Radlers aus der Höhe wieder in die Nähe der Straße – die Pedale trieben nun über eine Kette das Hinterrad an. Dieses 1885 im britischen Coventry vorgestellte Rover-Sicherheitsrad entspricht etwa jener Form, die Räder noch heute haben.
Binnen weniger Jahre stellte halb Coventry eigene Sicherheitsräder mit Diamantrahmen her; diese Rahmenform aus zwei Dreiecken ist bis heute jene, mit der fast alle Räder konstruiert werden. Das Fahrrad in seiner gültigen Form war gebaut, und die mit Luft gefüllten Räder nach dem Prinzip des Schotten John Boyd Dunlop reduzierten die Erschütterungen, die einen Radler zuvor so kräftig durchgerüttelt hatten.
Schließlich präsentierte sich das Fahrrad gegen Ende des 19. Jahrhunderts als derart ausgereiftes Produkt, dass Firmen in die Massenproduktion einstiegen. Frühe Fahrräder waren noch handwerklich gefertigte Einzelstücke. Ersatzteile mussten auf jedes Rad angepasst werden. Fertigungsprinzipien aus dem Nähmaschinenbau, der Herstellung von Taschenuhren und Schreibmaschinen wurden nun übernommen, um den Ausstoß in Fahrradfabriken zu erhöhen und den Preis für ein Rad zu drücken. Kostete um 1890 ein Sicherheitsrad noch ungefähr 500 Mark, damals ein guter Jahreslohn eines deutschen Facharbeiters, fiel der Preis um die Jahrhundertwende auf etwa 100 Mark. In den USA rollten im Jahr 1890 etwa 15 000 Radfahrer durch Städte, Dörfer und über Land. Dann explodierte die Verbreitung des Fahrrads: Binnen fünf Jahren fiel der Preis für ein Rad von etwa der Hälfte des durchschnittlichen Jahreslohns eines Fabrikarbeiters auf wenige Wochenlöhne. Von 1895 an verkaufte die Radindustrie in den USA jährlich etwa eine Million Fahrräder.
Um die Nachfrage zu bedienen, hatten Hersteller wie die US-Marke Columbia Bicycles oder die von John Kemp Starley in Coventry gegründete Rover Bicycle Company Massenfertigungsverfahren entwickelt, die später von Ford und General Motors kopiert wurden. Sogar eine eigene Zulieferindustrie entstand. Der Erfolg der Wundermaschine Fahrrad befeuerte die Kreativität unzähliger Erfinder, fast so, als sei die Fahrradindustrie das Silicon Valley des 19. Jahrhunderts gewesen. In den 1890er-Jahren betraf ein Drittel aller im US-Patentamt von Washington D. C. registrierten Patente Verbesserungen, die für das Fahrrad konzipiert worden waren. Das Amt richtete sogar ein eigenes Gebäude ein, in dem ausschließlich für das Fahrrad relevante Erfindungen bearbeitet wurden. Das Fahrrad beflügelte die Fantasie und den Erfindungsreichtum der Menschen – und zugleich reagierten viele konsterniert und verblüfft, dass etwas derart Simples und Naheliegendes wie diese Maschine nicht schon sehr viel früher erfunden worden war.
Die purzelnden Preise verwandelten das Statussymbol in das erste massenhafte Individualverkehrsmittel, auf denen von 1910 an auch Arbeiter und Frauen mobile Freiheit erlebten. Viele Firmen, die einst als Fahrradhersteller begonnen hatten, nutzten ihr Wissen nun, um auf die Herstellung von Automobilen umzusteigen. Die Rover Bicycle Company stieg in die Autoproduktion ein, ebenso Peugeot, Opel, Morris und viele andere. Sie kopierten Fließbandtechniken, Herstellungsverfahren sowie die Werbestrategie der Fahrradbranche. Henry Ford – das nebenbei – war gelernter Fahrradmechaniker. Genauso die Brüder Wilbur und Orville Wright, die dem Rad das Fliegen beibrachten und das erste Motorflugzeug bauten.
Nach dem Zweiten Weltkrieg brach die große Zeit des Automobils an. Diese engen Verwandten des Fahrrads entwickelten sich zu einem für die Massen bezahlbaren Produkt und Statussymbol – auf den Schultern des Freiherrn von Drais und seiner klobigen Laufmaschine. Dass sich Rad- und Autofahrer im Berufsverkehr so vieler Städte heute anschreien, liegt wohl daran, dass Räder zu schmal waren, um in den entscheidenden Jahren der Stadtplanung berücksichtigt zu werden. So müssen sich Radler heute ihren Platz zurückerobern. Eventuell treibt sie dabei der Gedanke voran, dass Rad und Auto keine natürlichen Feinde sind, sondern enge Verwandte; und in Familien wird eben besonders leidenschaftlich gestritten.
Um die unweigerlichen Konflikte zwischen Autofahrern und Radlern leichter zu ertragen, hilft ein weiterer Gedanke: Die Straßen gehören auch uns, denken sich zu Recht viele Radler; aber mehr noch: Sie könnten sich mit Fug und Recht auf den Standpunkt versteifen, dass ihre Vorgänger erst dafür gesorgt haben, dass es diese Straßen überhaupt gibt. Denn noch etwas übernahm die junge Autoindustrie um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert: die Kampagnen für die Verbesserung der Straßen. In Großbritannien, den USA und Deutschland waren es zuvor Fahrradklubs gewesen, die sich dafür engagierten, die Matsch-, Schotter- und Schlammpisten ihrer Länder so herzurichten, dass sie mit dem Fahrrad befahrbar wurden. Mit eisernen Rädern oder Reifen aus Vollgummi über Kopfsteinpflaster und ruppige Wege zu rumpeln muss Radlern früher indessen massive Schmerzen bereitet haben.
Um ein Gefühl dafür zu bekommen, sei jedem die Teilnahme an dem Rennen Paris-Roubaix empfohlen. Das Rennen wird seit 1896 ausgetragen und hat sich den verharmlosenden Spitznamen „Die Hölle des Nordens“ verdient. Von den etwa 250 Kilometern Strecke führen gute 50 Kilometer über Abschnitte mit Kopfsteinpflaster.
Als Amateur darf man am Tag vor dem Profirennen über die Foltersteine Nordfrankreichs rumpeln. Die gepflasterten Wege stammen allesamt noch aus napoleonischen Zeiten und werden seitdem nur mehr für das Rennen gepflegt, das für den Radsport so etwas wie Wimbledon für das Tennis ist. Die Pflastersteine sind nach 200 Jahren glatt und rutschig und stehen weit auseinander, sodass die Räder weniger über eine gepflasterte Fläche rollen als über einen steinernen Parcours.
Auf dem ersten pavé – so heißen die Abschnitte – stürzen an diesem Aprilmorgen reihenweise Fahrer. Die Feuchtigkeit der Nacht ist noch nicht verdunstet, die Hobbyradler schlingern, rutschen und fallen. Überall liegen Trinkflaschen herum, die durch die Erschütterungen aus den Halterungen fliegen. Erstaunlich ist, dass die Rennräder diese Schüttelfolter überhaupt aushalten. Im Laufe des Tages treffen wir auf verblüffend wenige Fahrer, die neben ihren kaputten Rädern stehen.
Der Körper hingegen erlebt eine ganz neue Art des Fahrradschmerzes: Viele Fahrer leiden an offenen Blasen an den Händen. Die Frage nach der richtigen Technik bleibt unbeantwortet: Hilft es, den Lenker so fest wie möglich zu packen, oder sollten wir doch lieber nur locker zugreifen, um weniger Erschütterungen abzubekommen? Die Stöße ermüden, der ganze Körper vibriert. Am nächsten Tag sind die Hände geschwollen, der Ehering geht nicht mehr vom Finger, und es tut weh zuzupacken. Paris-Roubaix bereitet den Teilnehmern die erlesensten Schmerzen des Radsports – und wir hatten gutes Wetter. Wie wäre das erst gewesen, wenn Regen die Kopfsteinabschnitte in schlammige Rutschpartien verwandelt hätte?
Straßen wie jene bei Paris-Roubaix zählten in der Frühzeit des Fahrradfahrens noch zu den besseren Wegen – und darauf die Tretkurbel-Velozipedisten auf Rädern aus Metall. „Knochenschüttler“ wurden diese Maschinen spöttisch genannt – und die Erfahrung bei Paris-Roubaix legt den Gedanken nahe, dass „Knochenbrecher“ das passendere Wort gewesen wäre. Der deutsche Schriftsteller Eduard Bertz (1853–1931) schilderte in seinen Schriften eindringlich die höllischen Schmerzen des Fahrradfahrens – und leitet daraus, wie so viele andere Radfahrer seiner Zeit, ein Plädoyer für den Ausbau und die Verbesserung der Straßen ab. Auch in Großbritannien und den USA kämpften organisierte Radfahrer für die Verbesserung der Straßen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte sich nämlich der Zustand vieler Straßen erheblich verschlechtert: Der Erfolg der Eisenbahn hatte dazu geführt, dass die Instandhaltung des Wegenetzes, auf dem einst Postkutschen unterwegs gewesen waren, stark vernachlässigt wurde. Also liebe Autofahrer, halten wir fest: Der Urimpuls für den Ausbau der Straßen dieser Welt stammte einst von Radfahrern.
Neben dem Straßenbelag bescherten die Schmerzen auf dem Fahrrad der Welt den Durchbruch einer weiteren revolutionären Idee: den mit Luft gefüllten Reifen. Der schottische Tierarzt John Boyd Dunlop wurde zunächst verspottet, sah sein Prototyp zugegebenermaßen zunächst auch aus wie eine als Mumie verkleidete Pizza: Er hatte mit Ventilen versehene Gummischläuche um die Holzräder des Dreirads seines Sohnes geschlungen und mit Leinenhüllen festgeheftet. Doch es wirkte: Spötter sprachen zwar von „Blasen- und Puddingreifen“, doch nachdem ein irischer Journalist mit Luftreifen durch Coventry geradelt war, das Zentrum der britischen Fahrradindustrie, setzte sich die Technik schlagartig durch.
In diesem Sinne, liebe Autofahrer, ohne diese lästigen Radfahrer gäbe es euch und eure Gefährte überhaupt nicht. Daran denken wir, wenn wir uns wieder mal in die Haare bekommen.
„Das Buch des Münchner Autors [...] ist eine ebenso witzige wie verblüffende Hymne an die anmutigste und berauschendste Art der Fortbewegung.“
„Drahteselliebhaberinnen, unbedingt lesen!“
„Eine höchst kenntnisreiche, authentische und damit informative, amüsante, nicht selten zur Selbstreflexion anregende Lektüre - wenn man ausnahmsweise mal auf dem Sofa statt auf dem Sattel sitzt.“
„Von Beinahe-Unfällen kann auch Sebastian Herrmann in seiner flott und gewissermaßen stets im höchsten Gang geschriebenen ›Gebrauchsanweisung fürs Fahrradfahren‹ ein Lied singen. (…) Herrmann gelingt es, seine Leidenschaft 1:1 aufs Papier zu bringen.“
„Sebastian Herrmann beschäftigt sich in seiner ›Gebrauchsanweisung fürs Fahrradfahren‹ mit allen Facetten dieser schönsten aller Fortbewegungsarten.“
„Ein nicht nur wissens- und kenntnisreich geschriebenes Buch, sondern auch noch ein witzig unterhaltsam geschriebenes. Und wenn man nicht schon Fahrradfan wäre, dann würde man es nach der Lektüre glatt werden.“
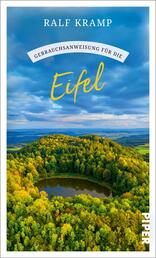

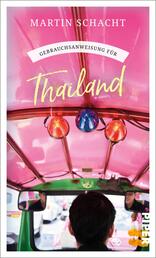
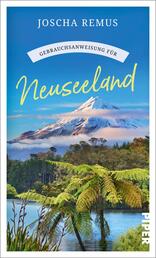





DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.