

Gegenwind Gegenwind - eBook-Ausgabe
Vom Wachsen an Widerständen
— Persönlich wie nie - die neue Autobiografie des Extrembergsteigers„Lesenswert“ - Der Tagesspiegel
Gegenwind — Inhalt
Eine, wenn nicht die Konstante in Reinhold Messners Leben ist der Gegenwind: ob als schwere Stürme auf dem Weg zum Südpol mit Arved Fuchs oder mit seinem Bruder Hubert über das Grönland-Eis, ob allein beim Zeltaufbau oder in den steilsten Wänden. Vor allem zurück in der Zivilisation, wo seine Taten von jeher Widerspruch provozieren. Schon als junger Bergsteiger wurde er diskreditiert; immer wieder erlebte er Anfeindungen – als meinungsstarker Individualist, Autor und Museumsmacher. Mit der Erfahrung aus acht Jahrzehnten reflektiert Messner Freundschaften und Intrigen, alpinistische wie private Höhepunkte und Rückschläge. Eindrucksvoll vermittelt er, wie Gegenwind Flügel wachsen lässt. Und die Fähigkeit, auch im Alter Träume zu realisieren.
„Sein Name ist Marke und Programm zugleich.“ Focus
- Mit über vierzig Abbildungen
Leseprobe zu „Gegenwind“
Gegenwind
„Es ist meine Erziehung, die zum Rebellentum führte: Mich gegen Schranken aufzulehnen, diese zu überwinden, förderte meine Entwicklung. Jede von mir als ungerecht, störend oder sinnlos empfundene Grenze wurde zuerst infrage gestellt und dann überwunden.“
Reinhold Messner
Eine, wenn nicht die Konstante in meinem Leben bleibt der Gegenwind. Arved Fuchs und ich begegneten ihm auf dem Weg zum Südpol. Oft zum Sturm gesteigert, blies er uns vom Pol her entgegen. Tag für Tag. Wir hatten Segel dabei, versuchten zu kreuzen, vergeblich. Wir fuhren auf [...]
Gegenwind
„Es ist meine Erziehung, die zum Rebellentum führte: Mich gegen Schranken aufzulehnen, diese zu überwinden, förderte meine Entwicklung. Jede von mir als ungerecht, störend oder sinnlos empfundene Grenze wurde zuerst infrage gestellt und dann überwunden.“
Reinhold Messner
Eine, wenn nicht die Konstante in meinem Leben bleibt der Gegenwind. Arved Fuchs und ich begegneten ihm auf dem Weg zum Südpol. Oft zum Sturm gesteigert, blies er uns vom Pol her entgegen. Tag für Tag. Wir hatten Segel dabei, versuchten zu kreuzen, vergeblich. Wir fuhren auf unseren Skiern zwar schnell, aber nicht in Richtung Pol, gewannen keinen Meter Boden. Also zogen wir die Schlitten über den stumpfen Schnee, quälten uns durch Sastrugi-Felder und hofften auf Rückenwind. Bis zum Südpol vergebens. Auf der anderen Seite, beim Abstieg von der Polkappe nach McMurdo, endlich der richtige Wind! Das Schlittengewicht, das uns über tausend und mehr Kilometer gebremst hatte, war jetzt reduziert, Proviant und Brennstoff verbraucht, der Wind fiel uns vom Pol her in den Rücken, so machten wir Boden gut.
Jahre später, in Grönland, ich war mit meinem Bruder Hubert unterwegs, schaffen wir es, die schweren Schlitten von Osten kommend über den Rücken der Eisinsel zu schleppen, um auf der Westseite mit Seitenwind und Segelunterstützung nordwärts zu fahren.
1986 mit Hans Kammerlander, in der Eisrinne am Lhotse-Normalweg, fuhr uns der Jetstream von hinten an und trieb uns nach oben, eine willkommene Steighilfe. Ansonsten war der Wind meist gegen mein Vorankommen gestanden – an schmalen Graten, beim Zeltaufbau, in der Gipfelwand. Vor allem dann – zurück in der Zivilisation –, wenn es galt, Kritik auszuhalten.
Mein Bergsteigen ist mehr Kunst als Sport: Die Linien meiner Wege, das Erzählen darüber, die Auseinandersetzung mit der Gefahr, das viele, das bleibt.
Wir Bergsteiger wachsen an Widerständen. Oder scheitern an solchen und bleiben im Tal. Ob Felswand oder Gebirge, wer hinauf- oder darüber hinwegwill, muss Widerstände überwinden.
Mehr noch als Kraft und Geschicklichkeit braucht es Ausdauer dafür. Paul Preuß, der 1911 – allein, ohne Seil, in schnurgerader Linie – durch die senkrechte Ostwand der Guglia di Brenta in den Dolomiten turnte, setzte ein Zeichen. Gleichzeitig hinterließ er mit dieser Tat ein Kunstwerk, das weder sichtbar noch hörbar ist, nichtdestotrotz aber existiert. Für immer! Ähnliches gilt für Hermann Buhl, der 1953 am Nanga Parbat über den Silbersattel hinweg zum Gipfel stieg. Er zeigte damit nicht nur, zu welcher Ausdauerleistung der Mensch fähig ist. Er hinterließ uns ein bleibendes Zeichen seiner Kreativität, Willenskraft und Leidensfähigkeit. Als Alexander Huber 2007 einen frei kletterbaren Weg durch das Riesendach der Westlichen Zinne in den Dolomiten zuerst erfand, war das eine schöpferische Tat; als er dieser Linie spinnengleich folgte, war das eine unverwechselbare Aktion, die der Kunst näher steht als dem Sport. Auch er hat Zeichen gesetzt. Mit seinem Geist. Alle diese Lebensäußerungen sind nicht nur beklatscht worden, viele unserer Taten und noch mehr unsere Haltung dazu wurden kritisiert, infrage gestellt, ja, verteufelt. Damit erst wurden sie Teil der großen Legende. Bergsteiger haben selten die Fähigkeit, sich mit Pinsel, Meißel, Worten oder Noten auszudrücken. Sie tun es mit ihren Mitteln: an den gewaltigsten Flächen, in den größten Arenen und zwischen den Runzeln dieser Erde. Ihre Kunst entsteht im Spannungsfeld zwischen der Bergnatur und der Natur des Menschen, zwischen dem Vertrauten und dem Fremden, zwischen Selbstverschwendung und möglicher Selbstzerstörung, die es Schritt für Schritt, Griff für Griff zu verhindern gilt. In einem ähnlichen Spannungsfeld agiert auch der Künstler. Beseelt vom selben Geist wie der Grenzgänger, wenn er seine Zeichen ins unberührte Gebirge setzt, ist auch der Künstler ganz Hingabe. Auch er steigt auf Berge und hinterlässt Spuren – sogar sichtbare: in Baumstämme gefasst; hörbare: wenn der Wind mit den Seilen spielt, die seine Skulpturen sichern; greifbare: wo seine Farben in die Natur hineingewoben sind. Vielleicht ist sein Blick dem, der von oben kommt, ähnlich, ein Überblick übers Ganze.
Wir alle kehren in unser eigenes Leben zurück, wenn wir vom Berg herunterkommen – das Echo, die Stille, die Weite des Himmels und die Entschleunigung der Höhe in uns – als Überblick nach innen. Als wäre es mein Schicksal, mich mit mir als Skeptiker auseinanderzusetzen.
Warum ist dieses merkwürdige Spiel, das uns nutzlos und sinnvoll zugleich erscheint, zwischen Kunst und Sport angesiedelt? Weil traditionelle Bergsteiger in einer archaischen Welt nach anarchischen Mustern spielen? Da kämpfen Menschen nicht gegeneinander, sondern miteinander, es geht um die eigene Existenz – nicht um Regeln –, ums Durchkommen oder Umkommen und wie das scheinbar Absurde von Außenstehenden wahrgenommen wird.
Es gilt heute den letzten Rest Wildnis vor der Zivilisation zu schützen, die Tat vor den Konsum zu stellen und zivilisatorischen Widerstand zu ertragen.
Ich selbst habe viel Gegenwind ausgehalten, bin oft – wieder und wieder – gescheitert, ließ mich trotzdem nicht beirren. Die Kritiker kamen und verschwanden wieder, andere stellten mir ein Leben lang nach, und so manche wollen immer noch nicht einsehen, dass es auch ihr Verdienst ist, wenn ich überlebt habe. Gegenwind lässt Flügel wachsen.
Ich habe von meinen Wunden und Schicksalsschlägen erzählt, habe Vorwürfe der schlimmsten Art ausgehalten, Prüfungen, die weit über meine Kräfte – nicht selten war es Rufmord – hinausgingen. Aus alldem ist jene Legende gewoben worden, die ich nie sein wollte. Es ist nicht allein mein Verdienst, Teil der großen Story des Alpinismus geworden zu sein. Meine vielen Gegner haben wesentlichen Anteil daran.
Das Narrativ zum traditionellen Bergsteigen ist Erzählung, damit auch Fantasie, Legende. Es ist die Erzählkunst der Pioniere, die Kraft der Bilder der Neuerer aus 200 Jahren Tat, die uns ausfüllen. Meine Generation hat die alten Geschichten übernommen, mit neuen Erlebnissen ergänzt, und so erzählen wir die Legende fort. Mit meinem Start-up MMH – zusammen mit meiner Frau Diane zu meinem 75. Geburtstag gegründet – wollen wir all das am Leben erhalten und verteidigen, was Millionen von Bergenthusiasten rund um den Globus begeistert. Wir sind eine stille Gemeinschaft, der Vereinsstatuten nichts und die Berge alles bedeuten. Wir sind Teil der großen Erzählung, pfeifen aber auf alle Formen von Sekten.
Mein Erbe – MMH für „Messner Mountain Heritage“ – ist nicht materieller Art. Es ist der Geist, der den traditionellen Alpinismus beseelt, seine Respektshaltung.
1 Eigenverantwortung
„Menschennatur und die Bergnatur sind nur so zu verstehen, wenn sie sich begegnen.“
Werner Heisenberg
Als Dorfkinder aufgewachsen, lernten wir früh, Verantwortung zu tragen. Für die jüngeren Geschwister, für die Arbeit, die wir zu Hause zu tun hatten – im Hühnerstall, beim Holzholen, beim wöchentlichen Säubern des Gartens. Ich denke nicht an Idylle, wenn ich die Bilder aus der Kindheit in mein Gedächtnis zurückhole: keine Kirchtürme auf grünen Hügeln, keine Schafherden auf den Wiesen, nur Begeisterung für die Berge: Wald und die fernen Felstürme darüber. Was inzwischen Zeitgeist geworden ist – das Leben auf dem Land, die Bewunderung für das Erhabene und dass dort jeder jeden kennt und grüßt –, für uns war es alltäglich.
Wir hatten ein pragmatisches Verhältnis zum Dorf und der nächsten Umgebung. Der Wald war Abenteuerspielplatz, die Scheunen der Bauernhöfe Versteck, die Schotterstraße Treffpunkt einer Horde von Kindern, Mädchen und Buben zwischen vier und zwölf Jahren.
Ich wollte nie leben wie die Stadtkinder, nur dabei sein im Dorf, den Zusammenhalt spüren, keine gemeinsamen Spiele versäumen.
Das Draußensein war mit Eigenverantwortung verknüpft und deshalb so aufregend. Wenn ich krank war, allein im Zimmer unter der Decke, und von draußen die Vögel und spielende Kinder zu hören waren, tat das weh. Die Zeit lief rückwärts; ich hatte Angst: Angst, den Anschluss zu verlieren.
Als wir größeren Kinder im Sommer für ein paar Wochen auf die Gschnagenhardt-Alm durften, wurde alles anders. Da war kein Pfarrer, kein Lehrer, kein Bürgermeister, die uns Kindern wie im Dorf vorschreiben wollten, was wir zu tun und zu lassen hatten. Sogar die Eltern überließen uns dort oben nach einigen Testwochen uns selbst. Die Erkundung der weiteren Umgebung, das Beobachten der Wildtiere und die ersten leichten Klettertouren waren – weil selbst verantwortet – unser Stolz. Fels und Kar wurden ertastet, nicht verklärt. Gefahren lernten wir auszuweichen und Schwierigkeiten zu überwinden.
Widerstände zu überwinden ist uns Menschen in die Gene geschrieben. In der unberührten Natur galt und gilt es ständig, das Überleben zu sichern. Die dabei entwickelten Instinkte zwingen uns, auf Gefahren zu reagieren, unter allen Umständen, auch dort, wo Menschen – mit bösen Absichten – anderen Übles wollen. Meine Erfahrung dazu sagt mir, dass menschengemachter Widerstand zerstörerischer sein kann als natürlicher. Die Natur ist ohne Absicht, und dort, wo sie Wildnis geblieben ist, bleibt sie eine weise Lehrmeisterin.
Mein Zugang zur Natur entsprang nicht einer romantischen Idee, er sollte anfangs auch nicht ein Gegenentwurf zur Industrialisierung sein, noch weniger Naturschutz. Ich war mittendrin, ausgesetzt und dabei meinen Ängsten und Zweifeln ausgeliefert.
Damals ahnte ich nicht, dass dieses frühe In-die-Wildnis-geworfen-Sein zur Überlebenskunst werden sollte – in den höchsten Höhen sowie in den größten Wüsten dieser Erde. Mehr noch in einer Zivilisation, die inzwischen Verschwörungstheorien, Hass und professioneller Desinformation ausgeliefert ist. Mein Problem ist, dass ich mich im Cyberspace verliere.
2 Widerstand
„Meine Erziehung sollte nicht durch Schulbildung beeinträchtigt werden.“
Grant Allen
Berge trotzen jedem Gegenwind, sie sind absoluter Widerstand. Wir lernten es in den Geislerspitzen in den Dolomiten, die zwischen dem Villnöß- und dem Gröden-Tal senkrecht aufragen. Mein älterer Bruder Helmut erzählt davon, wenn er über eine gemeinsame Klettertour im Rahmen unserer Sommerferien auf Gschnagenhardt berichtet:
„Als Kinder und Jugendliche verbrachten wir viele Sommer auf Gschnagenhardt. Nachdem die Almwiesen Mitte August abgemäht waren, mieteten unsere Eltern vom alten Ranuier-Bauern Almhütte und Heuschupfe, wo wir im beißenden Heu schliefen. Auf der benachbarten Profanter-Alm kauften wir Milch und Butter. Dort oben erlebten wir eine unbeschwerte Zeit, genossen viel Freiraum. Und von der Alm aus erkundeten wir die nähere und weitere Umgebung der Geisler-Gruppe. Wir bauten ein Floß für den Teich im Sumpfboden, spielten Verstecken, sammelten Pfifferlinge sowie Himbeeren und ›Granten‹ (Preiselbeeren). Wir waren rund um die ›Prese‹ mit der Schleuder unterwegs und versuchten, Eichhörnchen und ›Gratschen‹ (Zirbenhäher) zu treffen, was uns nie gelang. Als wir etwas älter waren, zog es uns regelmäßig über die Panascharte auf die Seceda, blumenreiche Almwiesen auf der Südseite der Geisler, wo sich der Horizont öffnete und den Blick freigab auf das Gröden-Tal mit dem Sella-Stock und der imposanten Langkofel-Gruppe. Wir fühlten uns dabei wie die Entdecker einer neuen Welt. Auf den dortigen Almböden gab es mehrere Bergseen, in denen sich winzige Fische tummelten. Wir wandten viel Zeit und Tricks auf, solche Fischchen einzufangen und in Wasserflaschen lebend über die Mittagsscharte heimzutragen und im Teich auf Gschnagenhardt auszusetzen. Selten haben einige die Aktion überlebt.
Während dieser Sommerferien gingen wir oft zum Klettern. Ein Abenteuer ist mir in besonders lebhafter Erinnerung geblieben: Reinhold hatte die Idee, einen kürzeren, direkteren Übergang zur Südseite der Geislerspitzen zu finden, wobei er die enge Scharte zwischen Großer und Kleiner Fermeda ins Auge fasste. Diese Erkundungstour wollte Reinhold nur mit mir, ohne die jüngeren Geschwister, durchführen. Wir waren damals etwa dreizehn und fünfzehn Jahre alt. Wir nahmen das Bergseil des Vaters und einige Schlingen mit, um uns sichern oder abseilen zu können. Über brüchiges, nicht schwieriges Schrofengelände gelangten wir über die Nordseite auf die angepeilte Scharte und stiegen dann auf der Südseite in Richtung Seceda ab. Unvermittelt standen wir vor einem hohen Abgrund, für den das Seil nicht ausreichte, um uns abseilen zu können. An ein Abklettern war wegen des Überhangs unter uns nicht zu denken. Ich als der Ältere drängte darauf, umzukehren und über die Aufstiegsroute wieder abzusteigen. An der Nordseite!
Reinhold sah jedoch eine Möglichkeit, über eine schräge Felspartie auf die Südostkante der Kleinen Fermeda auszuweichen, von der uns Vater eindrucksvoll erzählt hatte. Wir beide hatten die Kleine Fermeda schon öfter bestiegen, mit dem Vater über die leichtere Normalroute. Reinhold zögerte nun nicht lange, querte über die exponierte Rampe zum Südostgrat und forderte mich auf nachzukommen. Er sicherte, wie wir es bei Vater gesehen hatten, indem er das Seil um einen Felszacken legte und weiter über die rechte Schulter führte. Eine effektivere Selbstsicherung beherrschten wir damals nicht. Ich hatte große Angst, fühlte mich unsicher. In ausgesetzter Kletterei gelangten wir auf den Südostgrat und nach mehreren Seillängen auf den Südgipfel der Kleinen Fermeda. Ich wagte kaum einen Blick in die Tiefe, weil unsere Route über die Abgründe oberhalb einer nicht einsehbaren überhängenden Wand in die Höhe führte. Von dort aus erreichten wir den Hauptgipfel und stiegen schließlich über die Normalroute ab, die wir von früheren Begehungen mit dem Vater gut kannten.
Diese spontane und eigenständige Klettertour über den Südostgrat der Kleinen Fermeda wurde für mich zum Schlüsselerlebnis. Reinhold war – obwohl der Jüngere – in dieser Situation eindeutig der Stärkere, sowohl mental als auch technisch. Er traute sich die Führung zu, behielt die Übersicht und setzte seinen eigenen Willen durch. Er stieg voraus, ich folgte ihm – zwar freiwillig, aber gehemmt. Diese seine Charakterzüge haben sich bis heute erhalten und auch in anderen Lebensbereichen durchgesetzt, wie seine Biografie belegt. Von diesem Tag an trennten sich unsere alpinistischen Ambitionen und Wege. Ich beschränkte mich auf einfachere Herausforderungen und bekannte Bergtouren, er suchte zunehmend schwierigere und unbekannte Wege in der Geisler-Gruppe, in den Dolomitenwänden benachbarter Täler, für welche er häufig den jüngeren Bruder Günther oder erfahrene Kletterpartner mitnahm. Von diesem Zeitpunkt an haben wir unterschiedlichste Lebenswege beschritten, sind aber beide mit dem Erreichten zufrieden.“
Die Erfahrung und Erlebnisse in den Sommerferien auf Gschnagenhardt haben zweifellos unsere persönliche Entwicklung geprägt. Weil die Eltern uns den Freiraum boten, unsere Fähigkeiten zu erproben und die räumlichen wie sozialen Grenzen auszuloten, zu erweitern. Jede nächste Lebensphase eröffnete neue Möglichkeiten und zeigte gleichzeitig Grenzen auf, die es zu akzeptieren galt. Bis heute.
Helmut hat studiert und ist Pädagoge geworden. Er war der Erste, der von zu Hause auszog und oft umgezogen ist: von Villnöß ins Schülerheim nach Meran, nach Innsbruck, Konstanz, in die Schweiz. Ich empfand sein Weggehen damals als Verlust, ja als Schmerz, weinte der gemeinsamen Kinderzeit lange nach. Helmut zog seine Kompetenz aus Studium, Lehre und viel Einsatz, ich meine Selbstmächtigkeit aus all den Widerständen, die man mir entgegenstellte – ein Leben lang.
3 Lebensweisheiten meiner Mutter
„Die wissen alle, dass sie etwas wert sind.“
Maria Messner-Troi über ihre neun Kinder
1993, zum achtzigsten Geburtstag meiner Mutter, erschien im ff-Wochenmagazin in Südtirol ein Essay von Florian Kronbichler, der im Folgenden, um einige Informationen ergänzt, wiedergegeben wird. Inzwischen bin ich selbst achtzig Jahre alt, und die Bewunderung für meine Mutter ist weiter gewachsen. Ohne ihre Weitsicht wäre ich an vielen Widerständen zerbrochen. Sie hat mich verstanden, immer wieder getröstet und ermutigt, meinen Weg zu gehen.
Das Magazin schickte eine Episode voraus, als Entschuldigung für das, was folgte:
„Als Reinhold Messner im Kulturhaus seines Heimatortes Villnöß einen Vortrag über seine Südtirol-Umrundung hielt, ließ er sich – wie das bei ihm zuweilen vorkommt – in eine Polemik mit dem Publikum verwickeln. Es half nicht, dass in der ersten Reihe die Mutter saß und ihm zudeutete: ›Halts Maul!‹ Einmal herausgefordert, hörte ›der Laggl‹ nicht mehr auf. Das Problem, sagt die Messner-Mutter stellvertretend für die ganze Familie, ist: ›Wir hören uns gern reden.‹
Wer solcherart imstand ist, sich nicht zu ernst zu nehmen, dem ist angenehm zuzuhören. Am Montag, 30. August, wird Maria Troi-Messner, Witwe und Mutter von acht Buben und einem Mädchen, achtzig Jahre alt. Gefeiert wird am Sonntag, dem 29. Mutter Messner ist noch so rüstig, dass sie das Fest selbst in die Hand nimmt. Beim ›Kabis‹, dem ersten Gasthaus am Platz, hat sie die Stube bestellt. Alle Kinder sind geladen (samt Anhang und sonst niemandem), und mit den Wirtsleuten hat sie das Nötige abgesprochen. Das Einzige, was ihr nicht nach Plan ging, ist, dass diesmal die Kinder das Mahl zahlen wollen. ›Dafür‹, sagt die Mutter, ›haben sie mir versprochen, keine Geschenke zu machen.‹
Es muss nicht alles stimmen. Sie erzählt es halt so, dass man ihr glaubt. Die ›Gerber-Miedl‹, Tochter des Gerbermeisters Franz Troi aus Buchenstein und einer Wiedenhofer vom Ritten, hat 1942 den Schullehrer Josef Messner geheiratet, einen der vielen Messner (›viel zu vielen‹), die es in Villnöß gibt. Mit knapp 30 Jahren. ›Leicht früh genug!‹, möchte sie allen gesagt haben, die das Heiraten noch vor sich haben. ›Heiratet ja nicht zu früh!‹, habe sie jedenfalls ihren Kindern immer eingebläut. Der eine hat es beherzigt, der andere weniger, einige haben es hinterher eingesehen.
Zu ihrem Mann hatte die Miedl ein Verhältnis, das man als landesüblich traditionell, als biblisch erbaulich, als klug bis listig oder gar als raffiniert frauenrechtlerisch bezeichnen könnte. Es kommt auf die Sichtweise an. ›Der Vater ist das Haupt der Familie‹, erläutert Frau Messner die ihrige, ›und die Mutter ist der Hals. Der muss das Haupt drehen.‹
Eine solche Definition bedarf keiner weiteren Erklärung. Er war der Gestrenge, sie die Gütige. Wenn (oder weil) er alles ernst nahm (von der Erziehung der Kinder bis zum Gasthausgeschwätz der Dörfler), konnte (musste) die Mutter alles abwiegeln. Wer letztlich das Sagen hatte und wer kuschte, wird eindeutig nie geklärt sein. ›Die Strenge des Vaters‹, versucht Sohn Reinhold eine Zuteilung der Elternrollen, ›mag verhindert haben, dass aus uns Sandler geworden sind, aber ausschlaggebend für das, was wir dann geworden sind, war die Persönlichkeit der Mutter.‹
Zwischen ihrem 30. und 44. Lebensjahr gebar Frau Messner neun Kinder. Acht Buben und ein Mädchen. ›Vier helle und vier dunkle, und die Waltraud ist mittelt.‹ Der Haarfarbe und dem Alter nach mittelt. Alle hat die Mutter gleich gerngehabt, natürlich. Werner, ihr Jüngster, der heute Mathematiker und Computerfachmann ist, aber früher sich ein bisschen mit Psychologie befasst hat, habe der Mutter einmal weismachen wollen, ›mehr als ein Kind kann man nicht wirklich gernhaben‹. Auf so viel Unerfahrenheit hat die Mutter dann geantwortet: ›Aber, Werner, hast du eine Ahnung!‹
Sie lässt sie gerne Revue passieren – ihre acht plus eine. Der Helmut, geboren 1943, ›war der bravste‹. Damals war er Direktor des Pädagogischen Instituts in Bozen. ›Für ein Lehrerkind ist so etwas wohl die Erfüllung.‹ Schwer zu sagen, ob die Mutter das im Ernst sagt oder mit Ironie. Jedenfalls ist Helmut, ihr Ältester, der einzige von den Kindern, dem sie einmal entfernt zugetraut hätte, dass er Geistlicher würde. Bei keinem der anderen wäre Ähnliches auch nur ›denkbar‹ gewesen. Dass dann auch Helmut weltlich blieb – Mama will nicht gerade sagen, dass sie froh darüber ist …
Das Jahr darauf, 1944, kam Reinhold zur Welt. ›Auch kein schlechter Bub, nur ein wilder.‹ Seine stehende Wendung war, schon als er sieben, acht Jahre alt war: ›Das tu ich nicht!‹ Wenn es hieß, den Hennenstall auszumisten (die Lehrerfamilie Messner betrieb nebenbei eine bescheidene Hühnerzucht), dann war vom Knirps Reinhold stets zu hören: ›Das tu ich nicht!‹ Trotzdem soll es vom gestrengen Vater dafür verhältnismäßig wenig Watschen gesetzt haben, denn Reinholds zweiter Wahlspruch habe gelautet: ›Dann bin i weg!‹
Auf den Wilden folgte wieder ein Musterkind: Günther. Er verschmähte die Nachhilfestunden in Italienisch, die ihm die fürsorgliche Mutter vermitteln wollte (›brauch i net‹), machte die Handelsoberschule und wurde – lineare Vollendung einer Ragioniere-Karriere – Bankangestellter. Glücklich war er dabei nicht. Wirklich glücklich hat ihn die Mutter erst gesehen, als er 1970 die Erlaubnis erhielt, mit Reinhold die Nanga-Parbat-Expedition mitzumachen. ›Da war er glücklich.‹ Und da starb er auch.
1947 – das vierte Kind war Erich. Wieder ›a win a Wilder‹. Er war der Fleißigste im Hennenstall, hat früh eingesehen, dass er Bauer nicht werden kann (mangels Hof), und studierte deswegen auf Tierarzt. Sein Verhältnis zu Tieren war immer ein enges. Beim Militärdienst in Innichen lernte er die Muli lieben (›die Muli wären die feinsten Viecher, wenn die störrischen Soldaten nicht wären‹) und später die Pferde. Erich ist heute selbst ein hohes Vieh in der Südtiroler Rossgesellschaft. Seinem Bruder Reinhold, der es auch einmal mit Pferden und Reiten probieren wollte, spricht er jede Eignung dazu ab. ›Er hat das Ross nicht gern!‹, sagt die Mutter, dass der Erich das vom Reinhold sagt.
Endlich, 1949, kommt das Mädchen. Waltraud. ›Die wird’s aber fein haben!‹, war der Kommentar der Nachbarschaft. Die Angekommene hat es anders in Erinnerung. Der Vater pries zwar immer den ›einen Rosenstock unter acht Misthäufen‹, aber wies sie im Übrigen in die bekannten engen Grenzen des Mädchens vom Land: nicht die Zöpfe schneiden, nicht Hosen und keinen Minirock tragen, abends nicht ausgehen, den Brüdern dienen und der Ma im Haushalt helfen. Wenn sich die junge Waltraud einmal aufgelehnt hat gegen die offensichtlich ungerechte Verteilung von Freiheiten und Pflichten, pflegte die Mutter zu sagen: ›Gescheiter als streiten, Waltraud, tu’s frisch, dann ist’s vorbei!‹ Gemeint war: Tun muss sie es ohnehin.
Solidarität unter Frauen war das nicht. Und Ermutigung zur Emanzipation auch nicht. Die Mutter hielt es eben für angebracht, der Tochter beizubringen, wie man die Verhältnisse am besten nimmt. Sie zu verändern hielt sie für unmöglich und Zeitverlust.
Als Waltraud sechzehn oder siebzehn Jahre alt war, auf jeden Fall schon die Kindergärtnerinnenschule in Bozen besuchte, setzte sie zum ersten Mal beim Vater durch, an einem Abend tanzen gehen zu dürfen. Reinhold wurde als ihr Begleiter bestellt. Die ›Lehrer-Waltraud‹ hatte sich zum Anlass sorgfältig hergerichtet, schön angezogen, aber als die beiden die lange Stiege des Lehrerhauses hinuntergingen, da sagte Kavalier Reinhold ihr plötzlich ins Gesicht: ›Ich mag nicht, kannst selber weitergehen!‹, und haute ab. Schwesterchen Waltraud blieb nichts anderes übrig, als ins Haus zurückzugehen und heulend der Mutter die Demütigung zu klagen. ›Lass ihn, den Laggl!‹ hieß es dann. Trost war das damals keiner.
Waltraud ging es, wie es einer Schwester unter vielen Brüdern meistens geht: Sie ›gilt‹ alles, also tut alles, und zuletzt trifft sie noch die testamentarische Pflicht, auf die alte Mutter zu schauen.
Der nächste Bub, Siegfried, hatte dem Rhythmus von der familiären Alternanz nach wieder ›ein feiner‹ zu sein. War es auch. Bereitete als Kind überhaupt keinen Verdruss. Einmal, erzählt die Mutter, habe sie geträumt, sie hätte vergessen, dem Kind die Flasche zu geben (so ein feines Kind war es). Da sei sie aufgesprungen und zum vermeintlich halb verhungerten Kind gelaufen, und was war da? ›Der kleine Siegfried lachte zufrieden aus der Wiege.‹ Siegfried wurde Landschaftsschützer und Chef der Südtiroler Bergführer.
Nächster Bub: Hubert. ›Net bös, aber wild.‹ Der heutige Kinderarzt muss in seiner Jugend für den Geschmack der Mutter die richtige Mischung zwischen wild und strebsam verkörpert haben. Das muss der Grund sein, dass ihr zu ihm ›nichts Besonderes‹ einfällt. Als der Regens vom Vinzentinum in Brixen den Buben aus dem Heim geschmissen hat und der Frau Mama prophezeite, sie werde für den wilden Buben nirgendwo einen Platz mehr finden, da habe diese geantwortet: ›Das, Herr Doktor, lassen Sie nur unsere Sorge sein. Der Bub kriegt schon wieder a Platzl.‹ Heute ist er Sanitätslandesrat in Südtirol.
Allmählich wird’s eintönig. Bub Nummer sieben, Hansjörg, war ›net a wilder, aber a bissl ein schwieriger‹. Schulabbrecher, Aussteiger, vom Vater aus dem Haus gejagt, von der Mutter heimlich finanziert, auf der Hippiewelle nach Indien verschlagen, ein Dreivierteljahr verschollen, von Reinholds damaliger Lebensgefährtin Uschi zufällig in Kathmandu aufgegabelt, heimgekehrt, wieder ausgerissen, sich arbeitend nach Amerika durchgeschlagen, Happy End: Schulen nachgeholt, Psychotherapeut geworden mit Praxis in London. Sein fachliches Urteil über die Mutter: ›So gut möchte ich auch alt werden.‹
1957 kommt der jüngste Messner zur Welt: Werner. Probiert’s anfänglich als Mechaniker, aber er mag nicht sein Leben lang ›unter einem Auto liegen‹, wird Bankangestellter, aber ›die ewige Geldzählerei‹ geht ihm auch auf die Nerven. Also studiert er Mathematik, gründet eine Computerfirma.
So, und jetzt die Geburtstagsfrage an Mutter Messner: Ob sie stolz ist auf ihre Kinder? ›Stolz? Ja, stolz darauf, dass sie, was sie machen, ordentlich machen.‹
Das erfordert schon einmal ein gerüttelt Maß Toleranz. Frau Messner wird geradezu feierlich, wenn sie beteuert, dass sie ihren Kindern nie dreingeredet hat, was sie zu tun hätten. ›Lasst die Kinder etwas lernen! Was sie im Kopf haben, bleibt.‹ Das sei einer der wenigen Erziehungsgrundsätze gewesen, in dem sie mit ihrem Mann einer Meinung gewesen sei.
Über das Wie und Was hätte ein Leben lang gestritten werden können, wenn Mutter Messner zum Streiten grad aufgelegt gewesen wäre. ›Du gibst immer nach!‹, war der regelmäßig wiederkehrende Vorwurf des Vaters an die Mutter. ›Ich hab mir immer gedacht, lass ihn!‹, sagt die Mutter im Nachhinein. Vater Messner ist schon sechs Jahre tot. 1985 an Lungenkrebs gestorben. Wer von den Kindern rauchte, hat das Rauchen gelassen, als sie die Röntgenbilder von Vaters Lunge sahen. Dem Vater selber hat die Mutter das Laster zeitlebens nicht abzugewöhnen vermocht. Wie phantasiereich sie ihm auch die Zigaretten rationierte. Der Schullehrer bestand fest auf der These, Filterzigaretten schaden nicht.
›Lass ihn!‹ und ›Lass sie!‹ ist auf sehr vielfältige Weise zum Lebensprinzip der Messner-Mutter geworden. Der Satz ist einmal Ausdruck von Toleranz, einmal von Wurschtigkeit und manchmal von weiser Resignation. Tochter Waltraud ist ihm oft zum Opfer gefallen. Reinhold, der Rebell, sieht in ihm das Geheimnis mütterlicher Macht und verklärt Mutters ›Lass sie!‹. Helmut, der Brave, sieht es heute pädagogisch und kritisch: ›Ein bisschen mehr Konfliktstärke hätte nicht geschadet.‹
Sei’s drum. Die Mutter dachte, wie die meisten Mütter, arbeitsteilig. Maulen und schlagen tut der Vater, sie macht ihm darin nicht Konkurrenz, sondern verlegt sich aufs Nachher. Die Lehrerkinder Reinhold und Erich waren noch nicht ausgeschult, da standen sie einmal mitten in der Predigt in der Kirche auf und staksten mit ihren genagelten Schuhen von vorne durch das ganze Kirchenschiff nach hinten und bei der Kirchentür hinaus. Aus Protest gegen die Predigt. ›Was der daherlügt, auf der Kanzel!‹, begründeten die Lehrerbuben ihre erste Demonstration. Der Vater war entsetzt und schämte sich, die Mutter ›war froh, als die Buben endlich bei der Kirchtür hinaus waren‹.
Dorthin sind die Messnerischen später nicht mehr viel zurückgekehrt. Die Mutter ist tiefreligiös. Sie sagt das mit der gleichen Selbstverständlichkeit, mit der sie sagt, dass sie Südtirolerin oder Großmutter ist. Sie will nicht leugnen, dass es sie gefreut hätte, wenn zum Geburtstag … Aber eines der Kinder habe ihr gleich gesagt: ›Mama, lass uns bitte mit den Kirchen in Ruh!‹
Daraufhin und überhaupt war es der Mutter auch ohne recht. Denn als sie nachzählt, wie viele der Kinder ihr zuliebe zu einer Geburtstagsmesse kommen würden, kommt keine Mehrheit zusammen. Zum Jahrtag vom Vater und von den Brüdern, freut sie sich, ›kommen sie schon – auch wenn es auch dabei mit den Jahren ein bisschen lockerer geworden ist‹.
Der Mutter macht das nichts aus. Sie hat eine Religiosität, der jedes Missionieren fremd ist. Sie könnte sich nicht entsinnen, jemals traurig gewesen zu sein darüber, dass die Kinder nicht in die Kirche gehen. ›Der Herrgott findet sie alle‹, befindet Maria Messner. Und hält er auch nichts von den Sakramenten, ›dass es einen Herrgott gibt, glaubt sogar der Reinhold‹.
Mehr zu glauben mutet die Mutter ihrem Sohn gar nicht zu. Sie betet täglich für ihre Kinder, sagt sie, ›das ist ja logisch‹, aber dass sie je für ihre ›Bekehrung‹ gebeten hätte, ›das wär mir nie eingefallen‹. Den Heiligen Vater, den Sohn Reinhold neulich zu sich auf Schloss Juval zitieren wollte (zwecks Erörterung über die Nähe der Berge zu Gott), mag Mutter Messner selber nicht recht. ›Schon vom Äußeren her‹, sagt sie. Papst Johannes XXIII. sei da ein ganz anderer Kerl gewesen. Wen sie heute auf der Stelle heiligsprechen würde, das ist Mutter Teresa. Den Tipp muss ihr Reinhold gegeben haben.
Der Reinhold, so wenig sie es wahrhaben will, beflügelt den Verteidigungseifer der Mutter ganz besonders. ›Du gehst so lang, bis du irgendwann oben anstößt‹, sage sie ihm immer wieder. Vergebens, natürlich. Dass sie auf ihn stolz ist, versucht sie nach Kräften zu verbergen. Reinhold ein Egoist? ›Nein, ja, schon a bissl.‹ Reinhold ein Exzentriker? ›Jaja, a bissl.‹ Ergebnis der Befragung: Reinhold ist ›a guter Bub‹.
Dem Reinhold geschehe viel Unrecht. Das, was an Reinhold Messner viele entweder als Neurose oder als geschäftsfördernde Taktik betrachten, nämlich dass er ständig angefeindet werde, ist für die Mutter die pure Wahrheit. ›Sie mögen ihn nicht.‹
Wer mag den Reinhold nicht? Die Mutter fängt gar nicht an zu zählen. Umgekehrt ist leichter. ›Also wirklich mögen tun ihn, außer den Kindern: die Muater, die Frau, a paar im Vinschgau …‹ Weiter kommt die Mutter nicht. In der eigenen Familie sind die Ausritte des berühmten Sohnes auch nicht immer auf ungeteilte Zustimmung gestoßen. Es gab im besten Fall Spott, häufig offene Lästerei, und da hat die Mutter immer für den Angegriffenen Partei ergriffen: ›Lasst ihn!‹
Der Vater hat unter dem extra-alpinistischen Engagement des berühmten Sohnes besonders gelitten. Wann immer dieser etwas Despektierliches über Herrschende und Zustände im Land verlauten ließ, traute sich der alte Dorflehrer nicht mehr ins Gasthaus. Als er seine Nichthochachtung vor den Optanten zum Ausdruck brachte, kam Vater Messner vollends in Konflikt mit sich selber. Er war Optant und HJ-Ortsgruppenleiter außerdem. Und da sprach der eigene Sohn von ›Heimatverrätern‹. In diesem Fall nahm die Mutter den Vater in Schutz: ›Stimmt schon‹, relativiert sie die Geschichte. ›Damals hieß es H-Jott, und heute heißt es halt K-Jott.‹ Den unbeschwerten Umgang mit Vergleichen muss der Sohn von der Mutter haben.
Was zwischen Vater und Kindern an Aggressionen sich aufstaute, wurde von der Mutter systematisch abgetragen. Als Reinhold 1970 von der tragischen Nanga-Parbat-Expedition zurückkehrte, bei welcher der um zwei Jahre jüngere Bruder Günther verloren ging, und er in der Universitätsklinik Innsbruck sich seine erfrorenen Glieder heilen ließ, machte ihm der Vater beim ersten Krankenbesuch gleich Vorhaltungen.
Reinhold hätte auf den Bruder besser achtgeben müssen. In solchen extremen Situationen machte die Mutter eine Ausnahme von ihrem ›Lass sie!‹ und ›Lass ihn!‹. Er solle gefälligst aufhören mit der Moral, hat sie den Vater energisch aus dem Krankenzimmer gezogen. Der Günther sei freiwillig mitgegangen. Wäre er nicht mitgegangen, ›wäre er vielleicht seinen Lebtag lang unglücklich gewesen‹. Ähnlich energisch sei die Mutter dem Vater nur noch einmal in den Weg getreten, und das war, als dieser einen der jüngeren Buben aus dem Haus warf. ›Außiwerfen darf man ein Kind nicht‹, hat sie damals gesagt. ›Oder haben die Kinder vielleicht gefragt, ob sie auf die Welt kommen wollen?‹
Die Messner-Mutter hat eine sehr abgeklärte Sicht vom Bergtod ihrer beiden Söhne Günther und Siegfried. Erstens ist ihr ein Tod am Berg oder auf der Straße lieber ›als, sagen wir, ein Selbstmord. Denn da machst du dir Vorwürfe, dass du etwas falsch gemacht hast.‹ Und zweitens sagt sie: ›Wenigstens die zwei weiß ich, wo ich sie hab. Die sind aufgehoben.‹
Bei den anderen Kindern hat die Mutter lang nicht immer gewusst, wo sie sie hat. Von Hansjörg hatte sie, bevor er in Kathmandu aufgefunden wurde, einmal ein Dreivierteljahr kein Lebenszeichen, und da hatte sie sich das einzige Mal gedacht, ›es kann sein, dass er zugrunde gegangen ist‹. Sonst verließ sie das Vertrauen nie. ›Wenn sie ein bisschen Troisches haben‹, scherzt Maria Troi-Messner (womit sie den Arbeitseifer meint), ›und ein bisschen Messnerisches‹ (was dann wohl das Hirnschmalz sein müsste), ›kommt keiner so leicht um.‹
Wo immer sie die Kraft dazu hernimmt, sie sagt, aus der Religion, das Vertrauen der Messner-Mutter in ihre Buben ist grenzenlos. Und selbstverständlich. Als sie erfuhr, dass ihr Sohn Hubert mit Reinhold zur Grönland-Expedition aufbrechen würde, wollte sie das eine Weile lang nicht glauben. ›Der geht nicht. Hat ja keine Zeit‹, redete sie sich ein. Als es dann trotzdem ernst wurde, war ihr plötzlich auch das recht: ›Soll er nur. Arbeitet sonst viel zu viel.‹
Das Leben nehmen, wie es kommt, heißt man so was. ›Vertrauen, dass es sich schon richtet‹, sagt Werner. ›Die Kinder kommen, wenn man sie gehen lässt‹, erinnert sich Waltraud an einen Lieblingsspruch der Mutter. ›Ein bisschen ausweichen, ein bisschen dazu stehen, ein bisschen Glück haben‹, sagt Helmut. Und Reinhold sagt nur: ›die starke Frau‹.
Über die Frauen hätte die Messner-Mama schon auch etwas zu sagen. ›Ich habe alle gewarnt vor meinen Buben.‹ Und wenn es eine nicht aushält, mit einem Messner, dann ist die Schwiegermutter nicht nachtragend: ›Wenn es nicht geht, dann ist besser, sie gehen auseinander.‹ Es gab schon Fälle, in denen es so weit kam. Die Mutter verargte es keiner Schwiegertochter.
Reinhold Messner riet der ff, sie sollte die Mutter zum Geburtstag einmal fragen, warum aus ihren Kindern ›keine Sandler geworden‹ seien. Die Mutter versteht die Frage gar nicht. ›Sandler? Daran habe ich nie gedacht.‹ Und sofort kapiert sie, dass einer, der so fragt, nur gelobt werden will. ›Meine Laggl wissen alle, dass sie etwas wert sind.‹“
Das Selbstverständnis und Selbstvertrauen, die mir meine Mutter mitgegeben hat, ließen mich auch im schlimmsten Gegenwind nicht verzagen. Als ich 1970 halb tot durchs obere Diamir-Tal torkelte, die Orientierung verloren – betete ich nicht zu Gott, ich dachte an meine Mutter. Das Erinnern an sie hielt mich am Leben. Musste ich doch heimkommen, um ihr von unserer Odyssee zu erzählen.
Ja, das Vertrauen, das uns unsere Eltern in Kinderjahren schenken, hält ein Leben lang an und wächst, wenn wir unseren Weg früh in Eigenverantwortung gehen dürfen. Nur in einem sicheren Nest werden Vögel flügge. Sie steigen dann im Aufwind, lieben den Gegenwind, schweben zuletzt ohne Mühe durch alle Winde. Wie wir Menschen, wenn wir mit Hingabe tun, was wir tun müssen.
„Die Freiheit aufzubrechen, wohin ich will“: Den Buchtitel meiner ersten Autobiografie verdanke ich meiner Mutter. Sie hat mir das Selbstvertrauen geschenkt, das mich achtzig Jahre lang überleben ließ.
„Vermutlich sein persönlichstes Buch“
„Ehrlich schildert Reinhold Messner sein wildes Leben in dem neuen Buch ›Gegenwind‹“
„Ein ganz besonders persönliches und autobiographisches (Buch).“
„Leichtfüßig gibt er Anekdoten aus seinem prall gefüllten Leben zum Besten, berichtet von den schönen Dingen, ohne die weniger schönen auszulassen.“
„Lesenswert“
„Sein Fundus an interessanten Geschichten ist riesig, und spannend erzählen kann er auch.“
„Gegenwind verspürt nur, wer vorangeht, und dieses Buch zeigt, auf wie vielfältige Weise Messner das ein Leben lang getan hat.“

















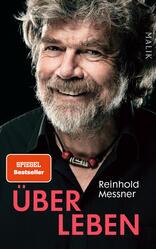






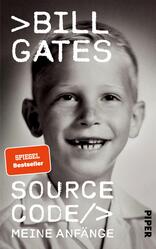


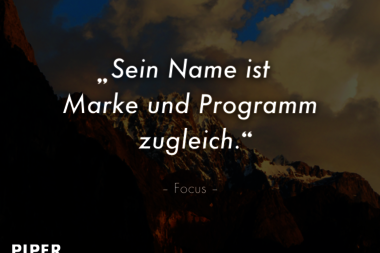

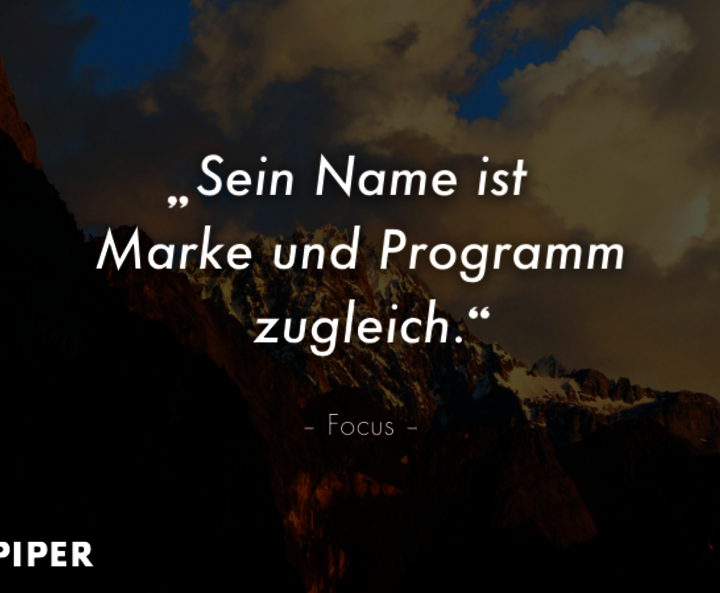



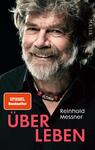
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.