
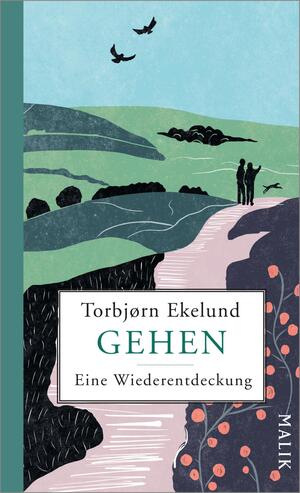
Gehen Gehen - eBook-Ausgabe
Eine Wiederentdeckung
— Vom Laufen, Wandern und Flanieren – eine Liebeserklärung an die achtsamste Art der Fortbewegung„Eine bezaubernde Lektüre, die sich dem Verhältnis der Menschen zum eigenen Körper, zu ihrer Umgebung und untereinander widmet.“ - The Washington Post
Gehen — Inhalt
Wenn der Weg wieder zum Ziel wird
„Eine zutiefst faszinierende Meditation über jene Pfade, die wir in unserer Umwelt und im Leben beschreiten.“ Erling Kagge, Autor des SPIEGEL-Bestsellers „Stille“ über diesen Band
Nach einem Einschnitt in seinem Leben ist Torbjørn Ekelund fast nur noch zu Fuß unterwegs. Was ihn anfangs frustriert, wird für ihn bald zur Befreiung. Denn mit der Entschleunigung offenbart sich ihm die Welt auf eine ganz neue Art und Weise.
Ekelund wandert mal schnell und mal langsam, in dicken Stiefeln, luftigen Joggingschuhen oder barfuß. Er läuft durch Waldbäche und auf malerischen Küstenpfaden, über warme Felsen und durch Blaubeergestrüpp. Und mal spaziert er mit geschlossenen Augen durch die Stadt. Mit jedem Schritt wächst nicht nur seine Lust, einfach weiterzugehen, sondern auch das Interesse daran, wie Tiere und Menschen sich seit jeher durch die Landschaft bewegen.
In seinem Buch erklärt er, wie unsere Wege überhaupt entstehen und was sie mit Migration und Bewegung, Orientierung und Ortssinn zu tun haben. Er erzählt, weshalb wir beim Gehen besser nachdenken können als im Sitzen. Und wie uns diese urtümliche Art der Fortbewegung wieder zu mehr Achtsamkeit führt.
Voller Hingabe besinnt er sich dabei auf unsere Wurzeln und lädt dazu ein, unseren Wegen wieder mehr Beachtung zu schenken.
- Eine tiefsinnige Lektüre und ein besonderes Geschenk für Buchliebhaber
- In Halbleinen und mit Lesebändchen
Leseprobe zu „Gehen“
Am Mistaken Point, weit draußen an der äußersten Spitze einer Halbinsel im Südosten Neufundlands, gibt es eine Spur. Sie ist einen Zentimeter breit, 18 Zentimeter lang und 565 Millionen Jahre alt. Sie führt über einen grauen Stein mit einem Riss in der Mitte und verläuft nicht in einer geraden Linie, sondern weist unterwegs kleine Abweichungen sowie unregelmäßige Kanten auf. Die Spur hat einen deutlich erkennbaren Anfang, als hätte das Geschöpf, das sie hinterlassen hat, eine Weile still dagelegen, ehe es sich zu rühren begann. Am anderen Ende wird die [...]
Am Mistaken Point, weit draußen an der äußersten Spitze einer Halbinsel im Südosten Neufundlands, gibt es eine Spur. Sie ist einen Zentimeter breit, 18 Zentimeter lang und 565 Millionen Jahre alt. Sie führt über einen grauen Stein mit einem Riss in der Mitte und verläuft nicht in einer geraden Linie, sondern weist unterwegs kleine Abweichungen sowie unregelmäßige Kanten auf. Die Spur hat einen deutlich erkennbaren Anfang, als hätte das Geschöpf, das sie hinterlassen hat, eine Weile still dagelegen, ehe es sich zu rühren begann. Am anderen Ende wird die Spur erst feiner, dann undeutlich und löst sich schließlich auf. Anscheinend stammt sie von etwas, das sich sehr langsam bewegt hat, einer Schnecke oder etwas Ähnlichem.
Es war eine kleine Sensation, als die Spur gegen Ende der 1960er-Jahre entdeckt wurde, denn sie stammt von einem Lebewesen, das sich aus eigenem Willen von einem Ort zum anderen bewegt hat. So einfach ist das – und so kompliziert. Die Spur am Mistaken Point ist die erste Dokumentation einer von einem Willen gesteuerten Bewegung in der Geschichte der Erde. Und eine von einem Willen gesteuerte Bewegung ist die Voraussetzung für jeden Weg.
Anfang
Einst waren wir Nomaden. Wir wanderten umher, hielten uns nie lange an einem Ort auf. Die Welt lag offen und unberührt vor uns, es gab keine Grenzen. Wir konnten in jede beliebige Richtung gehen, dem Wild folgen, neues Land erforschen.
Heute sind wir sesshaft. Wir verbringen unser Leben im Sitzen. Fahren mit dem Auto zum Einkaufen und benutzen für lange Reisen ein Flugzeug. Wir bekommen die Pizza an die Haustür geliefert und kaufen automatische Rasenmäher, kleine Roboter, welche die Arbeit für uns erledigen, während wir im Liegestuhl sitzen und an wichtigere Dinge als das Rasenmähen denken.
Unterwegs zu sein hat seinen ursprünglichen Zweck verloren. Es ist für die Lebenserhaltung nicht länger erforderlich, sondern zu einem Mittel der Unterhaltung und Entspannung geworden. Wir bewegen uns mit einem Flugzeug von einem Erdteil zum anderen. Auf diese Weise überwinden wir enorme Entfernungen, doch gleichsam ohne Mühe, und wir wissen nichts über die Wege und Landschaften, die viele Tausend Meter tiefer unter der Wolkendecke liegen. Etwas Grundlegendes hat sich verändert. Man könnte auch sagen, dass etwas verloren gegangen ist, wenn wir heute von einem Kontinent zum anderen fliegen und dabei den Check-in am Flughafen als die anstrengendste Etappe der Reise empfinden.
Einst war die Fähigkeit, eine Landschaft lesen zu können, für das Überleben notwendig. Heute brauchen wir keine Kenntnisse über Navigation oder Orientierung, um dahin zu gelangen, wohin wir wollen. Der Weg wird vom GPS unseres Mobiltelefons abgesteckt, und während wir gehen, starren wir auf einen leuchtenden Bildschirm und blicken weder auf den Weg, auf dem wir uns befinden, noch auf das Ziel, zu dem wir unterwegs sind. Das Ortsgedächtnis ist etwas, das wir nicht mehr benötigen. Das Gleiche gilt für die Fähigkeit, Entfernungen abzuschätzen.
Der Weg war die erste Verkehrsader, und die Art und Weise, wie er sich durch die Landschaft zieht, erzählt etwas Grundlegendes über die Menschen, die für seine Entstehung sorgten. Die Trasse eines Wegs ist niemals zufällig. Sie bildet nicht die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ab, sondern die einfachste. Somit ist sie ein Ergebnis der dem Menschen innewohnenden Neigung, stets den Weg des geringsten Widerstands zu wählen, weil der sparsame Umgang mit Energiereserven für das Überleben wichtig war.
Boten liefen zu Fuß über Pfade und Karrenwege. Die dafür erforderliche Zeit war den Kräften untergeordnet, die sie für die Überwindung der Strecke aufbringen mussten. Wenn sie ihr Ziel schließlich erreichten, konnte die zu überbringende Nachricht schon längst veraltet sein, vielleicht sogar völlig unzutreffend. „Hier geht es allen gut“, konnte zum Beispiel in einem Brief stehen, den europäische Auswanderer in Amerika von ihren Verwandten in der alten Heimat erhielten. Doch im Laufe der Monate, die seit dem Aufgeben des Briefes vergangen waren, konnten viele der Verwandten, ja sogar der Briefschreiber selbst, an Tuberkulose, Scharlach, vor Hunger oder aus anderen Gründen gestorben sein. Und auch der Krieg konnte schon längst vorüber sein, wenn der Bote mit der Nachricht über den Ausbruch desselben an sein Ziel gelangte. Alles brauchte seine Zeit. Dies war die Prämisse für jede Reise.
Die Geschichte der Wege ist auch eine Geschichte über eine Welt, die im Verschwinden begriffen ist. Wege wurden zu Straßen, die Wanderung zu Fuß wurde zu einer Fahrt mit Wagen oder Pferdekarren, der Waldboden wurde zu Asphalt und Beton. Die Wagen und Pferdekarren wurden durch Autos und Schwertransporter ersetzt. Straßen mussten ausgebessert, Sümpfe trockengelegt, Berge gesprengt werden. Und Heidelandschaften wurden mit Schotter und Kies zugeschüttet und planiert.
Die Dauer einer Reise wurde einst durch den Weg bestimmt. Heute können Landschaften umgeformt und angepasst werden. Felsen können gesprengt, Feuchtgebiete entwässert und Flüsse in Rohre verlegt werden. Wir haben den Raum als eine der wichtigsten Prämissen für das Reisen eliminiert. Zeit hingegen bedeutet uns alles.
In der kleinen Erzählung Veien (Der Weg) hält der norwegische Schriftsteller und Philosoph Peter Wessel Zapffe treffend fest:
So kam der Weg zur Welt, durch die Begegnung des Fußes
mit weichem Grund, und Menschen und Wege wuchsen zusammen und teilten gute und schlechte Tage. (…) Eines Tages geschah etwas Neues. Eine lärmende, stinkende Trollmeute brach stampfend durch das Tal. (…) Ingenieure kamen. Fremde Männer mit Eisenskelett und Winkelhirn und Quarzaugen, die nur Träger und Balken sahen. Sie schrien
und lärmten, und unter Donner und Rauch zogen sie eine scheunenbreite, blutende Steinwunde durch das Tal hinter sich her. (…) Die neue Straße breitete sich aus wie ein Wilder, blind und taub für alles andere als das Ziel.
Die Wege waren stets mit der Landschaft verschmolzen gewesen, sie hatten nichts zerstört. Doch genau das taten nun die Straßen. Sie veränderten alles. Sie verformten nicht nur die ursprüngliche Landschaft, sondern wurden für Braunbär, Rentier, Lachs, Wolf, die sich wie fast alle Lebewesen im Raum bewegen, zum Hindernis. Wanderungen gemäß der Jahreszeit, Wanderungen, um Nahrung zu finden, der ewige Umzug von einem Ort zum anderen und wieder zurück.
Die Migrationsrouten der Tiere wurden von großen Straßenanlagen unterbrochen, die sie nicht zu überwinden vermochten. Die Routen der Zugvögel wurden von fliegenden Metallmonstern gekreuzt, die plötzlich den Luftraum beherrschten. Die jährlichen Wanderungen der Fische durch die Flüsse wurden durch Brückenanlagen und Staudämme blockiert. Ganze Arten verloren ihren Lebensraum und starben aus.
„Im Kopfe des von seinen Zwecken erfüllten Menschen sieht die Welt aus, wie eine schöne Gegend auf einem Schlachtfeldplan aussieht“, schrieb der deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer. Das Gleiche ließe sich über Nationen, Kulturen, den gesamten Zeitgeist sagen, der die westliche Welt seit Beginn der Industrialisierung im 18. Jahrhundert geprägt hat.
In meiner Kindheit zogen sich Wege wie ein roter Faden durch mein Leben. Gehen war ein natürlicher Bestandteil des Daseins, es existierten keine anderen Möglichkeiten. Überall gab es Wege. Sich zu bewegen war der Normalzustand.
Ich wurde erwachsen und fing an, in einem Büro zu arbeiten. Die Wege verschwanden aus meinem Leben und mit ihnen auch die Bewegung. Schilder sagten mir, wo ich entlanggehen sollte. Der Asphalt machte alle meine Schritte gleich. Straßenbeleuchtung vertrieb die Dunkelheit. Zäune und Bordsteinkanten führten mich in die richtige Richtung.
Ich entdeckte nichts mehr. Ich musste mich nicht mehr umschauen, um herauszufinden, wo ich mich befand und wo es weiterging. Ich brauchte nicht länger auf meine Urteilskraft zu vertrauen und keine Richtungsentscheidungen mehr zu treffen. Ein Leben in Bewegung war verwandelt in ein Leben im Stillstand. Überallhin fuhr ich mit dem Wagen, und wenn ich zu einem Ort wollte, aber kein Auto zur Verfügung hatte, blieb ich lieber zu Hause.
Eines Tages passierte etwas, das mein Leben sowohl zum Besseren als auch zum Schlechteren veränderte. Ich interviewte einen Schriftsteller. Wir saßen einander schräg gegenüber an einem großen weißen Tisch in einem Büro in der Osloer Innenstadt. Der Schriftsteller erzählte von den Büchern, die er geschrieben hatte. Ich versuchte, seinen Worten zu folgen, aber plötzlich schien mein Kopf nicht mehr zu funktionieren, als hätte es da drinnen einen Kurzschluss gegeben. Ich starrte den Mann an. Ich sah, wie sich sein Mund bewegte, verstand aber nicht, was er sagte. Das Letzte, woran ich mich erinnere, war, dass ich dachte: Was passiert da gerade mit mir?
Als ich wieder wach wurde, lag ich in einem Notarztwagen. Ein Mann redete auf mich ein. Sein Gesicht schwebte groß und undeutlich irgendwo über mir. Können Sie mich hören, fragte der Mann. Können Sie mich hören? Ich versuchte, ihm zu antworten, schaffte es aber nicht. Es war, wie am Grund des Meeres zu liegen. Ich wollte zu dem Mann mit der roten Jacke hinaufschwimmen, aber der Weg war so weit, und mir fehlte die Kraft. Ich öffnete den Mund, um etwas zu sagen. Dann wurde alles wieder schwarz.
Ein paar Stunden später erwachte ich in einem Krankenhaus. Ich lag in einem Bett, das hierhin und dorthin gerollt wurde. Krankenpfleger und Ärzte kamen und gingen. Sie sagten mir Dinge, die ich nicht verstand; als ob sie eine Sprache verwendeten, derer ich nicht mächtig war. Mein Kopf wurde untersucht. MRT. CT. Röntgenaufnahmen des ganzen Körpers. Sie fanden nichts. Alles war völlig normal, und dennoch war etwas Dramatisches passiert.
Ich wurde in einem Zimmer untergebracht und kam langsam wieder zu mir. Die Sprache kehrte zurück, das Gedächtnis kam wieder. Drei Tage lag ich in diesem Zimmer, ehe eine Ärztin mir erklärte, dass ich an Epilepsie erkrankt sei. Manches wird sich ab jetzt in Ihrem Leben ändern, sagte die Ärztin, und eines davon ist, dass Sie nicht länger Auto fahren können.
An meinem letzten Tag im Krankenhaus lag ich da und dachte darüber nach. Nach fast dreißig Jahren hatte ich also meinen Führerschein verloren. Der erste Gedanke war, dass das große praktische Konsequenzen nach sich ziehen würde. Wie ich gehört hatte, erlebten manche Leute, die ihren Führerschein infolge einer Erkrankung verloren hatten, die Krankheit selbst als weniger belastend als die Tatsache, nicht mehr Auto fahren zu können. Wie würde ich reagieren? Wie stark würde sich mein Leben verändern? Würde ich den alten Volvo vermissen?
Als ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde, verabschiedete ich mich endgültig von meinem Wagen. Was dann geschah, erstaunt mich bis heute. Ich bekam eine neue Identität, und nur wenige Tage später hatte ich mich daran gewöhnt. Ich war nicht länger ein Autofahrer, ich war jetzt ein Fußgänger. Und anders als befürchtet, war es überhaupt nicht frustrierend für mich, sondern befreiend. Ich änderte meine Gewohnheiten und vermisste nichts. Die Geschwindigkeit ging herunter, der Puls ging herunter, und die Welt offenbarte sich mir auf eine Art, wie sie es nicht mehr getan hatte, seit ich ein Kind gewesen war.
Ich ging überallhin zu Fuß, und so kamen die Wege zurück in mein Leben. War der Weg breit und trocken, ging es schnell. War er steil und feucht, ging es langsam. Die erforderliche Zeit wurde bedeutungslos. Der Raum wurde wieder zum wichtigsten Faktor der Reise.
Es war eine Offenbarung und eine Erleichterung. Plötzlich entdeckte ich überall Wege, Verkehrsadern, von deren Existenz ich nichts gewusst hatte. Schmale Wege über grüne Wiesen, Wildpfade durch den Wald, Abkürzungen durch Hecken und Gärten, über Felder und Parkplätze hinweg, und sogar in meinem Haus entdeckte ich meine eigenen verinnerlichten Bewegungsmuster.
Ich probierte neue Gangarten aus. Ich ging schnell und ich ging langsam. Ich ging mit leichtem und mit schwerem Rucksack. Mit dicken Stiefeln und mit luftigen Joggingschuhen.
In den Sommerferien lief ich barfuß, den ganzen Juli hindurch hatte ich kaum je ein Paar Schuhe an den Füßen. Als der Herbst kam, ging ich mit geschlossenen Augen zur Arbeit. Ein komischer Einfall – die Menschen, denen ich unterwegs begegnete, müssen mich für verrückt gehalten haben, aber das war ich nicht. Ich wollte lediglich untersuchen, wie es sich anfühlte.
Als ich nichts mehr sehen konnte, wurde meine ganze Aufmerksamkeit auf die Bewegungen meines Körpers gelenkt. Ich spürte, wie die Füße arbeiteten. Die Gewichtsverlagerung von einem Bein auf das andere. Wie der eine Fuß mit der Ferse aufsetzte, über den Ballen nach vorn abrollte, und wie die Zehen sich im selben Moment vom Boden lösten, als der andere Fuß mit der Ferse auf der Erde auftraf. Perfekte Koordination. Die Arme bildeten den Ausgleich, sie bewegten sich den Beinen entgegengesetzt – linker Arm nach vorn, rechtes Bein nach hinten – in einem komplexen Zusammenspiel, welches den Körper im Gleichgewicht hielt und ihm die Vorwärtsbewegung erlaubte. Ich spürte, wie die Muskeln in Oberschenkeln und Waden den Körper nach vorn drückten und wie kleine Muskeln, von deren Existenz ich keine Kenntnis hatte, wann immer nötig, für eine Rückgewinnung des Gleichgewichts sorgten.
Der menschliche Fuß besteht aus 26 Knochen, die in ungeheurer Komplexität zusammenarbeiten. Ich hatte sie vorher nie wahrgenommen, nun aber kam es mir vor, als ob ich die Bewegung eines jeden einzelnen genau kennen würde. Meine Wirbelsäule war gestreckt, der Kopf erhoben und der Blick nach vorn gerichtet, obwohl ich die Augen geschlossen hielt.
Wie ein Schlafwandler bewegte ich mich zur Arbeit. Ich hörte Geräusche, die mir zuvor nie aufgefallen waren. Flugzeuge auf dem Weg von oder nach Oslo-Gardermoen. Autos, die angelassen wurden oder bremsten. Ich hörte das Ticken der Ampel, wenn die Fußgänger grünes Licht erhielten. Ich hörte Nuancen im Gesang der Vögel, die ferne Sirene eines Feuerwehrautos. Ich hörte den Bus, der anhielt und seufzte, wenn sich die Türen öffneten. Ich hörte das trockene Herbstlaub im Morgenwind rascheln. Kinder auf dem Weg zur Schule, laute Gespräche, schlurfende Schritte. Jemand fegte die Treppe vor seinem Haus. Ein Postbote, der Zeitungen in die Briefschlitze steckte. Er hob die Abdeckungen an und ließ sie wieder zuknallen, als trüge er eine große Wut in sich, die unbedingt herausmusste. Ich hörte das Rauschen der Stadt, das Summen Tausender verschiedener Tätigkeiten, von denen keine etwas mit mir und meinem Experiment zu tun hatte.
Ich ging und ging, und mit jedem Meter, den ich zurücklegte, bekam ich mehr und mehr Lust, einfach weiterzugehen. Ich las über berühmte Wanderwege. Den John Muir Trail in den USA. Laugavegur auf Island. Kungsleden in Schweden. The Great Divide Trail in Kanada. The South West Coast Path in England. Den Goldsteig in Deutschland. Te Araroa in Neuseeland.
Abends breitete ich Karten auf dem Tisch aus und studierte sie unter dem gelben Licht der Küchenlampe. Die Wege darauf bogen sich wie Flüsse, erstreckten sich über Berge, führten an Gewässern entlang, an Sümpfen vorbei und über Höhenzüge und weite Ebenen hinweg.
Vielleicht würde ich niemals diese Wege gehen. Sie waren so lang. Geradezu epische Distanzen, für robustere Menschen als mich geschaffen. Es würde Monate dauern, die Entfernung vom Start bis zum Ziel zurückzulegen. Außerdem setzte es voraus, dass man ein gefülltes Konto hatte sowie die Möglichkeit, sich für längere Zeit von seiner Arbeit beurlauben zu lassen. Oder dass man noch sehr jung war und nur für sich selbst Verantwortung trug.
Doch es gab andere Möglichkeiten, den Plan umzusetzen, denn Wege ähneln einander. Ihnen wohnt dieselbe Logik inne, unabhängig davon, ob sie kurz oder lang sind, großartig oder unansehnlich, ob sie in China liegen oder in Indien, ob in der russischen Taiga oder in einem Wald außerhalb von Oslo. Ich könnte kleine Wege nehmen, alte, überwucherte und neu angelegte, solche, die ich schon kannte, und solche, die ich noch nie gegangen war. Ich könnte Bücher über Wege lesen und in die vielfältige Literatur darüber abtauchen. Ich würde mehr darüber lernen, wie Wege entstehen und wieso. Genaueres erfahren über den nomadischen Menschen, über Migration und Bewegung, Orientierung, Ortssinn und darüber, warum wir heute nicht mehr gehen.
Ich ging und schrieb, ging und schrieb, und je mehr ich ging, desto mehr schrieb ich und desto deutlicher wurde mir, dass die Geschichte der Wege nicht erzählt werden konnte, ohne auch die Geschichte vom gehenden Menschen und von der ihn umgebenden Landschaft zu erzählen. Der Weg und die Landschaft sind untrennbar miteinander verknüpft. Genauso ist es mit uns Menschen. Wir begreifen uns selbst in Beziehung zu der Landschaft, in die wir hineingeboren werden. Mehr als alles andere definiert sie den Rahmen unseres Lebens. Wenn wir durch eine Landschaft gehen, tun wir etwas, das sich grundsätzlich sinnvoll anfühlt. Wir bewegen uns gemäß der Art und Weise, die uns zur Fortbewegung zur Verfügung steht. Die Geschwindigkeit beim Gehen erlaubt, dass wir uns umschauen, dass wir die Welt in uns aufnehmen, dass wir wahrnehmen, wie sie sich langsam verändert, dass wir Geräusche hören, Gerüche bemerken, Wind, Sonne und Regen im Gesicht spüren und unter unseren Füßen den Boden, der sich beim Gehen ständig verändert.
Wege sind Erzählungen über Menschen, die zu Fuß gegangen sind. Sie haben einen Anfang, eine Mitte und einen Schluss. Sie deuten nach vorn auf das Ziel der Reise, aber auch zurück auf all diejenigen, die vor uns dort entlanggegangen sind oder die erste Spur hinterlassen haben. Die Geschichte der Wege ist unsere Geschichte. Myriaden von Erzählungen über Arbeit und Lebensunterhalt, über Forscherdrang und Migration; ein um die Welt herumgewundenes Gespinst in der Form eines Wollknäuels.
Dies ist die Geschichte einiger dieser Wege.
Das Maß aller Wege
Als ich ein Kind war, hatte meine Familie eine kleine, braun gebeizte Hütte. Sie lag an einem See einige Kilometer nördlich der Küstenstadt Larvik. Der Ort hieß Lysebo, die Hütte nannten wir Solli. Sie lag für sich allein am Waldrand, auf einer Anhöhe mit Blick auf den großen See. Wir waren zu fünft, Mutter, Vater, meine Schwestern und ich, und verbrachten jeden freien Tag in der Hütte, alle Wochenenden und die gesamten Ferien, Jahr für Jahr. Die Hütte war der Nabel in unserem Leben, sie verknüpfte uns miteinander und machte uns zu einer Familie.
Hinter der Hütte gab es einen Weg. Er war nicht lang, führte nicht durch eine großartige Landschaft und bot unterwegs auch keine fantastischen Ausblicke oder Sehenswürdigkeiten. Der Weg war nicht einmal auf der Karte verzeichnet, aber es war der erste Weg, den ich ging, und ich erinnere mich so gut an ihn, weil er für lange Zeit der einzige Weg war, den ich kannte.
Der Weg führte über ein Feld und in den Wald hinein. An einem Felsen vorbei, über eine Brücke, an einem Bach entlang. Ich wusste nicht, wer diesen Weg als Erster ausgetreten hatte oder weshalb. Er lag einfach nur da, wie ein natürlicher Bestandteil der ersten Landschaft meiner Kindheit. Jedes Mal, wenn wir in der Hütte waren, gingen wir diesen Weg. Meine Schwestern und ich voran, gefolgt von meiner Mutter und meinem Vater. Wir liefen den Weg bis ans Ende und legten dort eine Rast ein. Dann machten wir kehrt und begaben uns auf den Rückweg.
Wenn wir wieder zurück zur Hütte kamen, waren wir von allen Pflichten des Tages entbunden. Jetzt könnt ihr es euch drinnen gemütlich machen, sagte meine Mutter und lächelte. Für eine kurze Weile waren wir Nomaden gewesen, nun konnten wir uns gestatten, wieder sesshaft zu sein. Es war ein Prinzip, das zu befolgen uns in der Kindheit beigebracht wurde: Wer still sitzen will, muss sich erst bewegen.
Meine Mutter hatte schon als Kind diesen Weg genommen. Wenn wir unterwegs waren, erklärte sie oder zeigte auf etwas. Da drüben sind wir mit Pferd und Wagen entlanggefahren. An dem Felsen dort durfte das Pferd ausruhen. Hier gibt es im Sommer Erdbeeren, dort im Herbst Pilze. Hier wachsen Sumpfdotterblumen, dort haben wir den Weihnachtsbaum geschlagen, da drüben zieht der Elch seine Bahn, dort das Rotwild, und hier hat Großmutter immer die Leberblümchen bewundert.
Je öfter wir den Weg gingen, desto vertrauter wurde er uns, und nach ein paar Jahren kannten wir ihn in- und auswendig. Wir kannten die Höhenunterschiede und die Krümmungen des Wegs im Gelände. Wir wussten, wo es sich leicht ging und an welcher Stelle die Kräfte in unseren kleinen Körpern immer nachließen.
Den verschiedenen Stellen, die wir passierten, gaben wir Namen. Sie unterstrichen die Besonderheiten der Landschaftsformationen. Wasserfall. Berg. Feld. Bach. Als hätte es auf der ganzen Welt nur einen Wasserfall, einen Berg, ein Feld und einen Bach gegeben. Damals wusste ich nicht, dass es überall Wege gab, dass nahezu alle Lebewesen Wege anlegten, große und kleine, und dass die Wege schon seit der Entstehung der Welt existierten.
Mittlerweile sind wir längst erwachsen, meine Schwestern und ich. Wir haben eigene Familien gegründet, sind in andere Städte gezogen und haben uns neue Ferienorte ausgesucht. Fast vierzig Jahre ist es her, dass ich zuletzt auf dem kleinen Weg war, doch in Gedanken bin ich ihn oft gegangen, wieder und wieder. Wenn ich großen Stress hatte und viel erledigen musste oder wenn es schwierig war, eine Entscheidung zu treffen, nutzte ich ihn als eine Art Therapieform, um einschlafen zu können. Ich schloss die Augen und ging den Weg, so wie ein Abfahrtsläufer die Piste in Gedanken hinuntersaust, bevor er sich abstößt und der Schwerkraft überlässt. Ich nahm jedes Detail der Landschaft in mich auf, die Kurven, die Höhenunterschiede, genau wie damals, und jedes Mal, wenn ich dem Weg in Gedanken folgte, veränderte er sich. Ich fügte etwas hinzu und nahm etwas weg, wie wir es immer tun, wenn wir Erinnerungen hervorkramen. So sind Erinnerungen beschaffen, als Schnittpunkt zwischen Wirklichkeit und Fantasie.
Und so verhielt es sich auch mit meinen Erinnerungen an jenen Weg.
An einem Tag im Frühling fuhr ich zu meinem Vater. Ich hatte ihn lange nicht gesehen. Er habe das Haus aufgeräumt und alte Fotografien hervorgeholt, sagte er. Wir setzten uns an den Küchentisch und sahen die Fotos an. Sie waren über vierzig Jahre alt, und alle waren Variationen desselben Themas. Meine Schwestern und ich bei verschiedenen Aktivitäten an der frischen Luft. Im Wald, am Meer, im Gebirge. Meine Mutter war dagegen nur selten auf den Bildern zu sehen. Mein Vater sogar nie, da er schließlich alle Fotos geschossen hatte.
Zwei der Bilder weckten meine Aufmerksamkeit.
Das eine zeigte meine Schwestern und mich auf dem Sofa in der kleinen Hütte. Wir sitzen dicht nebeneinander und starren in die Kamera. Auf dem Wohnzimmertisch vor uns befinden sich drei Ostereier und der Vogelkäfig mit Wellensittich Jakob.
Auf dem anderen Foto gehen wir Hand in Hand den kleinen Weg entlang. Ich saß am Küchentisch meines Vaters und blickte auf die Bilder. Und plötzlich war ich wieder dort. Ich erinnerte mich an die Landschaft, die den Weg umgab, ich hörte die Geräusche, nahm die Gerüche wahr und die kalte frische Luft. Ich bemerkte das Rieseln des Regens, konnte hören, wie meine Hosenbeine bei jedem Schritt aneinanderscheuerten. Und ich spürte die Gummistiefel im weichen Gras landen, wenn ich die Füße aufsetzte.
Das Foto war von hinten geknipst worden. Meine Schwestern und ich sind schon fast wieder zurück an der Hütte, die kleine Wanderung ist vorbei. Ich gehe zwischen meinen Schwestern. Alle drei tragen wir einen kleinen Rucksack, meiner ist blau, die meiner Schwestern sind rot. Wir haben Mützen auf dem Kopf und halten einander an den Händen. Das Foto ist an einem kalten Tag aufgenommen worden. Die Bäume sind kahl, das Gras ist kurz und grau. Der Landschaft nach zu urteilen, ist es Spätherbst oder früher Winter.
Als ich am Küchentisch meines Vaters saß und die alten Fotos anschaute, wurde mir zum ersten Mal klar, dass der kleine Weg hinter der Hütte das Maß aller Wege gewesen ist, die ich danach beschritten habe. Ich begriff, dass ich zurückkehren und ihn noch einmal gehen musste, dass ich herausfinden musste, ob es ihn noch gab oder ob er schon längst verschwunden war, von Moos und Gras überwuchert, von der umgebenden Landschaft verschluckt. War er noch so, wie ich ihn im Gedächtnis hatte, oder hatten die vergangenen vierzig Jahre ihn derart verändert, dass der Weg, den ich einst gegangen war, nur noch in meiner Erinnerung existierte?
EIN BUCH ÜBER WEGE kann nicht zur Gänze an einem Schreibtisch geschrieben werden. Andererseits erfordert Schreiben, dass man sitzt, zumindest zeitweilig. Dieses Buch ist zu einem Schnittpunkt zwischen diesen beiden sehr ungleichen Zuständen geworden. Es wurde auf einem Computer auf einem Stuhl an einem Schreibtisch geschrieben, doch die Ideen, Gedanken, Reflexionen und Assoziationen sind mir beim Gehen gekommen.
Der in Genf geborene Philosoph Jean-Jacques Rousseau behauptete, er könne nur denken, wenn er gehe. Der englische Wissenschaftler Charles Darwin sprach von „the thinking path“ und verband dabei die beiden Zustände Gehen und Denken. Ich will mich keineswegs mit Rousseau oder Darwin vergleichen, aber auch mein Kopf funktioniert am besten, wenn ich gehe. Ich bin über Waldwege und Bürgersteige gegangen. Jedes Mal, wenn mir ein Gedanke kam, blieb ich stehen und schrieb ihn auf, ehe ich weiterging, denn eines habe ich gelernt:
Schreibst du dir solche Gedanken nicht unmittelbar auf, verschwinden sie im großen Nichts und sind für alle Zeit verloren. Gedanken entstehen nicht auf dem Sofa. Gedanken entstehen beim Gehen, als gäbe es einen geheimen Bund zwischen diesen beiden grundlegend menschlichen Aktivitäten Gehen und Denken. Auch aus diesem Grund ist es ein wenig beunruhigend, dass Menschen in unserer Zeit überwiegend still sitzen.
„Eine bezaubernde Lektüre, die sich dem Verhältnis der Menschen zum eigenen Körper, zu ihrer Umgebung und untereinander widmet.“
„Sein Buch lädt dazu ein, ihn beim Gehen zu begleiten und sich womöglich anstecken zu lassen von seiner Begeisterung für eine Fortbewegung.“
„Eine zutiefst faszinierende Meditation über jene Pfade, die wir in unserer Umwelt und im Leben beschreiten.“
„Ein überaus wertvolles Buch, das mit seinen Einsichten zum Gehen und Wandern unsere Einstellung zu Fortbewegung, Erleben und Entdecken auf den Kopf stellen kann! Eine tiefsinnige Lektüre und ein besonderes Geschenk für Buchliebhaber!“
„[Ekelund] setzt sich damit auseinander, den eigenen Weg zu gehen, um Sinnhaftigkeit zu finden: Das Gehen als spirituelle Übung, eine Art Visionssuche, bei der die Antworten, zu denen wir gelangen, weniger bedeutend sind als der Impuls, nach ihnen zu suchen.“
„Eine Rückbesinnung auf unsere Wurzeln jenseits der Sesshaftigkeit … Durch und durch voller Hingabe.“
„Dieses wunderbare Buch berührt etwas Urzeitliches in uns allen.“
„Ein neuer Blickwinkel auf die sozialen, historischen und spirituellen Bedürfnisse, die gestillt werden, indem wir einen Fuß vor den anderen setzen.“
„[Ekelund] lädt dazu ein, sich ihm auf seinem Weg, der regelmäßiges Gehen mit Achtsamkeit verbindet, anzuschließen. Dieser Einladung sollten wir alle Folge leisten.“
„Eine stille, besinnliche Lektüre.“
„Ein überaus wertvolles Buch, das mit seinen Einsichten zum Gehen und Wandern unsere Einstellung zu Fortbewegung, Erleben und Entdecken auf den Kopf stellen kann!“
„Sein Buch lädt dazu ein, ihn beim Gehen zu begleiten und sich womöglich anstecken zu lassen von seiner Begeisterung für eine Fortbewegung, die zwar langsam ist, aber zielführend.“
„Wundervoll poetisches, entschleunigendes Buch“
„Ekelund beobachtet sehr genau und schildert mit bewegenden Worten die Schönheit der Natur, aber auch ihre Grausamkeit. Ein Buch für Naturliebhaber und Norwegen Fans.“
„Ein emotionales und zugleich informatives Buch über Schicksal und Vergangenheit, Geschichte und Naturgeschehen. Schon das Lesen fühlt sich entschleunigend an.“
„Eine gelungene und tiefgründige Abhandlung über seinen eigenen Lebensweg“






























DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.