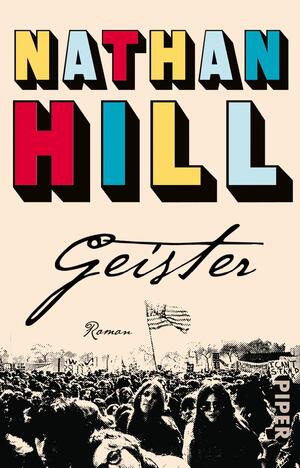
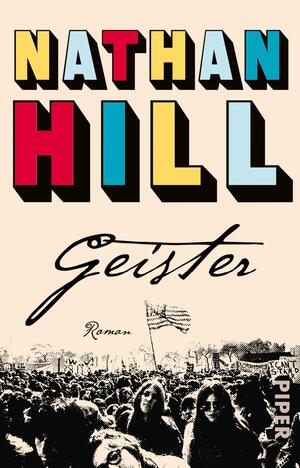
Geister Geister - eBook-Ausgabe
Roman
— Ein fesselnder amerikanischer Familienroman„Nathan Hill ist ein Erzähler, der einen langen Atem hat, ein Gespür für schwingnde Variationen, die in einer dramatischen Pointe enden und ihren Pfeil ins Herz des Lesers schicken.“ - Berliner Zeitung
Geister — Inhalt
Ein Anruf der Anwaltskanzlei Rogers & Rogers verändert schlagartig das Leben des Literaturprofessors Samuel Anderson: Nach dem tätlichen Angriff auf den republikanischen Präsidentschaftskandidaten braucht seine Mutter dringend Samuels Hilfe – doch die beiden haben sich seit über zwanzig Jahren nicht gesehen. „Geister“ ist ein allumfassender, mitreißender Roman über Liebe, Unabhängigkeit, Verrat und die lebenslange Hoffnung auf Erlösung, ein Familienroman und zugleich eine pointierte Gesellschaftsgeschichte von den Chicagoer Aufständen 1968 bis zu Occupy Wall Street.
Leseprobe zu „Geister“
Prolog
Spätsommer 1988
Hätte Samuel gewusst, dass seine Mutter weggehen würde, hätte er vielleicht besser aufgepasst, hätte ihr genauer zugehört, sie eingehender beobachtet, sich ein paar wichtige Dinge aufgeschrieben. Vielleicht hätte er sich auch anders verhalten, anderes gesagt, wäre ein anderer Mensch gewesen.
Vielleicht ein Kind, für das es sich gelohnt hätte zu bleiben.
Aber Samuel wusste nicht, dass seine Mutter weggehen würde. Er wusste nicht, dass sie sich schon seit Monaten darauf vorbereitete, insgeheim, Schritt für Schritt. Nach und nach [...]
Prolog
Spätsommer 1988
Hätte Samuel gewusst, dass seine Mutter weggehen würde, hätte er vielleicht besser aufgepasst, hätte ihr genauer zugehört, sie eingehender beobachtet, sich ein paar wichtige Dinge aufgeschrieben. Vielleicht hätte er sich auch anders verhalten, anderes gesagt, wäre ein anderer Mensch gewesen.
Vielleicht ein Kind, für das es sich gelohnt hätte zu bleiben.
Aber Samuel wusste nicht, dass seine Mutter weggehen würde. Er wusste nicht, dass sie sich schon seit Monaten darauf vorbereitete, insgeheim, Schritt für Schritt. Nach und nach schaffte sie Dinge aus dem Haus. Ein einzelnes Kleid aus dem Schrank, ein Foto aus einem Album. Eine Gabel aus der Schublade mit dem Silberbesteck. Eine Decke von unter dem Bett. Jede Woche war es etwas anderes. Ein Pullover, ein Paar Schuhe, ein Stück Weihnachtsschmuck, ein Buch. Ihre Gegenwart im Haus wurde immer flüchtiger.
Fast ein Jahr ging das so, bis Samuel und sein Vater etwas zu spüren begannen, eine Art Instabilität, ein verwirrendes, beunruhigendes und manchmal sogar unheimliches Gefühl von Auszehrung. Ganz unerwartet fiel es ihnen auf. Sie betrachteten das Bücherregal und dachten: Hatten wir nicht mehr Bücher als die, die da stehen? Sie kamen am Porzellanschrank vorbei und waren sich sicher, dass etwas fehlte. Aber was? Sie konnten ihm keinen konkreten Ausdruck geben, diesem Eindruck, dass da jemand die Umstände ihres Lebens neu organisierte. Sie begriffen nicht, dass es keine Schmorgerichte mehr zu essen gab, weil der Schmortopf aus dem Haus verschwunden war. Kam ihnen das Bücherregal leer vor, dann deshalb, weil Samuels Mutter es um die Gedichtbände erleichtert hatte. Schien der Porzellanschrank weniger voll, lag es daran, dass zwei flache, zwei tiefe Teller und eine Teekanne nicht mehr da waren.
Sie wurden ganz langsam ausgeplündert.
„Hingen da nicht mal mehr Fotos an der Wand?“, sagte Samuels Vater unten an der Treppe und kniff die Augen zusammen. „Hatten wir da oben nicht ein Bild vom Grand Canyon?“
„Nein“, sagte Samuels Mutter. „Das haben wir abgenommen.“
„Wir? Daran erinnere ich mich nicht.“
„Es war deine Entscheidung.“
„War es das?“, sagte er verwirrt. Er fürchtete, den Verstand zu verlieren.
Jahre später, im Biologieunterricht in der Highschool, hörte Samuel von afrikanischen Schildkröten, die den Atlantik durchqueren, um in Südamerika ihre Eier zu legen. Wissenschaftler fanden keine Erklärung für diese ungeheure Reise. Warum machten die Schildkröten das? Die maßgebliche Theorie dazu besagte, dass sie vor Urzeiten damit angefangen hatten, als Südamerika und Afrika noch miteinander verbunden gewesen waren. Damals hatte womöglich nur ein Fluss die beiden Kontinente getrennt, und die Schildkröten legten ihre Eier in den Sand am gegenüberliegenden Ufer. Doch dann begannen die Landmassen, auseinanderzutreiben, und der Fluss weitete sich jedes Jahr um zwei, drei Zentimeter, was für die Schildkröten nicht zu erkennen war. Also schwammen sie weiterhin zum anderen Ufer, jede Generation hatte ein winziges Stück mehr zurückzulegen, und nach Millionen von Jahren war aus dem Fluss ein Ozean geworden, ohne dass die Schildkröten es je bemerkt hätten.
Das, dachte Samuel, war die Art, wie seine Mutter sie verlassen hatte. So war sie weggegangen, unmerklich, langsam, Stück für Stück. Sie reduzierte ihre Existenz, bis sie nur noch sich selbst entfernen musste.
Am Tag, an dem sie verschwand, verließ sie das Haus mit einem einzigen Koffer.
I
Der „Packer-Attacker“
Spätsommer 2011
1
Die Schlagzeile erscheint eines Nachmittags fast gleichzeitig auf verschiedenen Seiten im Internet: Angriff auf Gouverneur Packer!
Das Fernsehen greift die Nachricht schon Augenblicke später auf, das Programm wird für eine Eilmeldung unterbrochen. Der Moderator blickt ernst in die Kamera und sagt: „Wir hören aus Chicago, dass Gouverneur Sheldon Packer angegriffen wurde.“ Das ist alles, was die Leute eine Zeit lang wissen: dass er angegriffen wurde. Für ein paar verwirrende Minuten stellen sich alle diese beiden Fragen: Ist er tot? Und: Gibt es ein Video von dem Angriff?
Dann kommen die ersten Meldungen herein, die von Reportern vor Ort in ihre Handys gesprochen werden und live über den Sender gehen. Sie sagen, Sheldon Packer sei im Conrad Hilton gewesen, wo er ein Essen gegeben und eine Rede gehalten habe. Hinterher ging der Gouverneur mit seiner Gefolgschaft durch den Grant Park, schüttelte Hände, küsste Babys, tat all die typischen Dinge, die zu einer volksnahen Kampagne gehören, als ihn plötzlich aus der Menge heraus eine Person oder Gruppe angriff.
„Was meinen Sie mit angriff?“, fragt der Moderator. Er sitzt in einem Studio mit schwarz schimmerndem Boden und rot-weiß-blauen Lichtern. Seine Gesichtshaut ist glatt wie eine Kuchenglasur. Hinter ihm sieht man Leute an Schreibtischen, die zu arbeiten scheinen. Er sagt: „Können Sie den Angriff beschreiben?“
„Alles, was ich im Moment weiß“, sagt der Reporter, „ist, dass Dinge geworfen wurden.“
„Was für Dinge?“
„Das ist noch unklar.“
„Wurde der Gouverneur getroffen? Ist er verletzt?“
„Ich glaube, er wurde getroffen, ja.“
„Haben Sie die Angreifer gesehen? Waren es viele? Die Leute, die diese Dinge geworfen haben?“
„Es gab ein großes Durcheinander. Und Geschrei.“
„Diese Dinge, die geworfen wurden, waren sie groß oder klein?“
„Ich nehme an, ich würde sagen, klein genug, um geworfen zu werden.“
„Waren sie größer als Baseballs, diese geworfenen Dinge?“
„Nein, kleiner.“
„Also golfballgroß?“
„Vielleicht trifft es das.“
„Waren sie scharf? Waren sie schwer?“
„Es ging alles so schnell.“
»War der Angriff geplant? Gibt es eine Verschwörung gegen den Gouverneur?«
„Es werden viele Fragen dieser Art gestellt.“
Ein Banner wird produziert: Terror in Chicago. Das Banner huscht an eine Stelle nahe beim Ohr des Moderators und flattert wie eine Fahne im Wind. In den Nachrichten wird eine Karte vom Grant Park gezeigt, auf einem riesigen Touchscreenfernseher. So werden Nachrichten heute präsentiert: Jemand im Fernsehen kommuniziert mithilfe eines Fernsehers, steht davor und kontrolliert das Bild, indem er es mit den Händen berührt und in Super-HD hineinzoomt. Das sieht ungeheuer cool aus.
Während man auf neue Informationen wartet, wird debattiert, ob der Vorfall die Aussichten des Gouverneurs auf das Präsidentenamt vergrößert. Ja, heißt es, da sein Wiedererkennungswert bisher noch relativ niedrig ist, zumindest außerhalb der fanatisch konservativ evangelikalen Gefolgschaft, die ihn für das liebt, was er während seiner relativ kurzen Amtszeit als Gouverneur von Wyoming getan hat. Abtreibungen wurden sofort verboten, Kinder und Lehrer mussten morgens vor dem Fahneneid öffentlich die Zehn Gebote aufsagen. Englisch wurde zur einzigen Amtssprache, und wer sie nicht fließend beherrschte, durfte weder Grund noch Immobilien besitzen. Darüber hinaus erlaubte Packer das Tragen von Waffen in Wildschutzgebieten und erließ eine Verfügung, mit der er die bundesstaatlichen Gesetze über die Bundesgesetze erhob, was laut Verfassungsrechtlern einer De-facto-Abspaltung Wyomings von den Vereinigten Staaten gleichkam. Packer war ein Gouverneur in Cowboystiefeln, der auf seiner Rinderfarm Pressekonferenzen abhielt und eine Waffe trug, einen Revolver, der in einem Lederholster an seiner Hüfte baumelte.
Gegen Ende seiner Amtszeit erklärte er, er stelle sich nicht zur Wiederwahl, um sich auf nationale Belange konzentrieren zu können, was von den Medien natürlich als Anmeldung seiner Kandidatur für das Präsidentenamt gesehen wurde.
Im Lauf der Zeit hat Packer eine Art Prediger-Schrägstrich-Cowboy-Pathos perfektioniert, und sein antielitärer Populismus spricht vor allem weiße, konservative Arbeiter an, die unter der gegenwärtigen Rezession zu leiden haben. Er vergleicht Einwanderer, die den Amerikanern die Jobs wegnehmen, mit Kojoten, die Vieh reißen, und betont dabei das Wort Kojoten mit einer schweren mittleren Silbe. Er spricht Washington, D.C., mit einem r aus, sodass es zu Warshington wird. Er sagt groggy statt müde, verschleift und verbeißt einzelne Worte und drückt sich für eine nationale politische Gestalt staunenswert zwanglos aus. Ausdrücke wie zum Henker, verflucht, verdammt kombiniert er mit nonverbalen Mitteln, er zwinkert, zuckt albern im Schreck zusammen oder zieht theatralisch die Stirn kraus, was seine Volkstümlichkeit noch unterstreicht.
Man hat immer wieder den Eindruck, dass die Worte exakt in dem Moment seinen Mund verlassen, da sie ihm in den Sinn kommen. Er redet, ohne sich um Kontext oder Syntax zu scheren oder auch nur zu versuchen, seine Sätze inhaltlich mit dem in Verbindung zu bringen, was gerade sein Thema ist. Sein Redestil ist eine Art verbaler Impressionismus. Befreit von den Zwängen überkommener Grammatik, arbeiten sich seine Sätze nicht unbedingt logisch voran, sondern bilden eine semantische Suppe, einen Brei frei assoziierter Punkte, der von hier nach da treibt und in gewisser Weise das sprachliche Äquivalent einer Überflutung darstellt, die mit sich reißt, was immer sie will. Heute zum Beispiel, am Tag des Angriffs auf ihn, hat er den Präsidenten kritisiert, der gerade auf Martha’s Vineyard Urlaub macht. Vor dem Essen auf seiner Spendengala verkündete er seinen Unterstützern: »Es ist von symbolischer Wichtigkeit, wo er ist, und ich weiß nicht, warum sich unser Präsident gerade jetzt überhaupt noch die Mühe macht und all diese Versprechungen und Plattitüden ausspuckt, etwa wenn er uns verspricht, nicht zu ruhen, bis jeder Amerikaner einen Job hat, und trotzdem düst er los und steckt zehn Tage lang seine Zehen in den Sand, in einer ziemlich elitären Hautevolee-Gegend, während der Rest von uns normalen Leuten einfach nur den Kopf schüttelt und in die Hände spuckt, wie wir Amerikaner es früher getan haben, und wir fragen uns, warum er nicht den Einzelnen in unseren kleinen Unternehmen und die Familien stärkt, damit wir unsere eigenen Entscheidungen fällen und die Regierung uns nicht sagen muss, was wir tun sollen, damit außerdem der private Sektor wächst und gedeiht, und die Stimulierung der Wirtschaft, die auf der Entwicklung unserer natürlichen Ressourcen und der besten Arbeitsmoral der ganzen Welt basiert.«
Seine Unterstützer sagen, genau so reden die normalen, nicht elitären Leute aus Wyoming.
Seine Kritiker heben gern hervor, dass seine gesetzgeberische Leistung, nachdem die Gerichte so gut wie all seine Initiativen in Wyoming zu Fall gebracht haben, praktisch gleich null sei. Das scheint die Leute aber nicht zu stören, die auch weiterhin für seine 500-Dollar-pro-Teller-Galadinner (die er übrigens „Futtertänzchen“ nennt), seine 10 000-Dollar-Vorträge und sein 30-Dollar-Hardcover-Buch Das Herz eines wahren Amerikaners die Geldbörsen zücken und so seine „Kriegskasse“ füllen, wie die Nachrichten es nennen, „für eine mögliche zukünftige Präsidentschaftskandidatur“.
Und jetzt ist der Gouverneur angegriffen worden! Wobei niemand zu wissen scheint, wie er angegriffen wurde, womit, von wem und ob er verletzt ist. Nachrichtensprecher spekulieren über den möglichen Schaden, der entsteht, wenn eine Kugellagerkugel oder eine Marmorkugel mit großer Geschwindigkeit direkt in ein Auge trifft. Sie sprechen gut zehn Minuten darüber, mit Schaubildern, die zeigen, wie eine kleine Masse mit knapp hundert Stundenkilometern die flüssige Membran des Auges durchschlägt. Als das Thema erschöpft ist, unterbrechen sie die Sendung für ein paar Werbeclips. Sie preisen ihre kommende Dokumentation zum zehnjährigen Jubiläum des 11. September an: Tag des Terrors, Jahrzehnt des Krieges. Sie warten.
Dann endlich geschieht etwas, das die Nachrichtensendung aus dem Stillstand erlöst, in den sie geraten ist: Der Moderator erscheint im Bild und verkündet, dass ein Zuschauer die ganze Geschichte gefilmt und online gestellt hat.
Und hier ist das Video, das während der nächste Woche etliche Tausend Mal im Fernsehen gezeigt, millionenfach angeklickt und der drittmeistgesehene Internetclip des Monats werden wird, hinter dem neuen Musikvideo der Teen-Pop-Gesangssensation Molly Miller mit You Have Got to Represent und einem Familienvideo von einem Kleinkind, das lacht, bis es umfällt. Zu sehen ist Folgendes:
Das Video beginnt weiß, man hört, wie der Wind über das ungeschützte Mikrofon bläst, dann tasten sich Finger heran, reiben über das Mikro und produzieren ein muschelartiges Rauschen, die Blende der Kamera wird auf das helle Tageslicht eingestellt, das Weiß löst sich in einen blauen Himmel sowie in ein unbestimmtes, verschwommenes Grün auf, vermutlich Gras, und eine Männerstimme spricht zu nahe am Mikrofon: „Ist sie an? Ich habe keine Ahnung, ob sie an ist.“
Das Bild wird scharf, der Mann hält die Kamera auf seine Füße gerichtet. Gereizt und leicht verzweifelt sagt er noch einmal: „Ist sie überhaupt an? Woran sieht man das?“ Dann eine Frauenstimme, ruhiger, melodiös, friedlich, sie sagt: „Sieh hintendrauf. Was steht da?“ Und ihr Mann, ihr Freund oder wer auch immer er ist, der das Bild einfach nicht ruhig halten kann, sagt: „Würdest du mir vielleicht helfen?“ Er sagt das auf eine aggressive, anklagende Weise, die wohl ausdrücken soll, dass sein Problem mit der Kamera allein ihre Schuld ist. Und die ganze Zeit über sieht man nichts als eine ruckende, schwindelerregende Nahaufnahme seiner Schuhe. Es sind klobige, weiße, hohe Sportschuhe. Sie sehen unglaublich weiß und neu aus. Er scheint auf einem Campingtisch zu stehen. „Was steht hintendrauf?“, fragt die Frau.
„Wo hinten?“
„Auf dem Bildschirm.“
„Das weiß ich auch“, sagt er. „Aber wo dadrauf?“
„Unten rechts“, antwortet sie völlig ruhig. „Was steht da?“
„Einfach nur ein R.“
„Das heißt, dass die Aufnahme läuft. Sie ist an.“
„Wie blöd“, sagt er. „Warum steht da nicht einfach An?“
Das Bild wechselt jetzt zwischen seinen Schuhen und einer, wie es scheint, Menschenansammlung in mittlerer Entfernung.
„Da ist er! Sieh doch! Da ist er!“, ruft der Mann. Er richtet die Kamera nach vorn, und als es ihm endlich gelingt, sie ruhig zu halten, kommt Sheldon Packer ins Bild, vielleicht dreißig Meter entfernt, umgeben von seinem Tross und seinen Sicherheitsleuten. Es sind nicht zu viele Menschen da, aber diejenigen, die weiter vorn stehen, merken plötzlich, dass da etwas geschieht, dass sich da jemand Berühmtes nähert, und der Mann mit der Kamera fängt an zu rufen: „Gouverneur! Gouverneur! Gouverneur! Gouverneur! Gouverneur! Gouverneur! Gouverneur!“ Das Bild beginnt wieder zu wackeln, vermutlich weil der Kerl herumspringt oder winkt, vielleicht auch beides.
„Wie zoomt man mit dem Ding?“, sagt er.
„Drück auf ›Zoom‹“, sagt die Frau. Das Bild fährt näher heran, was zu noch größeren Schärfe- und Blendenproblemen führt. Tatsächlich taugt das Material nur deswegen fürs Fernsehen, weil der Mann die Kamera am Ende seiner Partnerin gibt und sagt: „Hier, nimm du mal.“ Er selbst läuft vor, um dem Gouverneur die Hand zu schütteln.
Später wird der erste Teil von den Fernsehleuten weggeschnitten, sodass der Clip, der Hunderte Male im Fernsehen gezeigt wird, hier beginnt, an dieser Stelle, mit einem Standbild und einem kleinen roten Kreis um die Frau, die rechts im Bild auf einer Parkbank sitzt. „Das scheint die Täterin zu sein“, sagt der Moderator. Sie hat weiße Haare, ist wahrscheinlich um die sechzig, sitzt da, liest ein Buch und verhält sich in keiner Weise auffällig – wie eine Komparsin in einem Film komplettiert sie das Bild. Die Frau trägt eine hellblaue Bluse über einem Trägerhemd und eng anliegende schwarze Leggings, die an Yoga denken lassen. Das kurze Haar ist zerzaust und fällt ihr in kleinen Zacken in die Stirn. Die Frau hat etwas athletisch Kompaktes, ist schlank, aber doch muskulös. Sie sieht, was um sie herum geschieht. Sie sieht den Gouverneur näher kommen, klappt das Buch zu, steht auf und guckt. Ganz am Rand des Bildes steht sie und versucht sich offenbar zu entscheiden, was sie tun soll. Die Hände hat sie in die Hüften gestützt. Sie beißt sich innen auf die Backe. Es sieht aus, als würde sie ihre Möglichkeiten abwägen. Die Frage in dieser Haltung scheint zu sein: Soll ich?
Dann geht sie los, schnell, auf den Gouverneur zu. Ihr Buch hat sie auf die Bank gelegt, und sie geht mit den großen Schritten, mit denen Vorstädter Runden um die Mall drehen. Nur dass sie die Arme ruhig an den Seiten hält, die Fäuste geballt. Bald ist sie in Wurfweite des Gouverneurs, und in diesem Moment teilt sich die Menge, aus einem Zufall heraus, sodass die Frau aus dem Blickwinkel unserer Filmerin freie Sicht auf den Gouverneur hat. Sie steht auf dem Kiesweg, sieht nach unten, bückt sich und nimmt eine Handvoll Kiesel. So bewaffnet, beginnt sie zu schreien, und sie ist sehr klar zu hören, da genau in diesem Moment der Wind nachlässt und die Menge verstummt, als wüssten alle, dass es zu diesem Ereignis kommen wird. Als täten sie, was sie könnten, um nichts zu verpassen. Die Frau schreit: „Du Schwein!“ und wirft die Steine.
Es kommt zu einem Durcheinander. Die Leute drehen sich um, um zu sehen, wer da so schreit, einige weichen zurück und drehen sich weg, als sie von den Steinen getroffen werden. Und die Frau hebt noch eine Handvoll auf und wirft, bückt sich und wirft, bückt sich und wirft, wie ein Kind bei einer Schneeballschlacht. Die Leute ducken sich weg, Mütter schützen die Gesichter ihrer Kinder, und der Gouverneur krümmt sich und hat eine Hand vor dem rechten Auge. Die Frau wirft immer weiter, bis die Sicherheitsleute sie erreichen und packen. Oder sie nicht wirklich packen, sie umarmen sie eher und fallen mit ihr um, wie erschöpfte Ringer.
Und das war’s. Das Video dauert kaum ein paar Minuten. Auf seine Ausstrahlung folgen kurz nacheinander bestimmte Informationen. Der Name der Frau wird bekannt gegeben: Faye Anderson-Andresen, und alle im Studio sagen fälschlicherweise „Anderson-Anderson“ und ziehen Verbindungen zu anderen berüchtigten Doppelnamen, insbesondere Sirhan Sirhan. Schnell stellt sich heraus, dass sie eine Lehrassistentin an einer örtlichen Grundschule ist, was gewissen Experten Munition gibt, die nun erklären, die radikal-liberale Agenda habe das öffentliche Bildungssystem erobert. Die Schlagzeile wird umformuliert: Lehrerin attackiert Gouverneur Packer!, bis eine Stunde später jemand ein Bild findet, auf dem die Frau angeblich zu sehen ist, wie sie 1968 an einer Protestveranstaltung teilnimmt. Auf dem Foto trägt sie eine große runde Brille. Sie scheint sich an eine Person zu lehnen, die sich außerhalb des Bildausschnitts befindet. Hinter ihr hält jemand ein Plakat hoch, auf dem „Ich hasse Krieg!“ steht.
Die Schlagzeile lautet jetzt: Radikale 68erin attackiert Gouverneur Packer!
Und als wäre die Sache damit nicht schon köstlich genug, kommen am Ende des Tages noch zwei Dinge hinzu, die den Nachrichtenwert der Geschichte gleichsam in die Stratosphäre katapultieren. Zunächst wird berichtet, dass sich Gouverneur Packer einer Notoperation am Augapfel unterziehen musste. Und dann taucht ein erkennungsdienstliches Foto der Frau auf, das zeigt, dass sie 1968 verhaftet, wenn auch nie offiziell angeklagt oder verurteilt wurde, und zwar wegen Prostitution.
Das ist schlicht zu viel. Wie kann eine einzige Schlagzeile all diese erstaunlichen Einzelheiten aufnehmen? Radikale Hippie-Prostituierte und Lehrerin trifft bei bösartigem Angriff Gouverneur Packers Auge!
In den Nachrichten wird wieder und wieder der Teil des Videos gezeigt, in dem es den Gouverneur erwischt. Im kühnen Versuch, allen genau den Moment zu zeigen, in dem sich ein scharfer Kiesel in die Hornhaut seines rechten Auges bohrt, wird sein Bild weiter und weiter vergrößert, sodass alles pixelig und körnig aussieht. Experten streiten über die Bedeutung des Angriffs und ob er als Bedrohung der Demokratie zu bewerten sei. Einige nennen die Frau eine Terroristin, andere sagen, diese Formulierung zeige, wie tief der politische Diskurs mittlerweile gesunken sei, wieder andere meinen, der Gouverneur habe die Attacke provoziert, indem er sich so rücksichtslos für das Tragen von Waffen ausspreche. Verbindungen zum Weather Underground und den Black Panthers werden gezogen. Die National Rifle Association gibt eine Stellungnahme heraus, in der es heißt, hätte Gouverneur Packer seinen Revolver getragen, wäre es nie zu diesem Vorfall gekommen. Die Leute an den Schreibtischen hinter dem Moderator scheinen währenddessen nicht schwerer zu arbeiten als früher am Tag.
Es dauert ungefähr fünfundvierzig Minuten, bis einer der Texter den Ausdruck „Packer-Attacker“ verwendet, der sofort von allen Networks aufgegriffen und in das Banner der Berichterstattung eingebaut wird.
Die Frau selbst wird in einem Gefängnis im Stadtzentrum festgehalten und wartet darauf, dass offiziell Anklage erhoben wird. Sie verweigert die Aussage. Ohne eine Erklärung ihrerseits verbinden sich die Meinungen, Annahmen und wenigen Fakten zu einer Art Urstory, die sich in den Köpfen der Leute festsetzt: Die Frau, ein ehemaliger Hippie, ist eine radikale Liberale, die den Gouverneur derartig hasst, dass sie auf ihn gewartet hat, um ihn vorsätzlich auf eine so bösartige Weise anzugreifen.
Allerdings klafft ein gleißendes logisches Loch in dieser Theorie, da der Abstecher des Gouverneurs in den Park nicht geplant war und selbst seine Sicherheitsleute davon überrascht wurden. Die Frau konnte also nicht wissen, dass er kommen würde, und somit auch nicht im Hinterhalt auf ihn warten. Dieser Widerspruch geht jedoch im allgemeinen Sensationswert der Geschehnisse unter und wird niemals untersucht.
2
Professor Samuel Anderson sitzt in der Dunkelheit seines kleinen Universitätsbüros, das Gesicht grau erleuchtet vom Schein des Computerbildschirms. Jalousien decken die Fenster ab, ein Handtuch verschließt den Spalt unter der Tür. Er hat den Papierkorb auf den Korridor gestellt, damit der Nachtwächter ihn nicht stört. Samuel Anderson trägt Kopfhörer, damit niemand hört, was er tut.
Er loggt sich ein und kommt zum Eröffnungsbild des Spiels, auf dem die allseits bekannten und sich bekriegenden Orks und Elfen zu sehen sind. Er hört die Blechbläser, triumphierend, kühn und kriegerisch, und gibt das Passwort ein, das noch komplizierter und vertrackter ist als das für sein Bankkonto. Als er in die World of Elfscape eintritt, tut er das nicht als der Juniorprofessor für Englisch Samuel Anderson, sondern als Dodger, der Elfendieb, und er hat das Gefühl, in ein Zuhause zurückzukommen, wo sich jemand auf ihn freut. Es ist genau dieses Gefühl, das ihn sich immer wieder einloggen lässt. Bis zu vierzig Stunden in der Woche bereitet er sich auf einen Angriff wie den des heutigen Abends vor, bei dem er gemeinsam mit seinen anonymen Onlinefreunden etwas Großes, Gefährliches umbringen wird.
Heute ist es ein Drache.
Sie loggen sich aus Kellern, Büros, düster erleuchteten Hobbyräumen und Arbeitswaben ein, aus öffentlichen Bibliotheken und Wohnheimzimmern, sie sitzen an Laptops, die auf Küchentischen liegen, und an heiß surrenden Computern, die klicken und knistern, als würde in ihnen ein Stück Fleisch gegrillt. Sie setzen ihre Kopfhörer auf, loggen sich ein und tauchen in die Welt ihres gemeinsamen Spiels ein, wie sie es jeden Mittwoch-, Freitag- und Samstagabend während der letzten paar Jahre getan haben. Fast alle leben in Chicago oder zumindest in der Nähe. Der Spielserver, zu dem ihre Daten geleitet werden, einer von Tausenden weltweit, steht in einem ehemaligen Fleischverarbeitungskomplex im Süden der Stadt. Um Verzögerungen und Wartezeiten zu vermeiden, verbindet dich Elfscape immer mit dem Server, der deinem Standort am nächsten ist, und das heißt, dass sie praktisch alle Nachbarn sind, obwohl sie sich im wirklichen Leben nie gesehen haben.
„He, Dodger!“, sagt jemand, als sich als Samuel einloggt.
He, schreibt er. Er sagt nie etwas, und sie denken, es liegt daran, dass er kein Mikro hat. Natürlich hat er eines, aber er fürchtet, dass während des Kampfes ein Kollege den Flur herunterkommen und ihn von Drachen reden hören könnte. Die „Gilde“ weiß tatsächlich nichts von ihm, nur dass er keinen Angriff verpasst und im Allgemeinen alle Worte ausschreibt, statt die im Internet gebräuchlichen Kürzel zu verwenden. Er schreibt zum Beispiel „bin gleich wieder da“ und nicht das übliche brb für „be right back“ oder „nicht an der Tastatur“ statt afk für „away from keyboard“. Die Leute sind sich nicht sicher, warum er auf diesem Anachronismus besteht. Im Übrigen denken sie, der Name „Dodger“ hätte etwas mit Baseball zu tun, dabei ist es ein Bezug auf Dickens. Dass niemand hinter die Anspielung kommt, gibt Samuel das Gefühl, klüger und seinen Mitspielern überlegen zu sein, was er braucht, um mit der Scham zurechtzukommen, dass er so viel Zeit mit einem Spiel verbringt, das auch von Zwölfjährigen gespielt wird.
Samuel sagt sich, dass Millionen anderer Leute das auch tun. Auf allen Kontinenten. Rund um die Uhr. Zu jeder Tages- und Nachtzeit hat die Zahl der World of Elfscape spielenden Leute etwa das Ausmaß der Bevölkerung von Paris, sagt er sich, wenn er wieder diesen Riss in sich spürt, weil sein Leben an diesen Punkt gekommen ist.
Einer der Gründe, warum niemand wissen soll, dass er World of Elfscape spielt, besteht darin, dass er gefragt werden könnte, worum es in dem Spiel geht. Was sollte er darauf antworten? Das Ziel ist, Drachen und Orks zu töten?
Man kann das Spiel auch als Ork spielen, was heißt, dass das Ziel darin bestände, Drachen und Elfen zu töten.
Das ist es, das ist die Szenerie, die Grundkonstellation, das Yin und Yang, auf dem alles fußt.
Er hat als Level-eins-Elf angefangen und sich bis auf Level neunzig hochgearbeitet, was ihn grob zehn Monate gekostet hat. Zehn Monate voller Abenteuer. Über Kontinente ist er gereist, hat Leute kennengelernt, Schätze gefunden, Aufgaben erfüllt. Auf Level neunzig ist er in eine Gilde eingetreten, und nun löscht er zusammen mit seinen Gildekameraden Drachen und Dämonen aus und ganz besonders Orks. Er hat so viele Orks getötet. Wenn er einen von ihnen an einer der kritischen Stellen trifft, gibt es ein Geräusch, einen orkischen Todesschrei. Er braucht dieses Geräusch, er ist süchtig danach. Samuel gehört zur Klasse der Diebe, und so gehören Taschendiebstahl, die Herstellung von Bomben und das Sich-unsichtbar-Machen zu seinen speziellen Fähigkeiten, wobei er sich am liebsten aufs Territorium der Orks schleicht, Dynamit auf ihren Straßen versteckt und sie damit in die Luft jagt. Anschließend plündert er die Leichen seiner Feinde, nimmt ihnen ihre Waffen, ihr Geld und ihre Kleider ab und lässt sie nackt und tot zurück.
Warum das so unwiderstehlich ist, kann er nicht sagen.
Heute Abend treffen sich zwanzig bewaffnete und gepanzerte Elfen, um gemeinsam einen Drachen zu erledigen. Es ist ein sehr großer Drache mit rasiermesserscharfen, metergroßen Zähnen. Und er spuckt Feuer. Und er ist mit metallenen Schuppen bedeckt, was man erkennen kann, wenn die Grafikkarte gut genug ist. Der Drache liegt schlafend da. Wie eine Katze eingerollt auf dem Boden seiner Höhle, die sich natürlich in einem ausgehöhlten Vulkan befindet. Die Decke ist hoch genug, dass der Drache ausgiebig fliegen kann, denn während der zweiten Phase des Kampfes wird er sich in die Luft erheben, über ihnen kreisen und Brandbomben auf ihre Köpfe werfen. Es ist das vierte Mal, dass sie versuchen, den Drachen zu töten, Phase zwei haben sie nie überlebt. Sie wollen ihn töten, weil er einen Schatz bewacht, Waffen und Rüstungen, die hinten in seiner Höhle liegen und ihnen in ihrem Krieg gegen die Orks helfen werden. Adern hellroter Magma glühen direkt unter dem Felsboden der Höhle. In der dritten und letzten Phase des Kampfes werden sie aufbrechen, was sie noch nicht erlebt haben, weil sie nicht wissen, wie sie mit den Brandbomben klarkommen sollen.
„Habt ihr euch die Videos angesehen, die ich euch geschickt habe?“, fragt ihr Anführer, ein Elfenkrieger namens Pwnage. Einige Spieleravatare nicken mit den Köpfen. Er hat ihnen Anleitungen gemailt, wie sich der Drachen bezwingen lässt. Sie sollten sich genau ansehen, wie Phase zwei zu bewältigen ist. Der Trick scheint darin zu bestehen, immer in Bewegung zu bleiben und sich nicht zusammentreiben zu lassen.
GREIFEN WIR AN!!!, schreibt Axman, der im Moment eine Felswand begattet. Etliche Elfen springen auf und ab, während Pwnage noch einmal das Vorgehen erläutert.
Samuel spielt Elfscape von seinem Bürocomputer aus, weil die Internetverbindung hier schneller ist, was seine Angriffsstärke bei einem Kampf wie diesem um bis zu zwei Prozent erhöht, allerdings nur, solange es keine Probleme mit der Bandbreite gibt, etwa weil sich die Studenten gerade für ihre Kurse anmelden. Samuel unterrichtet Literatur, das College ist klein und liegt etwa eine Autostunde nordwestlich von Chicago, wo die großen Freeways vor riesigen Warenhäusern und Büroparkplätzen enden und in dreispurige, verstopfte Straßen übergehen, über die Eltern ihre Kinder in Samuels Kurse schicken.
Kinder wie Laura Pottsdam, blond, leicht sommersprossig und nachlässig gekleidet, in mit Logos bedruckten Tanktops und Sweatshorts mit quer über den Hintern geschriebenen Wörtern. Laura studiert Wirtschaftsmarketing und Kommunikation und besucht Samuels Einführung in die Literatur. Sie ist heute kurz in den Kurs gekommen, um eine abgekupferte Arbeit einzureichen, und wollte gleich wieder verschwinden.
„Wenn es einen Test gibt“, meinte sie, „dann bleibe ich. Wenn nicht, muss ich wirklich sofort wieder weg.“
„Gibt es einen Notfall?“, fragte er.
„Nein. Aber ich möchte auf keinen Fall Punkte verlieren. Machen wir heute was, wofür es Punkte gibt?“
„Wir diskutieren, was Sie gelesen haben. Das sollte Sie interessieren.“
„Aber gibt es dafür Punkte?“
„Nein, nicht direkt.“
„Okay, dann muss ich wirklich wieder weg.“
Sie lasen gerade Hamlet, und Samuel hatte vorhergesehen, dass der Unterricht ein Kampf werden würde. So viel Sprache erschöpft die Studenten. Als Aufgabe hatte er ihnen mitgegeben, etwas über die logischen Fehlschlüsse in Hamlets Denken zu Papier zu bringen, was, wie er selbst zugeben muss, eine Schwachsinnsaufgabe war. Natürlich haben die Studenten gefragt, warum sie das machen müssten. Wann werden wir je in unserem Leben etwas über Hamlet wissen müssen?
Samuel hatte dem Kurs von vornherein nicht mit Freude entgegengesehen.
Woran er in solchen Augenblicken denkt, ist, dass er einmal eine ziemlich große Nummer war. Als er gerade vierundzwanzig war, wurde eine seiner Geschichten in einer Zeitschrift veröffentlicht, und zwar nicht in irgendeiner Zeitschrift, sondern in der, auf die es ankam, in einer Sonderausgabe über junge Autoren mit dem Titel: „Fünf unter fünfundzwanzig. Die nächste Generation großer amerikanischer Autoren“. Und er, Samuel, war einer von ihnen. Es war das Erste, was er je veröffentlicht hatte, und blieb, wie sich herausstellen sollte, leider auch das Einzige. Sie brachten sein Bild, ein paar biografische Informationen und seine großartige Geschichte. Tags darauf bekam er etwa fünfzig Anrufe von wichtigen Buchleuten. Sie wollten mehr. Er hatte aber nichts. Das war ihnen egal, und so unterschrieb er einen Vertrag und bekam eine Menge Geld für ein Buch, das er erst noch schreiben musste. Das war vor zehn Jahren, vor Amerikas gegenwärtiger finanzieller Enge, vor der Immobilien- und Bankenkrise, die die Weltwirtschaft ziemlich mitgenommen hat. Manchmal denkt Samuel, dass sein Weg mehr oder minder den gleichen Verlauf wie das Weltfinanzsystem genommen hat: Die guten Zeiten im Sommer 2001 kommen einem im Nachhinein wie ein angenehmer und zugleich skurriler Traum vor.
GREIFEN WIR AN!!!, schreibt Axman wieder. Er hat aufgehört, die Höhlenwand zu begatten, und hüpft jetzt auf der Stelle. Samuel denkt: Neunte Klasse, tragisch picklig, eine hyperaktive Störung, wahrscheinlich sitzt er eines Tages in meiner Einführung in die Literatur.
„Was halten Sie von Hamlet?“, hat Samuel seinen Kurs gefragt, nachdem Laura wieder verschwunden war.
Stöhnen, finstere Blicke. Ein Typ in der letzten Reihe hob beide Hände und richtete die fetten Metzgerdaumen nach unten.
„Langweilig“, sagte er.
„Das ergibt alles keinen Sinn“, sagte ein anderer.
„Zu lang“, noch ein anderer.
„Viel zu lang.“
Samuel stellte seinen Studenten Fragen, mit denen er ein Gespräch in Gang zu setzen hoffte: Glauben Sie, den Geist gibt es wirklich, oder halluziniert Hamlet? Warum, denken Sie, heiratet Gertrude so schnell wieder? Ist Claudius ein Schuft oder Hamlet einfach nur verbittert? Und so weiter. Keine Reaktion. Nichts als leere Vogelblicke. Alle starrten auf ihre Computer. Sie starren immer auf ihre Computer. Samuel hat keine Gewalt über die Dinger, er kann sie nicht ausschalten. Sämtliche Seminarräume sind mit Computern ausgestattet, jeder einzelne Platz. Das College brüstet sich damit in seinem Werbematerial, das es an die Eltern verschickt: Voll vernetzter Campus! Wir bereiten unsere Studenten auf das 21. Jahrhundert vor! Samuel hat eher den Eindruck, dass die Studenten darauf vorbereitet werden, still dazusitzen und so zu tun, als arbeiteten sie. So zu tun, als konzentrierten sie sich, während sie tatsächlich Sportergebnisse googeln, E-Mails lesen, Videos gucken oder in Gedanken davontreiben. Und wenn er richtig darüber nachdenkt, ist das vielleicht das Wichtigste, was man ihnen über den amerikanischen Arbeitsplatz beibringen kann: Wie sitze ich ruhig an meinem Schreibtisch und surfe durchs Internet, ohne durchzudrehen.
„Wie viele von Ihnen haben das ganze Stück gelesen?“, fragte Samuel, und von den fünfundzwanzig Studenten im Raum hoben nur vier die Hand. Und sie hoben sie langsam, scheu, verlegen, weil sie die ihnen aufgetragene Aufgabe erledigt hatten. Die Übrigen hingen verächtlich auf ihren Stühlen, um ihrer grenzenlosen Langeweile Ausdruck zu geben. Es war, als gäben sie ihm die Schuld an ihrer Apathie. Wenn er ihnen keine so schwachsinnige Aufgabe gestellt hätte, wären sie nicht gezwungen gewesen, sie nicht zu erfüllen.
„An die Waffen“, sagt Pwnage und sprintet mit einer riesigen Axt in der Hand auf den Drachen zu. Der Rest der Gruppe folgt ihm wild schreiend, so, wie es Krieger in Filmen über mittelalterliche Kriegsführung tun.
Pwnage, das sollte gesagt werden, ist ein Elfscape-Genie. Ein Mensch mit einer Inselbegabung für Videospiele. Von den zwanzig Elfen, die heute Abend da sind, kontrolliert er sechs. Er hat ein ganzes Dorf voller Charaktere, aus denen er auswählen kann, und vermischt und verbindet sie je nach Art des anstehenden Kampfes. Sie bilden eine eigene, autarke Mikroökonomie, und er setzt sie simultan ein, wozu er eine unglaublich fortgeschrittene Technik namens „Multiboxing“ verwendet, bei der mehrere vernetzte Computer mit einem zentralen Kommandogehirn verbunden sind, das er mit vorprogrammierten Manövern über seine Tastatur sowie über einen Controller mit fünfzehn Knöpfen steuert. Pwnage weiß alles, was es über das Spiel zu wissen gibt, und er scheint die Geheimnisse von Elfscape samt und sonders verinnerlicht zu haben. Er ist wie ein Baum, der irgendwann eins wird mit dem Zaun, neben dem er wächst. Er vernichtet Orks und begleitet den todbringenden Schlag oft mit seinem Erkennungssatz:
Ich hab dein face gepwned n00b!!!
Während Phase eins des Kampfes müssen sie vor allem auf den Schwanz des Drachen achten, der hin- und herschlägt und auf den Höhlenboden donnert. Sie hacken minutenlang auf das Untier ein und weichen dem Schwanz aus, bis der Drache nur noch sechzig Prozent Lebensenergie hat. Das ist der Punkt, an dem er sich in die Luft erhebt.
„Phase zwei“, sagt Pwnage mit ruhiger Stimme, die durch die Übertragung durch das Internet etwas Roboterhaftes hat. „Gleich kommt das Feuer. Steht nicht rum, lasst euch nicht erwischen.“
Feuerbälle trommeln auf die Angreifer nieder, und während es für viele Spieler eine Herausforderung ist, ihnen auszuweichen und gleichzeitig ihren Kampf weiterzuführen, agieren Pwnages Charaktere völlig mühelos, alle sechs. Leichtfüßig bewegen sie sich nach links oder rechts, sodass die Brandbomben sie um wenige Pixel verfehlen.
Auch Samuel versucht dem Feuer zu entgehen, ist mit den Gedanken aber bei dem Test, den er die Studenten heute dann doch hat schreiben lassen. Nachdem Laura gegangen war und sich herausgestellt hatte, dass kaum jemand seine Hausaufgaben gemacht hatte, wollte er sie bestrafen. Mit zweihundertfünfzig Worten sollten sie den ersten Akt Hamlets beschreiben. Sie stöhnten. Er hatte das nicht vorgehabt, aber Lauras Verhalten machte ihn passiv-aggressiv. Das hier war eine Einführung in die Literatur, und diesem Mädchen ging es um nichts als ihre Punkte.
Das Thema des Kurses interessierte sie nicht, nur seine Währung. Sie erinnerte ihn an einen Händler an der Wall Street, der an einem Tag Kaffeefutures kauft und am nächsten hypothekengestützte Wertpapiere. Das, womit gehandelt wurde, war weniger wichtig als sein Wert. Laura dachte allein an das, was unter dem Strich blieb, ihre Note, sonst war nichts von Bedeutung.
Für die meisten seiner Studenten ist die Ausbildung nichts als eine Abfolge zu absolvierender Aufgaben. Es ist wie in einer Fabrik: Wer die Arbeit tut und wie, ist ohne Belang, solange sie getan wird.
Und hier ist der Punkt: Vielleicht haben sie ja recht.
Früher hat Samuel ihre Arbeiten korrigiert, mit einem roten Stift. Er hat ihnen den Unterschied von „hing“ und „hängte“ beigebracht, wann „dass“ mit zwei „s“ geschrieben wird, was ein „Affekt“ ist und was ein „Effekt“, wann man „als“ sagt und wann „wie“. All diese Dinge. Und dann tankte er eines Tages an der Tankstelle direkt vor dem Campus, die Kum-In-’n-Go heißt, und betrachtete das Schild und dachte: Warum das alles?
Wirklich, ernsthaft: Wofür würden sie je Hamlet brauchen?
Er ließ sie den Test schreiben und beendete den Kurs eine halbe Stunde vor der Zeit. Er war müde. Er stand vor der uninteressierten Meute und begann sich zu fühlen wie Hamlet in seinem ersten Monolog, substanzlos. Er wollte verschwinden, wollte, dass sein Fleisch zerging und sich in Tau auflöste.
So geht es ihm in letzter Zeit oft: dass er sich kleiner fühlt als sein Körper, als wäre sein Geist geschrumpft. Immer ist er der, der seine Armlehnen im Flugzeug aufgibt, immer der, der auf dem Bürgersteig Platz macht.
Dass dieses Gefühl mit seiner neuerlichen Suche nach Fotos von Bethany im Internet zusammenfällt, ist nur zu offensichtlich. Sobald er etwas tut, das Schuldgefühle in ihm weckt, und das ist in diesen Tagen eigentlich ständig der Fall, kehren seine Gedanken zu ihr zurück. Bethany, seine größte Liebe und seine größte Pleite. Soweit er weiß, wohnt sie immer noch in New York. Eine Geigerin, die auf den wichtigsten Bühnen steht, Soloalben aufnimmt und auf Welttourneen geht. Sie zu googeln ist, als öffnete er einen Hahn in sich. Er weiß nicht, warum er sich so bestraft, alle paar Monate, sich bis spät in die Nacht Bilder von ihr ansieht, von der schönen Bethany in Abendkleidern, mit ihrer Geige und riesigen Rosensträußen, umgeben von ihren sie anbetenden Fans. In Paris, Melbourne und New York.
Was würde sie von seiner Spielerei denken? Sie wäre enttäuscht, natürlich. Sie würde denken, Samuel ist nicht erwachsen geworden, ist immer noch ein Junge, der im Dunkeln sitzt und Videospiele spielt. Immer noch der Junge, der er war, als sie sich kennenlernten. Samuel denkt an Bethany, wie andere Leute an Gott denken mögen. So wie in: Wie beurteilt mich Gott? Wie wird er mich richten? Samuel folgt dem gleichen Impuls, nur dass er Gott durch die andere große Abwesenheit ersetzt hat: Bethany. Und manchmal, wenn er denkt, es wird zu viel, fällt er in ein Loch, und es ist, als stünde er neben sich und seinem Leben, als führte er es nicht selbst, sondern beobachtete und bewertete es nur – dieses Leben, das seltsamerweise, unglücklicherweise, seines ist.
Das Fluchen seiner Gildekameraden holt ihn zurück ins Spiel. Die Elfen sterben schnell. Der Drache brüllt über ihnen, während sie ihre Waffen gegen ihn richten, ihn mit Pfeilen und Musketenkugeln beschießen, Messer werfen und elektrische Blitze auf ihn abfeuern, die aus ihren bloßen Händen springen.
„Feuer in deiner Richtung, Dodger“, sagt Pwnage, und Samuel begreift, dass es ihn gleich erwischt. Er weicht aus. Der Feuerball landet neben ihm. Seine Lebensenergie ist fast aufgebraucht.
Danke, schreibt Samuel.
Und jubelt, als der Drache landet und Phase drei beginnt. Es sind nur noch ein paar Angreifer von den ursprünglich zwanzig da. Samuel, Axman, der Heiler dieses Angriffs und vier von Pwnages sechs Charakteren. Phase drei haben sie bisher nicht erreicht. So gut sind sie gegen den Drachen noch nicht gewesen.
Phase drei ist ziemlich wie Phase eins, nur dass sich der Drache überall herumbewegt, Magmaadern im Boden öffnet und riesige tödliche Stalaktiten von der Decke reißt. Die meisten Kämpfe mit Elfscape-Bossgegnern enden so. Sie verlangen weniger spezifische Fähigkeiten, sondern geschicktes Multitasking: Kannst du der aus dem Boden spritzenden Lava und den herabfallenden Felsen ausweichen, gleichzeitig auf den Schwanz des Drachen achten, ihm dabei noch durch die Höhle folgen und mit deinem Dolch auf ihn einstechen, und zwar mit der speziellen und sehr komplizierten Zehn-Schritt-Attacke, die den maximalen Schaden pro Sekunde erzielt, um so die Lebensenergie des Drachen auf null zu bringen, bevor sein innerer Zehn-Minuten-Timer losgeht und er zum Berserker wird, der völlig durchdreht und alles im Raum tötet?
Den Kampf selbst findet Samuel für gewöhnlich berauschend, doch direkt danach, selbst wenn sie gesiegt haben, erfüllt ihn ein Gefühl niederschmetternder Enttäuschung, sind doch alle Schätze, die sie gewonnen haben, nichts als falsche Schätze, nichts als digitale Daten, und die erbeuteten Waffen und Rüstungen halten nur für eine Weile. Ist der Drache geschlagen, schicken die Spieleentwickler eine neue Kreatur vor, die noch schwerer zu töten ist und einen noch größeren Schatz bewacht – es ist ein Kreislauf, der sich endlos wiederholt. Wirklich zu gewinnen ist unmöglich, ein Ende ist nicht in Sicht, und manchmal entlarvt sich die Sinnlosigkeit des Spiels mit einem Schlag, so wie jetzt, als Samuel zusieht, wie der Heiler Pwnage am Leben zu halten versucht, die Lebensenergie des Drachen langsam auf null sinkt, Pwnage schreit: „Los, los, los, los!“ und sie am Rand eines epischen Sieges stehen. Selbst jetzt denkt Samuel, dass alles, was wirklich passiert, nichts anderes ist, als dass ein paar einsame Leute im Dunkeln auf ihren Tastaturen herumhacken und elektrische Signale zu einem Computerserver im Umland von Chicago schicken, der ihnen seinerseits mit kleinen Datenstößen antwortet. Alles andere, der Drache und seine Höhle, das aufwallende Magma, die Elfen, ihre Schwerter und ihre Magie, sind nichts als Augenwischerei, eine Fassade.
Was mache ich hier?, fragt er sich, als er vom Drachenschwanz zerschmettert wird und Axman von einem herabstürzenden Stalaktiten gepfählt, als der Heiler in einer Lavaspalte zu Asche verbrennt, Pwnage der einzige verbliebene Elf ist und alle Hoffnung, noch zu gewinnen, allein auf ihrem Anführer ruht. Die Gilde feuert Pwnage durch ihre Mikros an, und die Lebensenergie des Drachen geht herunter auf vier Prozent, auf drei Prozent, zwei Prozent …
Selbst jetzt, so nahe am Sieg, fragt sich Samuel: Was soll das alles?
Was mache ich hier?
Was würde Bethany denken?
„Nathan Hills ›Geister‹ ist ein Meisterwerk, Nathan Hill ein Meister, der das Innerste der Protagonisten nach außen kehrt. Die ungewöhnliche Mischung der Charaktere und der ungewöhnliche Verlauf der Romanhandlung überzeugen.“
„Eine opulente Gesellschaftssatire mit Sogwirkung und viel amerikanischer Geschichte.“
„Eine Geschichte mit Wucht und gutem Plot, einfach ein richtig schöner Schmöker.“
„Nathan Hill ist ein Erzähler, der einen langen Atem hat, ein Gespür für schwingnde Variationen, die in einer dramatischen Pointe enden und ihren Pfeil ins Herz des Lesers schicken.“
„›Geister‹ ist mehr als ein Familienroman. Der Autor zeichnet ein treffendes Bild der amerikanischen Gesellschaft am Beispiel der Metropole Chicago von den Aufständen 1968 bis in die Gegenwart.“
„›Geister‹ beeindruckt sehr. Denn der Unterhaltungsroman findet eine seltene, fast magische Balance.“
„Familienroman der Extraklasse.“
„›Geister‹ ist nicht ein Buch, es sind mehrere ineinanderverschachtelte Bücher. Es ist wie eine Matrjoschka, eine große Puppe, in der sich viele kleine verstecken. Jede hat ihre eigenen Gedanken, ihren eigenen Blick auf die Welt. Diesen Perspektivwechsel bekommt Hill so weich hin, dass man nicht mal bemerkt, wie man gerade aus dem Geist eines elfjährigen Jungen der neunziger Jahre in den einer jungen Frau der Sechziger umgestiegen ist.“
„Das Werk glänzt mit einem beeindruckenden Sprachgefühl und großartig gezeichneten Figuren.“
„Akkurat wie eine Spinne verknüpft Hill die verschiedenen Erzählfäden, wobei sich das perfekte Muster in seiner Gänze erst nach 800 Seiten zu erkennen gibt.“
„Nathan Hill hat einen fesselnden Roman geschrieben, der zudem durch seine sprachliche Ausdruckskraft überzeugt.“
„Lang, fesselnd, intelligent erzählt: ›Geister‹ von Nathan Hill hat alles, was ein perfektes Buchgschenk ausmacht.“
„Ein vergnügliches Leseabenteuer, das Debüt eines großartigen Erzählers.“
„Mit Leichtigkeit gelingt ihm das Schwierigste - dass nämlich der Kern der Handlung, die Suche eines Mannes nach dem ihm entsprechenden Leben, die Leser wirklich berührt.“
„Fast unheimlich ist es, wie er Stimmungen kippen lassen kann. Zwischen Lachen und Betroffenheit liegt dann oft weniger als ein Absatz, was ›Geister‹ nicht nur zu einem überaus abwechslungsreichen, sondern auch geisterhaft schönen Buch macht.“
„Donald Trump ist zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt worden. Und Nathan Hill hat den tragikomischen, ausufernden Roman über eine Gesellschaft geschrieben, die das möglich gemacht hat. Er hat einen tiefen Blick in die Abgründe Amerikas geworfen.“
„Ein lesenswertes, intelligent erzähltes Debüt eines Autors, dessen Namen man sich merken sollte.“
„Spannende Familiengeschichte.“
„Eine Mutter-Sohn-Geschichte, eine College-Satire, ein zeitgeschichtlicher Roman, der von den Studentenrevolten der 60er-Jahre erzählt, und ein bisschen auch eine nordische Spukgeschichte: Dieser Roman ist sehr vieles gleichzeitig. Auf jeden Fall ist er großartig.“





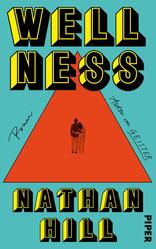











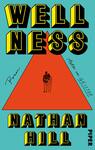
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.