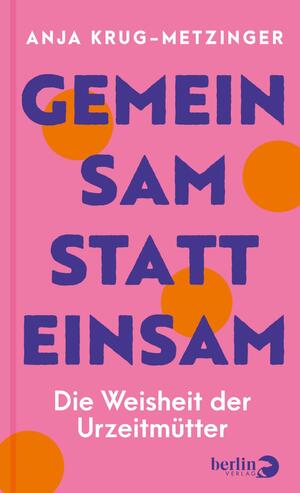
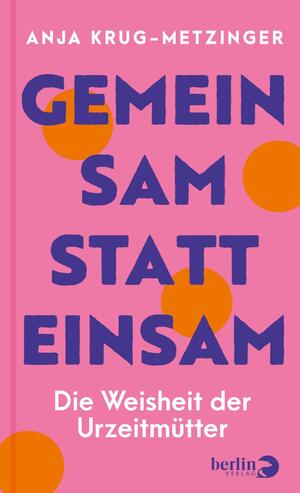
Gemeinsam statt einsam Gemeinsam statt einsam - eBook-Ausgabe
Die Weisheit der Urzeitmütter
Gemeinsam statt einsam — Inhalt
Vom Glück der Gemeinschaft
Warum kämpfen so viele junge Mütter mit der Einsamkeit? Die niedrigen Geburtenraten sprechen eine deutliche Sprache: Etwas stimmt nicht mit der Art, wie unsere Gesellschaft Mutterschaft heute organisiert. Es ist ein kräftezehrender Balanceakt, den moderne Mütter täglich vollbringen müssen. Anja Krug-Metzinger fragt deshalb nach der Urgeschichte. Anhand von wissenschaftlichen Erkenntnissen und im Gespräch mit führenden Expertinnen und Experten aus prähistorischer Archäologie, Anthropologie, Forensik, Biologie und Bindungsforschung geht sie der Evolutionsgeschichte des Mutterseins nach. Wie sich zeigt, haben Menschen ihre Kinder von jeher kooperativ aufgezogen, und das schon seit fast zwei Millionen Jahren.
Ein engagiertes Plädoyer, das Wissen der Vergangenheit zu nutzen und Kindererziehung wieder auf gemeinschaftliche Weise zu gestalten.
Ermutigung für Erziehende, aus den Lehren der Vergangenheit zu profitieren
Eine erkenntnisreiche Reise durch die Geschichte der Mutterschaft – von prähistorischer Zeit bis heute. Anja Krug-Metzinger zeigt anschaulich, wie tief kooperative Kindererziehung in uns verankert ist und warum Alleinerziehung und isolierte Kleinfamilie nicht zum Erfolgsgeheimnis der Menschheit gehören. Konkrete Anregungen inspirieren dazu, die Kraft der Gemeinschaft zu nutzen, um die Herausforderungen der Mutterschaft gemeinsam auf soziale Weise zu meistern. Für alle, die Elternschaft besser verstehen und neu denken wollen.
Enthält Gespräche mit führenden Forschenden unterschiedlicher Disziplinen
„Mütter sind besonders gut, wenn sie auf ein funktionierendes Unterstützungsnetz zurückgreifen können.“ Lieselotte Ahnert, Bindungsforscherin
Leseprobe zu „Gemeinsam statt einsam“
1. Die einsame Mutter – ein modernes Dilemma
Es begann mit einem spätabendlichen Gespräch unter Freundinnen. Draußen peitschte der Oktoberregen gegen die Fenster, während drinnen der Rotwein in unseren Gläsern schimmerte. Meine Freundin Ruth drehte ihr Glas langsam zwischen den Fingern, beobachtete, wie sich das Licht in der dunkelroten Flüssigkeit brach. „Ich wollte keine Kinder“, sagte sie schließlich in die gedankenvolle Stille hinein. »Nicht, weil ich Kinder nicht mag, sondern weil ich gesehen habe, wie es läuft. Meine Mutter, meine Tanten, alle [...]
1. Die einsame Mutter – ein modernes Dilemma
Es begann mit einem spätabendlichen Gespräch unter Freundinnen. Draußen peitschte der Oktoberregen gegen die Fenster, während drinnen der Rotwein in unseren Gläsern schimmerte. Meine Freundin Ruth drehte ihr Glas langsam zwischen den Fingern, beobachtete, wie sich das Licht in der dunkelroten Flüssigkeit brach. „Ich wollte keine Kinder“, sagte sie schließlich in die gedankenvolle Stille hinein. „Nicht, weil ich Kinder nicht mag, sondern weil ich gesehen habe, wie es läuft. Meine Mutter, meine Tanten, alle Frauen in meiner Familie – am Ende standen sie immer allein da. Die Männer kamen und gingen, aber die Verantwortung blieb am Ende immer bei den Müttern.“
Ruths Worte trafen einen Nerv bei mir. Auch ich hatte mich gegen Kinder entschieden – aus Gründen, die ich selbst noch nicht vollständig verstanden hatte. War es wirklich eine bewusste Entscheidung gewesen? Oder hatte ich nur zu lange gezögert, während das Leben seine eigenen Weichen stellte? Als Journalistin interessierte mich besonders die Frage, ob sich in Ruths und meinen so unterschiedlichen Wegen dieselben gesellschaftlichen Muster spiegelten.
Die folgenden Beobachtungen und Erkenntnisse basieren auf einer mehrmonatigen Recherche. Für diese Untersuchung führte ich Gespräche mit Müttern aus verschiedenen sozialen Schichten, Altersgruppen und Familienkonstellationen – sowohl in Großstädten als auch ländlichen Regionen. Ergänzend wertete ich Einträge in Mütter-Foren und sozialen Medien aus und führte Gespräche mit medizinischen und psychologischen Fachkräften. Die Namen wurden auf Wunsch der Befragten geändert. Die hier präsentierten Erkenntnisse erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern spiegeln die subjektiven Erfahrungen und Beobachtungen der beteiligten Personen sowie meine eigenen wider.
Der eigentliche Anstoß zu dieser Recherche kam aus einer unerwarteten, ganz anderen Richtung. Ein Instagram-Post erregte meine Aufmerksamkeit: Eine makellos gestylte Mutter präsentierte ihr durchorganisiertes Leben – Designer-Babyzimmer in sanften Pastelltönen, selbst gebackene Biomuffins, kunstvoll auf Vintage-Porzellan drapiert, eine scheinbar fehlerfreie Work-Life-Balance, dokumentiert in perfekt kadrierten Bildern. Das Licht immer golden, die Stimmung stets harmonisch, jedes Detail sorgfältig kuratiert.
Was mich stutzig machte, war nicht die offensichtliche Inszenierung. Als Frau, die ihre Entscheidung gegen Kinder in den vordigitalen 1990er-Jahren getroffen hatte, beobachtete ich diese neue Realität mit einer Mischung aus journalistischer Neugier und nachdenklicher Distanz. Der Kontrast zwischen der damaligen und der heutigen Zeit könnte kaum größer sein – und doch scheinen die grundlegenden Fragen dieselben geblieben zu sein. Es war besonders die Kommentarspalte darunter, die meine Aufmerksamkeit fesselte. Zwischen den begeisterten Emojis und bewundernden Ausrufen fand ich immer wieder die gleiche Frage – in verschiedenen Variationen, aber mit derselben unterschwelligen Verzweiflung: „Wie machst du das nur allein?“
Während ich durch weitere Profile scrollte, ließ mich die Frage nicht mehr los. Natürlich gab es auch andere Bilder – Schnappschüsse von Müttern, die inmitten des Chaos strahlten, Posts über die kleinen Wunder des Alltags mit Kindern. Sie zeigten, dass Mutterschaft neben allen Herausforderungen auch eine Quelle tiefer Freude und Erfüllung sein kann. Doch selbst hinter diesen positiven Momentaufnahmen schien die Frage zu lauern, wie viel leichter alles wäre, wenn Mütter die Last nicht überwiegend allein tragen müssten.
Natürlich gibt es viele Männer, die sich sehr in der Kindererziehung engagieren und aktiv Verantwortung übernehmen. Ebenso gibt es Unternehmen, die Eltern durch großzügige Elternzeitregelungen und flexible Arbeitszeiten unterstützen und so dazu beitragen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern. Auch regionale Unterschiede spielen eine Rolle – in ländlichen Gegenden mögen die Strukturen oft anders sein als in der anonymen Großstadt. Meine Beobachtungen sind Ausschnitte einer vielschichtigen Realität, die von vielen Faktoren beeinflusst wird.
Die Stadt schläft nie
Was zunächst als routinemäßige Recherche begann, führte mich bald auch in die Nächte der Großstadt. Die wahren Geschichten der heutigen Mutterschaft, so lernte ich schnell, spielen sich nach Einbruch der Dunkelheit ab. Wenn die perfekten Instagram-Filter verblassen und die Fassaden bröckeln, wenn die sorgsam konstruierten Bilder des Tages wie Kartenhäuser in sich zusammenfallen.
In den erleuchteten Fenstern der Hochhäuser entstehen in meiner Vorstellung Bilder moderner Mutterschaft: Ich stelle mir vor, wie eine Frau zwischen Laptop und Babybett pendelt, wie eine andere rastlos durch ihr Smartphone scrollt. Diese nächtlichen Eindrücke, die sich aus den Lichtpunkten in der Dunkelheit und den Erzählungen meiner Interviewpartnerinnen zusammensetzen, sind mehr als reine Imagination – sie werden zu Symbolen für die systematische Überforderung einer ganzen Generation von Müttern.
Ein besonders aktives Fenster im zweiten Stock zieht meine Aufmerksamkeit auf sich. Im bläulichen Licht eines Bildschirms erkenne ich eine sich bewegende Silhouette – vermutlich eine Person, die im Raum umhergeht. Von meiner Position auf der Straße kann ich nur Umrisse wahrnehmen, doch die nächtliche Szene erinnert mich an die Schilderungen vieler Mütter in meinen Interviews: der Versuch, die Stille der Nacht produktiv zu nutzen, das ständige Hin und Her zwischen Arbeit und Fürsorge.
Meine eigene Entscheidung gegen Kinder in den 1990er-Jahren folgte zunächst dem Ruf nach Unabhängigkeit und beruflicher Entwicklung. Doch heute, im Rückblick, erkenne ich darin auch eine frühe Reaktion auf ein System, das ich damals nur unterschwellig als problematisch empfand. Obwohl ich, anders als Ruth, gute äußere Voraussetzungen hatte – eine stabile Partnerschaft, ein stabiles Umfeld, finanzielle Sicherheit –, spürte ich schon damals eine diffuse Skepsis. Es war, als hätte ein Teil von mir bereits geahnt, dass das Versprechen der Vereinbarkeit auf einem gesellschaftlichen Modell basiert, das im Widerspruch zu unserem tief verwurzelten Bedürfnis nach gemeinschaftlicher Fürsorge steht.
Die digitale Dämmerung
Wenn die Stadt zur Ruhe kommt, erwacht in den sozialen Medien ein verborgenes Netzwerk schlafloser Mütter. Marina, die ich am Nachmittag in ihrer sorgfältig eingerichteten Wohnung im achten Stock getroffen habe, zeigte mir ihre verschiedenen Social-Media-Profile. „Hier, mein öffentlicher Account“, sagte sie und scrollte durch eine endlose Reihe makelloser Momente. Designer-Babykleidung, selbst gebackene Vollkornmuffins, lächelnde Mutter-Kind-Selfies.
Dann öffnete sie eine andere App, eine geschlossene Gruppe. Hier fallen die Masken: Frauen teilen ihre Erschöpfung, ihre Ängste, ihre Einsamkeit. Sie halten zusammen, stützen sich gegenseitig, teilen Tipps und Trost in den dunklen Stunden. Innerhalb von Minuten entwickelt sich ein digitaler Unterschlupf für Schlaflose.
Bei meinen Recherchen fand ich typische Aussagen wie diese: „Manchmal frage ich mich, ob das normal ist, wie wir heute leben“, schreibt eine Mutter um 2.15 Uhr. „Jede allein in ihrer Wohnung, nur das Smartphone als Verbindung zur Außenwelt, während die Babys schlafen. Irgendwie fühlt sich das nicht richtig an.“
„Wenn ich meine Oma besuche, erzählt sie oft von früher“, antwortet eine andere. „Da war das Leben zwar sehr einfach, aber niemand war allein. Die Nachbarinnen schauten einfach vorbei, die Schwestern wohnten nebenan, die eigene Mutter war immer in der Nähe.“
Die anonymen Geständnisse haben ihre eigene Geografie: Mütter-Gruppen für jede Zeitzone, sodass immer jemand wach ist. WhatsApp-Gruppen und andere digitale Treffpunkte, die sich nach den Schlafphasen der Kinder organisieren – für jede noch so einsame Nachtstunde findet sich irgendwo eine andere wache Mutter.
„Nachts scrolle ich manchmal durch meine Instagram-Fotos vom Tag“, erzählt eine Mutter. „Die glückliche Mama beim Breifüttern, beim Spaziergang, beim Vorlesen. Alles so schön. Dabei war ich den ganzen Tag kurz vorm Heulen. Aber so was zeigt man ja nicht.“
In dieser digitalen Dämmerungszone entsteht eine parallele Realität, die sich fundamental von der Tageswelt unterscheidet. Dieselben Frauen, die tagsüber makellose Instagram-Storys von selbst gebackenen Vollkornmuffins und perfekt organisierten Kinderzimmern posten, enthüllen nachts ihre ungefilterte Wahrheit. Es ist, als schaffte die Dunkelheit einen geschützten Raum, in dem die mühsam aufrechterhaltenen Fassaden bröckeln dürfen. Eine Mutter beschreibt es in einem 3-Uhr-Post so: „Manchmal scrolle ich nachts durch meine eigenen Social-Media-Profile und frage mich, wer diese perfekte Frau ist, die ich da tagsüber spiele. Dabei sitze ich hier im zerknitterten Pyjama, habe seit drei Tagen nicht geduscht und weine heimlich über Fotos von Müttern, bei denen wohl alles besser klappt als bei mir.“
Es ist, als ob die Dunkelheit einen Raum eröffnete, in dem die ungeschriebenen Gesetze der digitalen Selbstdarstellung für einen Moment außer Kraft gesetzt sind. Die digitale Vernetzung in den nächtlichen Stunden mag ein moderner Ersatz für etwas sein, das Menschen früher ganz selbstverständlich hatten: direkte, persönliche Unterstützung in Zeiten der Not. Während heute Mütter einzeln vor ihren Bildschirmen sitzen, gab es in traditionellen Gemeinschaften zumindest die Möglichkeit, sich auch nachts real zu begegnen.
Es ist eine bittere Ironie, dass ausgerechnet in einer Zeit, in der Mütter dank digitaler Technologien scheinbar ständig vernetzt sind, viele von ihnen sich einsamer fühlen denn je. Die nächtliche Selbstreflexion vor dem Bildschirm mag oberflächlich an die traditionellen Praktiken der Kommunikation erinnern – doch ohne die tröstende Gegenwart realer Vertrauter droht sie zu einem einsamen Echo in der digitalen Leere zu werden.
Das kollektive Schweigen
Um zwei Uhr morgens erreicht die psychische Belastung scheinbar einen Höhepunkt. Die nächtlichen Online-Foren füllen sich mit Geständnissen, die im Tageslicht undenkbar wären. „Ich fühle mich manchmal so verloren“, schreibt eine Nutzerin. „Als ob alle anderen wüssten, wie man Mutter ist, nur ich nicht!“
Die nächtlichen Foren sind voll von To-do-Listen, die die versteckte Last des Alltags enthüllen. Eine Mutter listet auf, was sie alles „nebenbei“ im Kopf behalten muss: die Entwicklungsphasen aller Kinder, medizinische Historien, Kleidergrößen, Essensvorlieben, Allergien, soziale Dynamiken in Kita und Schule, Termine, Hausaufgaben, emotionale Befindlichkeiten – und natürlich ihren eigenen Job.
Der sogenannte Gender Care Gap zeigt das Ausmaß dieser ungleichen Verteilung: Erwerbstätige Frauen stemmen nach wie vor den Löwinnenanteil an Kinderbetreuung, Pflege und Hausarbeit: „Das heißt, dass Frauen mit 4,13 Stunden 52,4 Prozent mehr Zeit für unbezahlte Sorgearbeit aufbringen als Männer mit 2,46 Stunden. Dies sind 87 Minuten täglich, die Frauen mehr für unbezahlte Sorgearbeit aufbringen. (…) Mütter verrichten in dieser Konstellation täglich zweieinhalb Stunden mehr Sorgearbeit als Väter, sodass der Gender Care Gap 83,3 Prozent beträgt.“[i]
„Das Schlimmste ist, dass du nie wirklich abschalten kannst“, kommentiert eine andere. „Selbst wenn dir jemand hilft – du musst trotzdem alles im Kopf behalten, planen und koordinieren. Die Verantwortung wirst du nie los.“
Die psychologische Dimension der modernen Mutterschaftskrise zeigt sich besonders in den Übergangsmomenten zwischen Tag und Nacht. Wenn die perfekten Fassaden bröckeln, wenn die mühsam aufrechterhaltene Kontrolle zusammenbricht. Es sind Momente einer verstörenden Ehrlichkeit, die Fragen aufwerfen über die psychischen Kosten unserer Art, Mutterschaft zu organisieren.
In traditionellen Gesellschaften war das Wissen um Kinderbetreuung auf viele Schultern verteilt. Es gab ein Netzwerk von Erfahrungen und Kompetenzen – Großmütter, Tanten, ältere Geschwister, die gesamte Gemeinschaft trug zum Aufwachsen der Kinder bei. Keine einzelne Person musste den Überblick über alles behalten.
Diese Geständnisse enthüllen auch eine erschreckende Paradoxie: Je mehr wir über Mutterschaft zu wissen glauben, desto unsicherer scheinen sich Mütter in ihrer Rolle zu fühlen. Die Flut an Expertenwissen, Apps und Optimierungsstrategien hat die intuitive Sicherheit nicht gestärkt, sondern untergraben.
Die neue Armutsfalle
Die finanziellen Sorgen zeigen sich besonders in den nächtlichen Online-Foren. Doch während diese digitalen Räume zumindest eine Form des Austauschs und der gegenseitigen Unterstützung ermöglichen, bleiben sie vielen Familien verwehrt. Die beschriebenen Erfahrungen spiegeln also nur einen privilegierteren Ausschnitt der gesellschaftlichen Realität wider. Viele Familien haben aufgrund ihrer sozioökonomischen Situation nicht einmal Zugang zu den diskutierten digitalen Vernetzungsmöglichkeiten – kein Smartphone, keinen Internetanschluss, keine Möglichkeit zur virtuellen Vernetzung. Ihre Situation stellt sich oft noch drastischer dar, da ihnen selbst diese letzte Form des sozialen Austauschs verwehrt bleibt.
Diejenigen, die Zugang zu digitalen Räumen haben, nutzen sie vor allem in den dunklen Stunden, wenn die Sorgen übermächtig werden. In der Anonymität der Nacht wird die wahre Dimension der finanziellen Belastungen sichtbar. Um drei Uhr morgens häufen sich die Posts über Existenzängste: Berechnungen der Kitakosten, Klagen über schlecht entlohnte Teilzeitarbeit, verzweifelte Fragen nach günstigeren Wohnungen. Was tagsüber hinter tapferem Lächeln versteckt wird, kommt nachts zum Vorschein.
„Teilzeit ist eine Falle“, schreibt eine Controllerin um 3.45 Uhr. „Du arbeitest faktisch Vollzeit, bekommst aber nur 60 Prozent bezahlt. Die restlichen Stunden machst du nachts – unbezahlt, unsichtbar.“ Die Resonanz ist überwältigend. Dutzende Frauen teilen ähnliche Erfahrungen, rechnen vor, wie ihre „Teilzeit“-Wirklichkeit aussieht.
In einem Café war ich an einem Nachmittag zufällig Zeugin eines bezeichnenden Gesprächs. Zwei Freundinnen, beide schwanger, kalkulierten ihre finanzielle Zukunft. „Die Kita kostet fast mein halbes Gehalt“, sagte die eine. „Aber ohne Kita kann ich nicht arbeiten. Und ohne Arbeit kann ich mir die Kita nicht leisten.“ Die andere nickte: „Ein Teufelskreis. Und an Altersvorsorge ist gar nicht zu denken.“
Auch die nächtlichen Online-Diskussionen enthüllen in manchen Fällen die versteckten Kosten der Mutterschaft. Eine Frau listet auf: Kinderbetreuung, größere Wohnung, gesünderes Essen, Versicherungen. „Niemand spricht darüber, wie schnell du in die roten Zahlen rutschst“, kommentiert sie. „Besonders als Alleinerziehende.“
In der ersten U-Bahn um 4.30 Uhr kann man sie oft sehen, die Gesichter der finanziellen Erschöpfung. Frauen, die zu Billiglohnjobs aufbrechen, während ihre Kinder noch schlafen; die sich keine Tagesmutter leisten können und deshalb von Nachtschichten zurückkehren; die zwischen drei Teilzeitjobs pendeln, um irgendwie über die Runden zu kommen.
Wie eine detaillierte Studie der Bertelsmann Stiftung vom Juni 2024 zeigt, ist die Situation besonders dramatisch für Familien von Alleinerziehenden: Vier von zehn sind armutsgefährdet. Knapp die Hälfte aller Kinder, die in Familien mit Bürgergeldbezug aufwachsen, leben mit nur einem Elternteil zusammen. Besonders bemerkenswert: Diese prekäre Situation besteht, obwohl die meisten Alleinerziehenden erwerbstätig sind. Dabei zeigen sich deutliche regionale Unterschiede: In Westdeutschland sind Alleinerziehende seit 2020 häufiger von Sozialleistungen abhängig als in den ostdeutschen Ländern – mit Bremen als Spitzenreiter (55 Prozent) und Thüringen am unteren Ende der Skala (27 Prozent). Besonders alleinerziehende Mütter tragen dabei eine doppelte Last: Sie sind nicht nur überdurchschnittlich von Armut bedroht, sondern schultern auch den Großteil der Kinderbetreuung und -erziehung.[ii]
Während diese Frauen zur Arbeit fahren, beginnt in anderen Teilen der Stadt eine andere Art von Schichtwechsel. In den Apartments der Banker und Manager arbeiten oft Kindermädchen aus Osteuropa oder Asien. Sie betreuen hier fremde Kinder, während ihre eigenen in der Heimat von Großmüttern versorgt werden – eine Art globale Umverteilung von Mutterschaft, die historisch neue Fragen aufwirft.
Die sozialen Unterschiede zeigen sich besonders in den Bewältigungsstrategien. Während gut verdienende Mütter ihre Erschöpfung mit Yoga-Kursen und Coaching-Sessions bekämpfen, greifen andere zu drastischeren Lösungen. „Manchmal nehme ich eine Nachtschicht extra“, erzählt Sophie, die in einem Krankenhaus putzt. „Nicht wegen des Geldes – nur um ein paar Stunden Ruhe zu haben. Meine Schwester passt dann auf die Kinder auf.“
Die Online-Foren spiegeln diese Spaltung. In manchen Gruppen geht es um die Auswahl der besten Waldorf-Kita, in anderen um Tricks, wie man mit Überstunden die Kinderbetreuung finanziert. Die Einsamkeit der Nacht kennt keine Klassengrenzen, aber die Möglichkeiten, mit dieser nächtlichen Isolation umzugehen, sind höchst ungleich verteilt.
Die finanzielle Unsicherheit in der Gegenwart setzt sich dabei oft bis ins Alter fort: Die Altersrente von Frauen ist im Westen im Durchschnitt knapp 38 Prozent niedriger als bei Männern, im Osten 14 Prozent. Ein wesentlicher Grund dafür sind die geringeren Löhne und kürzeren Beitragszeiten, häufig aufgrund der Erziehung von Kindern. Zwar schafft die Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten in der gesetzlichen Rente einen gewissen sozialen Ausgleich – ohne diesen wäre der Unterschied noch drastischer. Doch das grundlegende Problem der finanziellen Benachteiligung bleibt bestehen, wie aktuelle Zahlen der Deutschen Rentenversicherung Bund von 2025 belegen.[iii]
Unsere evolutionären Wurzeln
Die evolutionäre Anthropologin Sarah Blaffer Hrdy liefert in ihrem Buch Mütter und Andere eine überraschende Perspektive auf das Dilemma der einsamen Mütter. Bei den Aka-Jägern und -Sammlern in Zentralafrika bleiben Väter mehr als 50 Prozent eines 24-Stunden-Tages in Reichweite ihrer Säuglinge und verbringen erstaunliche 22 Prozent ihrer Zeit damit, ihre Babys zu halten und zu umarmen.[iv] Der Kontrast zu westlichen Gesellschaften ist frappierend: Laut einer aktuellen Veröffentlichung des Momentum-Instituts von 2025 sind es fast ausschließlich die Mütter, die die nächtliche Fürsorge übernehmen. Bei Säuglingen unter einem Jahr kümmern sich in 87 Prozent der Fälle die Mütter vor dem Schlafengehen um die Kinder, und in 71 Prozent der Fälle sind sie es auch, die nachts aufstehen.[v]
Wie grundlegend die gemeinschaftliche Fürsorge in unserer Evolutionsgeschichte verankert ist und welche überraschenden Erkenntnisse die moderne Forschung dazu liefert, wird in Kapitel 2 dieses Buches ausführlich beleuchtet. Dort zeigt sich auch, dass die scheinbar naturgegebene Arbeitsteilung in der Kindererziehung eine sehr junge Entwicklung ist. Die Erkenntnisse von Sarah Blaffer Hrdy werfen ein interessantes Licht auf die gesellschaftliche Entwicklung seit den 1990er-Jahren. Während wir damals vom Ideal der perfekt organisierten Einzelkämpferin träumten und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf als rein organisatorische Herausforderung sahen, zeigt die Forschung heute, wie grundlegend unser Bedürfnis nach gemeinschaftlicher Fürsorge eigentlich ist. Diese wissenschaftliche Erkenntnis gibt auch meiner damaligen Skepsis nachträglich eine neue Dimension.
In traditionellen Gesellschaften leisten neben den Müttern auch andere Gemeinschaftsmitglieder, die sogenannten Allo-Eltern, einen wichtigen Beitrag zur Kinderbetreuung. Die Isolation moderner Mütter steht also im dramatischen Widerspruch zu dieser evolutionären Prägung.
Diese Erkenntnisse werden durch eine Vielzahl von Studien gestützt: Forschungen aus verschiedenen Disziplinen zeigen, dass Kinder, die neben der Beziehung zur Mutter auch stabile Beziehungen zu anderen unterstützenden Erwachsenen haben, langfristig eine bessere psychosoziale Anpassung und weniger Verhaltensprobleme aufweisen. Kulturübergreifende Untersuchungen belegen, dass in traditionellen Gesellschaften die Kinderbetreuung als gemeinschaftliche Aufgabe verstanden wird – ein deutlicher Kontrast zu unserer individualisierten Gesellschaft.
Die Evolution hat uns nicht nur mit physischen, sondern auch mit psychischen Bedürfnissen ausgestattet. Die erzwungene Isolation moderner Mutterschaft kollidiert mit diesen tief verwurzelten emotionalen Mustern. Die Forschung legt nahe, dass diese Diskrepanz zwischen evolutionär entwickelten Bedürfnissen und moderner Lebenswelt eine wichtige Quelle psychischer Belastung für Mütter sein könnte.
(Was wir als „moderne“ Probleme wahrnehmen, ist oft stark von unserem westlich geprägten Blickwinkel bestimmt. Natürlich gibt es auch heute noch in verschiedenen Kulturen und Gesellschaften weltweit sehr unterschiedliche Modelle des Zusammenlebens und der Kinderbetreuung.)
Wege aus der Isolation
Um 6.30 Uhr, während die ersten Lichter des Oktobertags die Dunkelheit vertreiben, beginnt die große Verwandlung. Die nächtlichen Leuchtzeichen der Einsamkeit erlöschen eines nach dem anderen. In den Fenstern gehen Badezimmer- und Küchenlichter an. Die perfekten Fassaden werden wieder aufgebaut, die Masken des Tages aufgesetzt.
In der Morgendämmerung gegen sieben bringen die U-Bahnen ihre müden Passagiere durch die erwachende Stadt. Unter ihnen viele erschöpfte Mütter, die den Tag schon vor Sonnenaufgang beginnen müssen. Studien legen nahe, dass chronischer Stress und soziale Isolation erhebliche Auswirkungen auf die psychische und körperliche Gesundheit von Müttern haben können – ein deutlicher Kontrast zu Gesellschaften mit funktionierenden Unterstützungsnetzwerken.
Während ich diese nächtlichen Szenen beobachte, wird mir bewusst: Die digitale Welt, die ich zunächst nur als Teil des Problems wahrnahm, birgt möglicherweise auch Lösungsansätze. Anders als in den 1990er-Jahren, als Vereinzelung noch bedeutete, wirklich allein zu sein, bietet die digitale Vernetzung heute durchaus Chancen zur Veränderung. Immer mehr Mütter nutzen Plattformen wie „MeetUp“ oder Nachbarschafts-Apps, um sich lokal zu vernetzen und reale Unterstützungsgruppen zu bilden. „Ohne die App hätte ich nie die anderen Mütter in meiner Straße kennengelernt“, erzählt Lisa, die über eine digitale Plattform eine Krabbelgruppe initiiert hat. Was in der nächtlichen Einsamkeit als digitaler Kontakt beginnt, kann sich zu echten Gemeinschaften entwickeln.
Die erwachende Stadt bietet ein paradoxes Schauspiel – eines, das sich seit den 1990er-Jahren noch verschärft hat. Während damals die Vereinzelung der Mütter noch als vorübergehendes Problem galt, das sich mit besserer Organisation lösen ließe, zeigt sich die systemische Dimension heute immer deutlicher. Die moderne Stadt mit ihrer Architektur der Isolation, ihren starren Arbeitszeiten und ihrer Fixierung auf die Kernfamilie steht im Widerspruch zu Sarah Blaffer Hrdys Erkenntnis: Menschen sind evolutionär darauf ausgerichtet, ihre Kinder gemeinschaftlich aufzuziehen – eine jahrtausendealte Weisheit, die unsere Vorfahren intuitiv verstanden. Wir haben die Weisheit der Urzeitmütter verloren.
Doch vielleicht liegt gerade in dieser Erkenntnis auch eine Hoffnung. Wenn wir verstehen, dass unsere gegenwärtige Organisation von Mutterschaft nicht „natürlich“, sondern ein relativ junges und problematisches Konstrukt ist, öffnet das den Weg für Veränderung.
Die Frage ist, wie wir den Weg zurück zu unseren kooperativen Wurzeln finden können und vorwärts zu neuen Formen gemeinschaftlicher Fürsorge. Wir brauchen neue Modelle des Zusammenlebens und -arbeitens, neue soziale Architekturen der Unterstützung und Solidarität. Wir brauchen eine Politik, die die Familien in all der Vielfalt ihrer Formen ernst nimmt und fördert. Wir brauchen eine Wirtschaft, die freiwillig den Wert der Fürsorge anerkennt und honoriert. Vor allem aber brauchen wir eine neue Vision des guten Lebens – eine Vision, die mehr auf Kooperation und Verbundenheit statt auf Konkurrenz und Isolation setzt.
Die leuchtenden Fenster der nächtlichen Stadt werden zu einem vielschichtigen Text, den wir erst lernen müssen zu lesen. Jedes erleuchtete Rechteck erzählt seine eigene Geschichte: Hier kämpft eine Mutter mit der Einsamkeit der späten Stunden, dort versucht ein Vater, durch Überstunden die finanzielle Sicherheit seiner Familie zu gewährleisten, in einem anderen Fenster sucht eine Großmutter in sozialen Medien nach später Verbindung. Diese nächtliche Choreografie der Lichter ist mehr als ein urbanes Schauspiel – sie ist eine dringende Einladung, unsere Vision des Zusammenlebens neu zu denken. Als ich meine eigenen Entscheidungen reflektiere, frage ich mich: Hätte der Ruf nach Familie in einer Welt des cooperative breeding eine andere Resonanz in mir gefunden?
Die Forschungserkenntnisse, die in Kapitel 2 näher beleuchtet werden, zeigen die zentrale Bedeutung sozialer Unterstützungssysteme in der menschlichen Evolution: Während Gesellschaften mit starken kooperativen Strukturen nachweislich bessere Überlebenschancen für Mütter und Kinder boten, führte deren Zusammenbruch – etwa in Krisenzeiten oder bei erzwungener Isolation – oft zu dramatischen Konsequenzen. Dies macht deutlich, wie fundamental wichtig verlässliche soziale Netzwerke für das Wohlergehen von Mutter und Kind schon immer waren – eine Erkenntnis, die angesichts der zunehmenden Vereinzelung in unserer modernen Gesellschaft besondere Relevanz gewinnt.
Als das frühe Oktoberlicht die ersten goldenen Streifen an den Horizont malt, denke ich an Ruths Worte zurück: „Die Männer kamen und gingen, aber die Verantwortung blieb bei den Müttern.“ Was als persönliche Beobachtung begann, hat sich als Symptom eines fundamentalen Missstands entpuppt – eines strukturellen Problems in der Art, wie unsere Gesellschaft Mutterschaft organisiert. Deshalb hat Ruth heute keine Kinder.
Die klare Oktobersonne taucht jetzt, kurz nach sieben, die Hochhausfassaden in goldenes Licht. Anders als bei Ruth war es bei mir wie gesagt nicht fehlende Unterstützung. Und doch: Meine Zweifel aus den 1990er-Jahren haben sich als berechtigt erwiesen. Die strukturellen Probleme, die ich damals erahnte, sind heute deutlicher denn je. Die Frage nach den Bedingungen, unter denen Frauen Mutter werden oder nicht, entscheidet mit darüber, in was für einer Gesellschaft wir künftige Generationen aufwachsen sehen wollen. Unsere unterschiedlichen Entscheidungen gegen Kinder – Ruths und meine, mit zwanzig Jahren Abstand – sind dabei mehr als persönliche Entscheidungen. Sie zeigen, wie hartnäckig sich ein System hält, das im Widerspruch zu unserem tief verwurzelten Bedürfnis nach gemeinschaftlicher Fürsorge steht – damals wie heute.
Die Einsamkeit der modernen Mutterschaft manifestiert sich nicht nur in den Gefühlen der Betroffenen – sie ist in die Strukturen unserer Städte eingeschrieben. Während ich durch die nächtlichen Straßen gehe, enthüllt sich vor mir eine verborgene Grammatik der Isolation. Wobei betont werden muss, dass diese Herausforderungen nicht exklusiv Mütter betreffen. In einer Zeit zunehmend diverser Familienmodelle – von gleichgeschlechtlichen Paaren bis hin zu aktiv involvierten Vätern in klassischen Konstellationen – zeigt sich, dass die beschriebenen Strukturprobleme auf alle Elternteile zukommen, die Hauptverantwortung für die Kinderbetreuung übernehmen.
Architektur der Einsamkeit
In der modernen Stadt wird diese Grammatik der Einsamkeit greifbar – fest verankert in ihrer baulichen Gestalt: vertikal gestapelte Wohneinheiten, durch Betondecken hermetisch voneinander getrennt. Die schmalen Flure, oft ohne Tageslicht, sind als reine Transiträume konzipiert – zu eng für zufällige Begegnungen, zu funktional für spontane Gespräche.
Die Stadt sollte eigentlich das Versprechen der Moderne verkörpern – ein Ort der Begegnung, der Effizienz und des gemeinsamen Fortschritts. Die Architekten und Stadtplaner der Moderne träumten von lichtdurchfluteten Wohntürmen, von effizienten Verkehrswegen, von rationaler Ordnung. In den Archiven finden sich ihre grandiosen Entwürfe: Perspektivzeichnungen von strahlenden Hochhäusern, die wie Leuchttürme der Zukunft in den Himmel ragen. Doch was als utopische Vision begann, verkehrte sich in ihr Gegenteil. Die vertikalen Städte wurden zu einem gigantischen sozialen Experiment, dessen unbeabsichtigte Folgen wir erst heute vollständig zu begreifen beginnen. Die evolutionäre Prägung des Menschen als soziales Wesen prallt hier auf eine Architektur, die Begegnung systematisch erschwert.
Der Fahrstuhl wird zum perfekten Symbol dieser modernen Entfremdung. Nirgendwo sonst wird die Paradoxie urbaner Nähe so greifbar wie in dieser beweglichen Metallbox. Nirgendwo sonst kommen sich Menschen in der Stadt körperlich so nah, dass sie den Atem des anderen spüren können – und gerade diese erzwungene Intimität macht echte Begegnungen unmöglich. Die durchschnittliche Fahrt dauert 7,96 Sekunden – eine Zeitspanne, die sich wie eine Ewigkeit anfühlen kann. Lang genug, um die Künstlichkeit der Situation zu spüren, zu kurz, um sie durch Kommunikation zu überbrücken. Die digitalen Displays mit Börsenkursen und Wettervorhersagen sind dabei mehr als bloße Information – sie sind Fluchtwege aus einer unerträglichen sozialen Nähe.
Selbst die Balkone, eigentlich Schnittstellen zwischen privatem und öffentlichem Raum, werden zu Aussichtstürmen der Einsamkeit. Statt verbindender Elemente sind sie oft durch massive Sichtschutzwände voneinander separiert. Die vertikale Ausrichtung macht nachbarschaftlichen Austausch nahezu unmöglich – man müsste sich schon wie Romeo und Julia aus dem Fenster lehnen, um ein Gespräch zu führen.
Die Kinderspielplätze zwischen den Hochhäusern liegen oft im Schatten der Gebäude, umgeben von parkenden Autos. Häufig sind sie mehr Alibi als Begegnungsort – zu klein für echtes Spiel, zu exponiert für entspannte Elterngespräche. Mütter mit Kleinkindern ziehen sich lieber in ihre Wohnungen zurück, wo die Kinder „sicher“ sind – ein weiterer Schritt in die soziale Isolation.
Die Grundrisse moderner Wohnungen spiegeln diese Isolation perfekt wider. Die klassische „Familieneinheit“ ist als autarke Zelle konzipiert – mit eigener Waschmaschine, eigenem Bad, eigener Miniküche. Die wenigen verbliebenen Gemeinschaftsräume wurden in individuelle Funktionsbereiche aufgeteilt, während die Akustik eine zusätzliche Dimension der Trennung schafft: Moderne Isoliermaterialien erzeugen eine künstliche Stille. Kein Kindergeschrei dringt mehr durch die Wände, keine Klavierübungen, keine Alltagsgeräusche. Diese akustische Isolation vermittelt zwar Privatsphäre, verhindert aber auch das unbewusste „Miterleben“ der Nachbarn, das ein natürliches Gefühl von Gemeinschaft erst ermöglicht.
Selbst die Haustüren erzählen von dieser Entwicklung. Statt der klassischen Glaselemente, die einen flüchtigen Blick ins Treppenhaus erlaubten und spontane Begegnungen ermöglichten, dominieren heute Sicherheitstüren aus Stahl. Die „Türspione“ – kleine Linsen, durch die man ungesehen nach draußen spähen kann – sind bezeichnend für das grundlegende Misstrauen gegenüber den Mitmenschen.
Diese Architektur macht besonders Müttern mit kleinen Kindern das Leben schwer. Der Weg vom 15. Stock zum Spielplatz wird zur logistischen Herausforderung. Spontane Besuche bei Nachbarn sind durch Gegensprechanlagen und Sicherheitssysteme erschwert. Der informelle Austausch, der früher im Hauseingang oder auf gemeinsamen Balkonen stattfand, muss heute aktiv organisiert werden.
Die smarte Technik perfektioniert diese Isolation in ihrer freundlichsten Form: Die Heizung gehorcht der App, Einkäufe erscheinen wie von Geisterhand in Paketboxen, das Haus wird zur sich selbst genügenden Insel. Was als Komfort gedacht war, vollendet sich in den Sicherheitssystemen moderner Wohnkomplexe: Zugangskontrolle, Überwachungskameras und elektronische Schlüssel verwandeln Nachbarschaften in freundliche Festungen – Hightech-Versionen jener Burgmauern, mit denen Menschen sich seit jeher vor der Welt da draußen zu schützen versuchten. Die vermeintliche Sicherheit wird zum goldenen Käfig, in dem in jeder Wohnung eine eigene, wohltemperierte Einsamkeit kultiviert wird.
Die Grenzen der modernen Stadtarchitektur zeigen sich besonders deutlich bei der Kinderbetreuung in Hochhäusern. Eine Mutter im zwölften Stock kann ihr spielendes Kind im Hof nicht mal eben durchs Fenster im Auge behalten. Der spontane Austausch zwischen Müttern, der früher über Gartenzäune oder von Veranda zu Veranda stattfand, ist in der Vertikalen unmöglich geworden. Die natürliche soziale Kontrolle, die in horizontalen Nachbarschaften für Sicherheit sorgte, funktioniert in Hochhäusern nicht.
In den Randbezirken der Stadt entstehen jedoch vereinzelt architektonische Gegenentwürfe, die zeigen, dass es auch anders gehen kann: Wohnprojekte, in denen großzügige Laubengänge zu lebendigen Begegnungszonen werden, wo Kinder zwischen den Stockwerken spielen können. Gemeinschaftsterrassen und flexible Grundrisse schaffen neue Räume für spontanen Austausch. Die Bewohner entwickeln eigene Rituale des Zusammenlebens – von gemeinsamen Mahlzeiten auf den Dachgärten bis zu improvisierten Spielgruppen in den Zwischengeschossen.
Die Architektur der Vertikale war ursprünglich eine pragmatische Antwort auf das Bevölkerungswachstum in unseren Städten. Die Herausforderung liegt nicht in der Höhe der Gebäude selbst – auch in traditionellen horizontalen Siedlungen gab es Einsamkeit und soziale Ausgrenzung. Entscheidend ist vielmehr, wie wir diese vertikalen Strukturen gestalten. Die innovativen Projekte zeigen: Auch Hochhäuser können lebendige Nachbarschaften ermöglichen, wenn sie von Anfang an für Gemeinschaft geplant werden.
Die vorherrschende Architektur der Einsamkeit spiegelt jedoch eine tiefere gesellschaftliche Entwicklung wider. Während unsere evolutionäre Geschichte von gemeinschaftlicher Fürsorge geprägt ist, leben viele Mütter heute in einer gebauten Umgebung, die soziale Verbindungen systematisch erschwert. Es ist eine Architektur, die Effizienz über Gemeinschaft stellt, Sicherheit über Begegnung, Privatsphäre über Verbundenheit.
Doch nicht nur der Raum formt unsere sozialen Beziehungen. Je länger ich die erleuchteten Fenster beobachte, desto deutlicher erkenne ich: Es ist auch der Rhythmus der modernen Zeit, der uns voneinander trennt. Die Taktung unseres Alltags schafft unsichtbare Mauern, die oft undurchdringlicher sind als Beton.
Zeitarchitektur
Die unterschiedlichen Zeitrhythmen in unseren modernen Wohnformen schaffen eine eigene Choreografie der Isolation. Die starren Tagesrhythmen der Berufswelt kollidieren mit den natürlichen Rhythmen der Kinderbetreuung, wodurch zeitliche Parallelwelten entstehen: Die Sachbearbeiterin mit Baby ist morgens um fünf Uhr wach, während die Krankenschwester nebenan gerade von der Nachtschicht heimkehrt. Die freiberufliche Grafikerin arbeitet nachts, wenn ihr Kind schläft, während über ihr die alleinerziehende Lehrerin schon den nächsten Schultag vorbereitet.
Zwischen sieben und acht Uhr verdichtet sich diese Choreografie zu einem paradoxen Schauspiel der Begegnung und Distanz: Die übernächtigte Mutter mit dem Kinderwagen kreuzt den Weg des Managers im Anzug, die heimkehrende Schichtarbeiterin trifft auf die Studentin auf dem Weg zum Seminar. Diese flüchtigen Momente machen die unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten erst sichtbar – wie Pendler auf gegenläufigen Rolltreppen, die sich für Sekunden auf gleicher Höhe begegnen, nur um dann wieder in verschiedene Richtungen zu verschwinden.
Die Zeitarchitektur moderner Wohnanlagen schafft auch neue „tote Zonen“ – Zeiträume, in denen ganze Stockwerke wie ausgestorben wirken. Zwischen 10 und 16 Uhr, wenn die Berufstätigen bei der Arbeit und die Kinder in der Kita oder Schule sind, verwandeln sich die Flure in gespenstische Nichtorte. Die wenigen, die zu diesen Zeiten zu Hause sind – vor allem Mütter in Elternzeit und Rentner –, werden zu unfreiwilligen Wächtern einer verlassenen Stadt. Der natürliche Rhythmus eines Babys wird zum Kontrapunkt dieser durchgetakteten Welt: Sein Weinen hallt durch leere Flure, seine Bedürfnisse folgen einem Takt, den die moderne Arbeitswelt längst vergessen hat.
Jeder Haushalt folgt seinem eigenen Zeitplan – die individuellen Tagesabläufe der Bewohner haben kaum noch Überschneidungen, die Begegnungen ermöglichen würden. Die Architektur unterstützt diese Entwicklung durch ihre sterile Funktionalität: Begegnungsräume sind nicht vorgesehen, gemeinsame Aktivitäten nicht eingeplant. Die gemeinsamen Zeitrhythmen, die früher das soziale Gewebe einer Nachbarschaft prägten – das kollektive Wäschewaschen am Vormittag, der gemeinsame Kaffeeklatsch am Nachmittag, das abendliche Zusammensitzen vor den Häusern –, sind verschwunden.
Die Überlagerung von zeitlicher Desynchronisation und räumlicher Trennung schafft eine mehrfache Distanz – nicht nur die Stockwerke trennen die Menschen, sondern auch ihre gegenläufigen Zeitrhythmen. Die digitalen Zugangssysteme moderner Wohnanlagen verwandeln selbst den Akt des Nachhausekommens in einen anonymen Vorgang – wo früher ein Pförtner grüßte und Pakete annahm, öffnet heute ein elektronischer Chip die Tür. Automatische Beleuchtungssysteme schalten sich mechanisch ein und aus – wo früher Menschen das Licht für Nachbarn brennen ließen, ersetzt kalte Technik jene menschlichen Begegnungen, die einst selbstverständlich zum Heimkommen gehörten.
Besonders schwerwiegend wirkt sich diese zeitliche Zersplitterung auf Alleinerziehende aus. Ihre Zeitarchitektur gleicht einem fragilen Mobile aus Betreuungszeiten, Arbeitsschichten und den biologischen Rhythmen ihrer Kinder – ein Mobile, das bei der kleinsten Störung aus dem Gleichgewicht gerät. Wo früher ein Netzwerk aus spontaner Nachbarschaftshilfe Zeitpuffer schuf, bleiben heute nur noch professionelle Dienstleistungen – präzise getaktet und teuer erkauft.
Diese Fragmentierung setzt sich selbst an den Wochenenden fort, die einst als gemeinsame Auszeit den sozialen Rhythmus einer Nachbarschaft prägten. Stattdessen entstehen parallele Zeitwelten: Während in einem Stockwerk eine alleinerziehende Mutter mit Homeoffice und Kinderbetreuung jongliert, genießt nebenan eine Familie ihren freien Tag – getrennte Realitäten, nur durch dünne Wände voneinander geschieden.
Diese zeitliche Fragmentierung prägt eine neue Generation: Kinder, die in dieser vertikalen Welt aufwachsen, kennen keinen natürlichen Rhythmus des Zusammenlebens mehr. Stattdessen erleben sie eine Welt der terminierten Begegnungen: Spielverabredungen werden zu Kalenderereignissen, spontane Treffen zum logistischen Projekt. Der natürliche Puls einer Nachbarschaft – das morgendliche Erwachen, das nachmittägliche Spielen, die abendliche Heimkehr – ist einem künstlichen Takt gewichen.
Wo Menschen zwar Wand an Wand, aber in verschiedenen Zeitwelten leben, entstehen unsichtbare Mauern, die oft undurchlässiger sind als die physischen Grenzen zwischen den Wohnungen. Was bleibt, ist eine seltsame Form der Nähe – so nah und doch so fern wie Sterne am nächtlichen Himmel, deren Licht uns erst erreicht, wenn sie selbst schon verglüht sind.
Die zeitliche Fragmentierung moderner Familien zeigt sich besonders drastisch in einer Figur, die oft übersehen wird: dem abwesenden Vater. Was auf den ersten Blick wie eine freiwillige Distanzierung erscheint, enthüllt sich bei näherem Hinsehen als komplexes Zusammenspiel biologischer Prägung und gesellschaftlicher Zwänge.
Das väterliche Paradox
Die erleuchteten Fenster der Hochhäuser erzählen nicht nur von einsamen Müttern. Je länger ich die nächtliche Stadt beobachte, desto deutlicher erkenne ich ein weiteres Muster: In vielen Bürotürmen und Wohnungen brennt noch Licht. Dort sitzen Väter an Bildschirmen – im Büro oder im Homeoffice –, gefangen in einem System, das sie zwingt, genau dann abwesend oder stark eingebunden zu sein, wenn ihre Familien sie am meisten bräuchten.
Die Tragik dieser Situation liegt in ihrer scheinbaren Ausweglosigkeit: Biologisch sind Männer durchaus zu tiefer Fürsorge fähig – die Forschung zeigt, dass Väter nach der Geburt ihrer Kinder sogar messbare hormonelle und neurologische Veränderungen durchlaufen können, die sie auf die Pflege von Nachwuchs vorbereiten. So berichtete das Forscherteam um den Anthropologen Lee Gettler von der Northwestern University in Evanston 2011 in dem Online-Fachmagazin PNAS über einen direkten Nachweis, dass der Spiegel des Sexualhormons Testosteron sinkt, wenn Männer Väter werden.[vi]
Diese biologische Anpassungsfähigkeit steht in einem bemerkenswerten Kontrast zur gesellschaftlichen Realität. Die gleichen gesellschaftlichen Strukturen, die Mütter in die Isolation ihrer Wohnungen zwingen, halten viele Väter in den Bürotürmen fest. Laut dem Statistischen Bundesamt nahmen 2023 nur 1,8 Prozent der Väter, deren jüngstes Kind unter sechs Jahren war, Elternzeit.[vii] Dies zeigt, dass trotz der Möglichkeit zur Elternzeit, die seit 2007 besteht, die tatsächliche Inanspruchnahme durch Väter noch relativ gering ist. Die Gründe dafür sind vielfältig: Finanzielle Erwägungen spielen eine Rolle, da Väter oft die Hauptverdiener sind. Auch subtiler beruflicher Druck, Karrieresorgen und traditionelle Rollenerwartungen beeinflussen die Entscheidung.
Gleichzeitig zeigt sich besonders in der jüngeren Generation ein deutlicher Wandel: Immer häufiger sieht man Väter, die selbstverständlich Kinderwagen schieben, ihre Kinder von der Kita abholen oder den Nachmittag auf dem Spielplatz verbringen. Diese engagierten Väter haben oft kreative Wege gefunden, berufliche Anforderungen und aktive Vaterschaft zu vereinbaren – sei es durch flexible Arbeitszeiten, Homeoffice-Tage oder bewusste Karriereentscheidungen. Sie zeigen, dass intensive väterliche Fürsorge trotz struktureller Hürden möglich sein kann.
Die Realität der meisten Familien sieht jedoch anders aus: Während erschöpfte Mütter in ihren Wohnungen mit den schreienden Säuglingen allein sind, müssen viele Väter bereits wieder Vollzeit arbeiten. Die wenigen Stunden am Abend und am Wochenende reichen kaum, um eine tiefe Bindung aufzubauen. So perpetuiert sich ein System der Isolation – die Mütter bleiben die primären Bezugspersonen durch ein komplexes Zusammenspiel aus strukturellen Hürden und fortbestehenden traditionellen Rollenmustern.
Die vertikale Architektur unserer Städte verstärkt diese Trennung noch. Wo früher in dörflichen Gemeinschaften Väter ihre Kinder zumindest zeitweise in ihren Arbeitsalltag integrieren konnten, schaffen die getrennten Sphären von Büro- und Wohntürmen eine fast unüberwindbare Distanz. Die digitale Vernetzung macht die physische Abwesenheit nur noch schmerzlicher spürbar: Eine Videoschalte aus dem Konferenzraum kann die fehlende väterliche Präsenz nicht ersetzen.
Das System der isolierten Mutterschaft, das ich in den nächtlichen Fenstern der Wohnblöcke beobachte, ist also untrennbar mit einem System der verhinderten Vaterschaft verbunden. Die gleichen wirtschaftlichen Zwänge, die Mütter in die Einsamkeit ihrer Wohnungen verbannen, entfremden Väter von ihren Familien. Die Architektur der Einsamkeit hat zwei Gesichter: die hell erleuchteten Fenster der übermüdeten Mütter und die kalten Bürolichter der abwesenden Väter.
Die nächtlichen Online-Foren, in denen sich erschöpfte Mütter austauschen, haben ihr Pendant in den WhatsApp-Gruppen gestresster Väter, die verzweifelt versuchen, wenigstens digital am Leben ihrer Kinder teilzuhaben. Beide Phänomene sind Symptome einer gesellschaftlichen Organisation von Fürsorge, die weder den Bedürfnissen der Kinder noch den Fähigkeiten der Eltern gerecht wird.
Die erzwungene Abwesenheit der Väter ist jedoch nur ein Teil eines größeren Wandels familiärer Unterstützungssysteme. Eine weitere überraschende Transformation vollzieht sich in der Generation, die traditionell als Rettungsanker überforderter Eltern galt: in jener der Großeltern.
Die Silver Revolution
Die traditionelle Vorstellung von Großeltern als jederzeit verfügbare Betreuungsreserve kollidiert in unserer Zeit mit einer grundlegenden gesellschaftlichen Transformation, deren Tragweite wir erst allmählich zu begreifen beginnen: der stillen Revolution der Silver Generation. Was auf den ersten Blick als simpler Generationenkonflikt erscheint, enthüllt bei näherer Betrachtung eine vielschichtige Neuverhandlung familiärer Rollen, die tief in demografische und soziale Umbrüche eingebettet ist.
Was wir heute als moderne Konflikte wahrnehmen, hat überraschende historische Wurzeln. In Kapitel 2 werden wir eine tiefgründige Zeitreise unternehmen, die unser Bild von Großelternschaft grundlegend infrage stellt. Die vergilbten Seiten der Kirchenbücher der Krummhörn bergen dabei ein gut gehütetes Geheimnis – eines, das Eckart Voland in seiner verstörenden Forschung aufdecken wird: Schon unsere Vorfahren rangen mit der Frage, wie viel Unterstützung Großeltern ihren Familien schuldig waren.
Die dort dokumentierten Familiengeschichten offenbaren Muster, die unser romantisches Bild der „guten alten Zeit“ gründlich erschüttern werden. Sie sind Teil einer viel größeren, bisher unerzählten Geschichte über die Evolution menschlicher Fürsorge – einer Geschichte, die zeigt, dass die Ambivalenz zwischen familiärer Verpflichtung und persönlicher Freiheit so alt ist wie die Menschheit selbst. Doch diese spannenden Erkenntnisse müssen noch einen Moment warten; in Kapitel 2 werden sie uns dann zu ganz neuen Einsichten führen.
In Deutschland und vergleichbaren Industriegesellschaften stehen die heutigen Großeltern für einen historischen Wendepunkt: Sie sind die gesündeste, wohlhabendste und am besten ausgebildete Generation, die es je gab. Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte haben Menschen nach der aktiven Familienphase noch zwei bis drei vitale Jahrzehnte vor sich – eine Zeit, die neue Fragen aufwirft und zu ganz unterschiedlichen Lebensentwürfen führt.
Diese neue Freiheit wird sehr unterschiedlich gelebt: Ein Teil der Großeltern nutzt die gewonnene Zeit bewusst für sich selbst. In Gesprächen mit frustrierten jungen Eltern höre ich dann Sätze wie: „Meine Eltern sind topfit, reisen durch die Welt, aber für regelmäßige Kinderbetreuung fühlen sie sich zu erschöpft.“ Diese Großeltern betonen ihr Recht auf ein selbstbestimmtes Leben: „Wir lieben unsere Enkel, aber wir sind nicht ihre Back-up-Betreuung.“
Die Mehrheit der Großeltern entscheidet sich jedoch nach wie vor für intensive Unterstützung ihrer Familien – allerdings unter anderen Vorzeichen als früher. Sie sehen die Betreuung ihrer Enkel nicht mehr als selbstverständliche Pflicht, sondern als bewusste Entscheidung. Auch wenn sie einen erheblichen Teil ihrer Freizeit dafür aufwenden, tun sie dies aus einer Position der Wahlfreiheit heraus. Das bedeutet auch: Sie setzen häufiger Grenzen, kommunizieren ihre eigenen Bedürfnisse und gestalten die Betreuungszeiten aktiver mit.
Was sich hier vor unseren Augen abspielt, ist mehr als ein oberflächlicher Wandel von Familienstrukturen. Diese „gewonnenen Jahre“ werden zunehmend als eigenständige Lebensphase begriffen – mit dem Recht auf selbstbestimmte Entscheidungen, wie man diese Zeit gestalten möchte. Das führt zu einer neuen Aushandlung familiärer Rollen, bei der auch die traditionell selbstverständliche Großelternrolle auf den Prüfstand kommt.
Besonders interessant finde ich die räumliche Dimension dieser Entwicklung: Wo früher Großfamilien oft in unmittelbarer Nähe lebten, sehen wir heute eine beispiellose Mobilität. Großeltern, die sich nach der Pensionierung bewusst in sonnigere Gefilde absetzen oder ein Wohnmobil anschaffen, sind keine Seltenheit mehr. Die moderne Technik ermöglicht dabei neue Formen der Verbundenheit: Vorlesen per Video-Chat, WhatsApp-Gruppen für Familienneuigkeiten, gemeinsame Online-Spiele. Doch kann diese digitale Nähe die physische Präsenz wirklich ersetzen?
Was mich besonders nachdenklich stimmt: Die Verweigerung der klassischen Großelternrolle ist oft weniger eine Ablehnung familiärer Verantwortung als vielmehr Ausdruck einer tiefgreifenden Identitätssuche. Nach Jahrzehnten der Fremdbestimmung durch berufliche und familiäre Pflichten steht plötzlich die Frage im Raum: Wer bin ich jenseits meiner familiären Rolle? Die Generation der „jungen Alten“ betritt damit Neuland – sie muss Vorbilder für ein aktives, selbstbestimmtes Alter erst entwickeln.
Gleichzeitig sehe ich, wie diese Entwicklung junge Familien vor enorme Herausforderungen stellt. Die selbstverständliche Verfügbarkeit der Großeltern war immer auch eine Form der wirtschaftlichen Unterstützung – unbezahlte Arbeit, die überwiegend von älteren Frauen geleistet wurde. Die Verweigerung dieser Rolle ist damit auch ein später Akt der Emanzipation, eine Absage an die gesellschaftliche Erwartung grenzenloser weiblicher Fürsorge.
In meinen Gesprächen mit Großeltern entdecke ich neue Modelle des Großelternseins: quality time statt Quantität, bewusst geplante gemeinsame Zeiten statt alltäglicher Betreuung. „Wir nehmen die Enkel zweimal im Jahr für eine Woche, machen richtige Abenteuer mit ihnen. Das ist wertvoller als gelegentliches Babysitten“, erklärt mir eine Großmutter ihre Strategie. Aber kann dieses neue Modell die alltäglichen Betreuungsengpässe ausgleichen?
Je tiefer ich in das Thema eintauche, desto klarer wird mir: Wir erleben gleichzeitig eine fundamentale Transformation der Großelternrolle unter den Bedingungen einer alternden, individualisierten Gesellschaft. Was auf den ersten Blick als Krise erscheint, könnte sich jedoch als notwendiger Entwicklungsschritt erweisen. Die Großeltern von heute sind Pioniere – sie entwickeln neue Modelle des Alterns und der familiären Unterstützung, die weit über ihre eigene Generation hinaus Bedeutung haben werden. Die Neuerfindung der Großelternrolle ist dabei nur ein Teil eines größeren Puzzles. Um es zusammenzusetzen, müssen wir zunächst verstehen, welche Formen der Gemeinschaft und gegenseitigen Unterstützung wir im Laufe der Modernisierung verloren haben.
Die Herausforderungen der Gegenwart bergen auch inspirierende Chancen für die Zukunft. Im dritten Kapitel werden wir deshalb erkunden, wie innovative Konzepte wie „Leihgroßeltern“ nicht nur praktische Lösungen für Betreuungsengpässe bieten, sondern auch neue Formen der generationenübergreifenden Gemeinschaft schaffen. Diese Modelle zeigen, wie wir die Kluft zwischen dem Bedürfnis nach familiärer Unterstützung und dem Wunsch nach Selbstbestimmung überbrücken können.
Besonders spannend ist dabei, wie alleinstehende Senioren durch solche Programme eine erfüllende neue Rolle finden können. Ihre Lebenserfahrung und ihr Wunsch nach sinnvoller Beschäftigung treffen auf das Bedürfnis junger Familien nach verlässlicher Unterstützung. Diese Win-win-Situation könnte ein Schlüssel sein, um die soziale Isolation im Alter zu durchbrechen und gleichzeitig überlasteten Eltern zu helfen.
Die Beispiele, die wir in Kapitel 3 kennenlernen werden, machen Mut: Sie zeigen, dass wir nicht zwischen den Extremen von totaler Verfügbarkeit und völliger Abgrenzung wählen müssen. Stattdessen entstehen neue, flexible Formen der Fürsorge, die sowohl den Bedürfnissen der älteren als auch der jüngeren Generation Rechnung tragen.
Anmerkungen
[i] „Gender Care Gap“, Forschungsbericht Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), März 2020, www.bmfsfj.de/resource/blob/154696/ bb7b75a0b9090bb4d194c2faf63eb6aa/gender-care-gap-forschungsbericht-data.pdf (Abrufdatum: 13.2.2025)
[ii] Antje Funcke, Sarah Menne, „Factsheet Alleinerziehende in Deutschland“, Bertelsmann Stiftung (Hg.), Juni 2024, www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/alleinerziehende-factsheet-2024 (letzter Zugriff: 13.2.2025)
[iii] Persönliche Mitteilung von Katja Braubach, Mitarbeiterin der Deutschen Rentenversicherung Bund, 9.1.2025
[iv] Sarah Blaffer Hrdy, Mütter und Andere, Berlin Verlag 2010, S. 180
[v] Zeitverwendungserhebung 2021/2022, Statistik Austria, Wien 2023
[vi] Lee T. Gettler, Thomas W. McDade, Alan B. Feranil, Christopher W. Kuzawa, „Longitudinal evidence that fatherhood decreases testosterone in human males“, in: PNAS, 2011, www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1105403108 (letzter Zugriff: 13.2.2025)
[vii] Personen in Elternzeit 2025, Statistisches Bundesamt, www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Qualitaet-Arbeit/Dimension-3/elternzeit.html (letzter Zugriff: 13.2.2025)
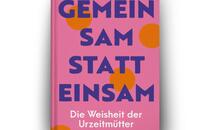
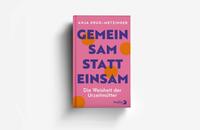
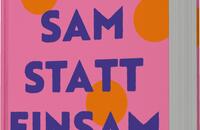
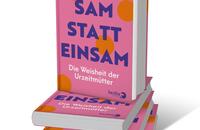
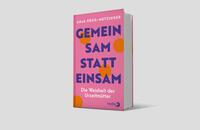
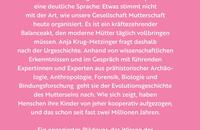


DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.