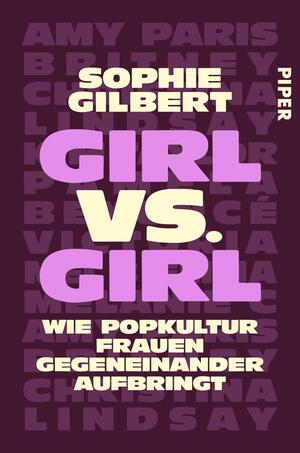
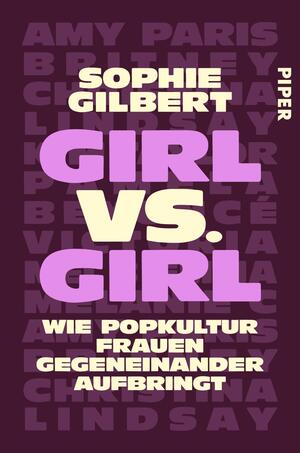
Girl vs. Girl Girl vs. Girl - eBook-Ausgabe
Wie Popkultur Frauen gegeneinander aufbringt
— Feministische Analyse misogyner DynamikenGirl vs. Girl — Inhalt
Frauen gegen Frauen
Warum gehen Frauen oftmals so negativ mit sich selbst und miteinander um? Dieser Frage geht Sophie Gilbert auf den Grund und identifiziert einen wichtigen Faktor: Die Popkultur der 90er- und frühen 2000er-Jahre. Sie analysiert so entlarvend wie erhellend, welche Mechanismen schleichend die Selbst- und Fremdwahrnehmung von Frauen beeinflusst haben. Dazu gehört zum Beispiel die Darstellung von weiblichen Stars in den Medien, die von Objektivierung geprägt ist – Stichwort Reality-TV. Gilbert legt die unbewussten Wirkmechanismen hinter diesen Phänomenen offen und zeigt, was sich ändern muss.
Leseprobe zu „Girl vs. Girl“
Einleitung
„Re-Vision – der Akt des Zurückschauens, eines Schauens mit neuen Augen, das Angehen eines Textes aus einer neuen kritischen Sichtweise – ist den Frauen mehr als nur ein Kapitel Kulturgeschichte: Es ist ein Akt des Überlebens. Solange wir die Voraussetzungen nicht kennen, in die wir verstrickt sind, können wir uns selbst nicht kennen.“
Adrienne Rich (1972)
„Frau wird nicht geboren, sie wird gemacht.“
Andrea Dworkin (1981
Im Jahr 1999, im Jahr meines 16. Geburtstags, fanden drei kulturelle Ereignisse statt, die zu bestimmen schienen, wie man als [...]
Einleitung
„Re-Vision – der Akt des Zurückschauens, eines Schauens mit neuen Augen, das Angehen eines Textes aus einer neuen kritischen Sichtweise – ist den Frauen mehr als nur ein Kapitel Kulturgeschichte: Es ist ein Akt des Überlebens. Solange wir die Voraussetzungen nicht kennen, in die wir verstrickt sind, können wir uns selbst nicht kennen.“
Adrienne Rich (1972)
„Frau wird nicht geboren, sie wird gemacht.“
Andrea Dworkin (1981
Im Jahr 1999, im Jahr meines 16. Geburtstags, fanden drei kulturelle Ereignisse statt, die zu bestimmen schienen, wie man als junge britische Frau – als Mädchen – dem neuen Jahrtausend entgegenblicken würde. Im April wurde Britney Spears auf dem Cover des Rolling Stone abgedruckt, in pinkem Höschen und schwarzem Push-up, in der einen Hand einen Teletubby, in der anderen einen Telefonhörer. Im Mai wurde dann als Marketinggag eines Männermagazins ein achtzehn Meter hohes Nacktbild von Gail Porter, ihres Zeichens Moderatorin von Kindersendungen, auf den Londoner Palace of Westminster projiziert – in dem damals weniger als ein Fünftel der Abgeordneten weiblich waren. Und im September veröffentlichte DreamWorks Pictures American Beauty, einen Film, in dem ein Mann mittleren Alters immer wieder sexuelle Fantasien über die beste Freundin seiner Teenagertochter hegt. Der Film sollte später fünf Oscars gewinnen, unter anderem den für den Besten Film.
Aus heutiger Sicht scheinen alle drei Ereignisse von zwinkernder, postmoderner Ironie durchdrungen zu sein. (Fuchsienfarbene Satinbezüge? Ein Teletubby als Zeichen der Grenzüberschreitung?) Im Spears-Profil schwankt der Interviewer zwischen Lust – das Logo ihres BABY-PHAT-T-Shirts, so schreibt er, „spannte über ihrem üppigen Busen“ – und der distanzierten Beobachtung, dass die Sexualität der Teenie-Idole zur Jahrtausendwende nur eine „sorgfältig ausgelegte“ Falle sei, um Alben an leichtgläubige Dummköpfe zu verkaufen.[i] Die Projektion von Gail Porters Bild wurde von der Marketingagentur Cunning Stunts ohne ihr Wissen oder ihre Zustimmung ausgeführt. Sie wurde damals als riesengroßer, saukomischer Gag angepriesen und sollte bestätigen, dass Frauen gut genug waren für Softcore-Fotoshootings, aber nicht für die politische Arbeit. Lesters Fixierung auf eine Minderjährige wird in American Beauty als Paradebeispiel einer Midlife-Crisis dargestellt, obwohl der Film selbst Angelas Charakter zu nichts mehr als einer hocherotisierten Blumentischdeko verkommen lässt.
Ich nahm all das als Sechzehnjährige nicht bewusst wahr. Für mich war es nur allzu offensichtlich, dass Macht – zumindest die weibliche – sexueller Natur war. Es gab keine andere, oder zumindest keine wertvolle andere. Was aber noch entscheidender ist: dass die Art Macht, die in der Popkultur an der Schwelle zum 21. Jahrhundert fetischisiert wurde, nicht jene war, die man sich im Laufe seines Lebens aneignen konnte, etwa durch Bildung, Geld oder Berufserfahrung, sondern dass es um Jugend, Aufmerksamkeit und die Bereitschaft ging, mitzumachen – selbst wenn wir letztlich nur die Pointe sein durften.
Ich dachte bereits Anfang der 2020er-Jahre darüber nach, dieses Buch zu schreiben, als die Zeit nicht mehr linear wirkte, Fortschritt nicht mehr unabdingbar schien und jeder hässliche Trend, mit dem ich als Y2K-Teenagerin aufgewachsen war, seinen Weg wieder zurückgefunden hatte. Hillary Clintons gescheiterte Präsidentschaftskandidatur 2016, gefolgt von der Welle an Aussagen über sexuellen Missbrauch und Belästigung, die sich ein Jahr später in der #MeToo-Bewegung manifestieren sollte, verdeutlichten bestimmte Realitäten. Die Freizeitmisogynie der Nullerjahre war zurück, dieses Mal mit neuer Technologie und der Kulturfigur Andrew Tate an der Spitze, der einst in der Realityshow Big Brother teilnahm, während er parallel wegen Vergewaltigung unter Tatverdacht stand. Die Obsession der Klatschpresse mit Ehefrauen und Freundinnen wurde für TikTok neu erfunden, wo puppenhafte Frauen in affektlosen Monologen etwas über ihren finanziell abhängigen Traum eines „sanften, weiblichen Lebens“ murmelten.[ii] Die Body-Positivity-Bewegung, die alles dafür getan hatte, normalen Körpern in den Medien und im Einzelhandel den gebührenden Platz zu verschaffen, wurde schnell vom Aufschwung der Medikamente zur Gewichtsreduktion und einer neuen Frauengeneration mit schmalen Taillen und hervorstechenden Oberkörpern wieder verdrängt.
Alles Alte war nun wieder neu, fühlte sich aber dunkler und abgekoppelter denn je an. Die Aufhebung von Roe v. Wade 2022, des Abtreibungsrechts, bezeichnete den greifbarsten Rückschritt der Frauenrechte seit fünfzig Jahren. Aus kultureller Sicht konnte man dem Motiv der Stunde nicht entkommen, und es zeigte sehr genau auf, wie klein unser aller Ambitionen geworden waren. Erwachsene Frauen schenkten sich jetzt gegenseitig Freundschaftsbändchen und dechiffrierten Popsongs wie Codeknackerinnen für den Geheimdienst. Wir machten Mädelstrips, führten Mädelsgespräche, hatten die besten Mädelssommer unseres Lebens und stocherten in unseren Mädelsessen herum. Ich zog mir 2023 meinen besten millennialpinken Blazer an – den, den ich immer bei Podiumsdiskussionen trage –, um mich mit anderen Frauen vor einer erwachsengroßen Puppenschachtel anzustellen, alle gleichermaßen aufgeregt darüber, gleich Fotos von uns machen zu lassen, als könnte ein Augenblick der visuellen Solidarität den Verlust unserer reproduktiven Rechte wettmachen. Die Barbie-Welt, mit ihrem nur mit Frauen besetzten höchsten Gericht und der hegemonischen Weiblichkeit, verdeutlichte nur allzu sehr, dass wir immer noch nur mit ein paar mickrigen Brocken Macht herumspielten. Welche Frau würde da nicht gern, wenn sie die Wahl hätte, wieder ein Mädchen sein?
Viel zu viel an diesem Unbehagen kam mir bekannt vor. Es gab einen Zeitpunkt zu Beginn des 21. Jahrhunderts, als sich der Feminismus genauso nebulös und träge anfühlte, erdrückt von einer kulturellen Explosion des witzigen Extrems und der grellbunten Objektifizierung. In diesem Umfeld wuchsen Millennial-Frauen auf. Es legte fest, wie wir uns in unserer Haut fühlten, wie wir uns gegenseitig wahrnahmen und was wir dem weiblichen Kollektiv zutrauten. Es prägte unsere Ambitionen, unsere Selbstwahrnehmung, unsere Beziehungen, unsere Körper, unsere Arbeit, unsere Kunst. Ich erkannte, dass wir uns nicht vorwärtsbewegen können würden, ohne nicht vollständig zu begreifen, wie sehr uns die Kultur der Nullerjahre geformt hatte.
Mit diesem Buch wollte ich aus einer Perspektive der Kritikerin herausarbeiten, wie und warum jede Unterhaltungsform der Nullerjahre – Musik, Film, Fernsehen, Mode, Magazine, Pornografie – Mädchen die gleiche Botschaft vermittelte, und mit welcher Vehemenz wir diese internalisierten. Ich wollte verstehen, wie eine ganze Generation zu der Überzeugung hatte kommen können, dass Sex unsere Währung war, dass Objektifizierung Empowerment bedeutete und Frauen eine Witzpointe waren. Warum konnte man uns so einfach von unserer eigenen Unzulänglichkeit überzeugen? Wer gab den Ton an? Warum orientierte sich, jahrzehntelang und sogar bis heute, fast jedes kulturelle Produkt so dermaßen am männlichen Verlangen und der männlichen Lust?
Ich ging nicht unbedingt davon aus, dass ich alle Antworten finden würde. Vielmehr wollte ich hauptsächlich die neuere Geschichte umdeuten, und das auf eine Weise, die möglicherweise auch meine eigene Perspektive erweitern würde. Jedoch wurde mir vor allem deutlich, wie sehr Kultur, Feminismus und Geschichte auf separat verlaufenden Gleisen fuhren, die sich dabei gegenseitig durchdringen, stören und sogar zum Entgleisen bringen. Zudem faszinierten mich die Echos – die Verbindungen, Wiederholungen und Trends im Laufe der Zeit und über Genregrenzen hinweg. Sie hallen noch immer nach, während wir weiterhin unberechenbar zwischen Fortschritten und Rückschlägen hin- und herschwanken.
Im Rückblick scheinen all diese Trends und die Kultur, für die sie standen, untrennbar mit dem Aufstieg des Postfeminismus zusammenzuhängen. Dieser entstand in den 1980er- und 1990er-Jahren, weniger als explizite Ideologie, sondern vielmehr als Mechanismus für die Medienaufmerksamkeit und den Kapitalismus, und war eine Reaktion auf den Frauenaktivismus, verstärkt von dem Gefühl, dass die zweite und dritte Welle des Feminismus unsere kollektive Freiheit irgendwie einschränken würden. Susan Bolotin beschrieb 1982 im New York Times Magazine ihre Beobachtungen, dass junge Frauen sich plötzlich vom Feminismus lossagen und jegliche Verbindung leugnen würden, obwohl sie im selben Atemzug dessen Erfolge anerkannten. Eine Hetzkampagne gegen die Frauenbewegung schien ihren Job gut gemacht zu haben; jüngere Frauen, so schrieb Bolotin, deuteten Feministinnen als „unglücklich“ und „schrill“, und das, während sie die neuen Möglichkeiten, die diese Frauen auch für sie erkämpft hatten, mit offenen Armen begrüßten.[iii]
Der Postfeminismus verlief schwammig; er schien sich primär als Gegenbewegung zu einem Schreckgespenst des Feminismus zu definieren, bei dem Frauen zu wahllosem Sex, hemmungslosem Geldausgeben und entweder stereotyper Mädchenhaftigkeit oder offenherziger Sexyness – ganz nach eigenem Belieben – angeregt wurden. All diese Punkte wurden mit Nachdruck als „Empowerment“ verkauft, ein Wort, das mich noch heute äußerst argwöhnisch werden lässt, wenn ich ihm in freier Wildbahn begegne. Die postfeministischen Ideale durchzogen in den 1990er-Jahren langsam die gesamte Popkultur, und es war kein Zufall, dass das Jahrzehnt mit der erbitterten aktivistischen Energie der Riot Grrrls begann, um dann mit den hyperkommerzialisierten Spice Girls zu enden, deren Genialität darin lag, wie es die Journalistin Caity Weaver 2019 beschrieb, „die Vorstellung des Erwachsenseins eines jungen Mädchens darzustellen. […] Pyjamaparty-Sperenzchen als Karriere“.[iv] Es ist eine reine Infantilisierung, wenn man jeglicher Ambitionen beraubt wird. Ein prägender postfeministischer Avatar war Carrie Bradshaw aus Sex and the City, eine puppengleiche Frau, völlig dem Konsum verschrieben, mit regenbogenfarbener Schuhsammlung und einer Wohnung in der Upper East Side, die einer großen Umkleidekabine gleicht. In der Literatur und später auch im Film bereitete Bridget Jones einem nachhaltigen neuen Frauenarchetyp den Weg: dem Wrack. (Das Buch, so merkt eine Besprechung der New York Times 1998 an, „fängt geschickt die Art ein, wie Frauen heutzutage zwischen der ›Ich bin eine Frau‹-Unabhängigkeit und dem jämmerlich-girlyhaften Wunschtraum pendeln, alles für alle Männer sein zu wollen“ – das Paradox des Postfeminismus auf den Punkt gebracht.[v])
Bis zu diesem Zeitpunkt hatte die Frauenbewegung an Fahrt aufgenommen. Unter anderem die Veröffentlichung von Susan Faludis Backlash – Die Männer schlagen zurück 1991 und der Schock über Anita Hills Aussage vor dem Senat während Clarence Thomas’ Bestätigungsverfahrung.[1] Im selben Jahr formierte sich die Dritte Welle des Feminismus, eine Bewegung, die wirklich inklusiv, sexpositiv und voller hoffnungsvollem Ausblick in die Zukunft sein wollte. Was mich während meiner Recherche zu diesem Buch richtig erstaunte, war die Effizienz, mit der diese aktivistische Energie von der Massenkultur abgedämpft wurde. In der Musikbranche wurden die wütenden Frauen des Rocks die gesamten 1990er-Jahre lang durch viel jüngere, deutlich weniger meinungsstarke Mädchen ersetzt. In der Modebranche wurden mächtige Supermodels, die die Bezahlung verlangten, die sie verdienten, und die sich gegenseitig bestärkten, zugunsten von schwachen, passiven Teenagerinnen ausgemustert. Der Feminismus wurde im Laufe der 1990er-Jahre stufenweise von der Kultur umdefiniert – vom kollektiven zum individuellen Kampf. Statt einer integrativen Bewegung, die die Intersektionalität von Race, Klasse und Gender anerkannte, bekamen wir selektive soziale Aufstiegsmöglichkeiten und ungezügelten Konsum. All diese Aspekte entwickelten sich im Laufe der kommenden Jahrzehnte weiter, beeinflusst vom Wirtschaftsfeminismus nach Lean in, der Girlboss-Bewegung und der „Ich will mir hier schließlich keine Freunde machen“-Erbarmungslosigkeit des Reality-TV.
Diese Umkehrung des Protests war zugleich der Beginn der Nullerjahre. Das Kunststück der postfeministischen Massenmedien lag darin, wie Natasha Walter in ihrem Buch Living Dolls 2011 erörterte, dass sie Wörter wie Befreiung und Wahl zweckentfremdet hatten, um Frauen „eine bereinigte, hochgradig sexualisierte und immer begrenztere Vorstellung von Weiblichkeit zu verkaufen“ – eine, in der von uns erwartet wurde, dass wir ein Leben wählen würden, in dem wir sowohl willige Objekte als auch leichte Ziele wären.[vi]
Mir helfen diese sich verschiebenden kulturellen 1990er-Ideale des Frauseins bei meinem Verständnis dessen, warum die Nullerjahre so dermaßen grausam waren, denn die Ideale des Postfeminismus wurden zu Anweisungen, denen sich keine von uns wirklich entziehen konnte. Man konnte nur auf eine Art in der Öffentlichkeit existieren, und die stellte eine Falle dar. Der Druck auf die immer jünger werdenden Nachwuchsstars und -sternchen – „Es regnet eindeutig Teenager!“, so proklamierte 2003 ein berühmt-berüchtigtes Cover der Vanity Fair – stieg ins Unermessliche an, weil sie nun alle die wild voneinander abweichenden Eigenschaften für sich bestätigen können mussten, um erfolgreich zu sein.[vii] Siebzehnjährige sollten nun also sexy Jungfrauen sein – Mädchen mit dem Aussehen von Pornosternchen, die aber Keuschheitsringe tragen – und sollten zudem jeder Zielgruppe alles Mögliche verkaufen. Das ist keine Gratwanderung, die allzu lang möglich ist, und je sichtbarer die Frauen im Laufe der 1990er-Jahre ihre Sexualität ausdrückten oder sich ihr unterwarfen, desto mehr wurde wiederum von uns als weibliches Kollektiv verlangt.
Ich habe dieses Buch chronologisch aufgebaut, von den 1990er-Jahren bis heute, um fassen zu können, was in der Kultur vor diesem geschichtlichen Hintergrund passiert ist. Und, wie ersichtlich werden wird, spiegelt fast jede Ära, Kunstform, jeder historische Moment, Trend und jede Ikone den Einfluss des Genres wider, das im Laufe der letzten 25 Jahre noch omnipräsenter geworden ist als jede andere Art der Unterhaltung. Der englische Titel dieses Buches, Girl on Girl, war ursprünglich als Scherz gemeint – es sollte auf ironische Weise alle Arten darstellen, auf die Frauen gegeneinander und sich selbst ausgespielt wurden, deren kollektive Kraft im Laufe meines Erwachsenenlebens behindert wurde. Je mehr ich jedoch recherchierte, desto mehr schien die Pornografie wirklich alle Massenmedien durchdrungen zu haben. Der Titel bekam also noch eine zweite Ebene.
Der pornografische Einfluss stürmt die Musik: im Intro von Lil’ Kims Hardcore, in Fiona Apples verstörendem Video zu „Criminal“ und während der VMAs 2003, als Snoop Dogg mit zwei angeleinten erwachsenen Frauen erschien. Die Pornografie findet sich in der Kunst und in der Mode: in Jeff Koons’ sexuell expliziter Serie Made In Heaven, in David Baileys und Rankins Fotoserie von 2003, der sogenannten Pussy Show, in der Arbeit und dem Leben Terry Richardsons und in der Y2K-Besessenheit vom sichtbaren Tanga. Die Pornografie steckt hinter dem fast gänzlichen Verschwinden der Schambehaarung, der Ausbreitung des Hollywood Waxing und der Brazilian Butt Lifts und zumindest teilweise hinter der explosionsartigen Zunahme kosmetischer Eingriffe der letzten 25 Jahre. Er ist buchstäblich, wenn auch unscharf und dezent, in der Eröffnungsszene von American Pie zu sehen und thematisch in der Welle an Filmen zu finden, die diese Teenie-Sexkomödie imitierten. Pornografie steht hinter dem Arthouse-Filmtrend, der expliziten Sex mit emotionaler und körperlicher Gewalt verbindet. Sie lässt sich in den Upskirt-Bildern junger weiblicher Stars in den späten Nullerjahren wiederfinden und darin, wie Sexvideos von und mit jungen weiblichen Prominenten gestohlen und online geteilt wurden. Die Pornografie ist deutlich erkennbar in Hannahs und Adams verwirrender Liebesbeziehung in Girls. Und sie ist sogar in der Politik zu finden: Nur wenige Tage nach dem republikanischen Parteitag 2008 begann Hustler Video mit der Produktion des Hardcore-Films Who’s Nailin’ Paylin, mit den Parodien Sarah Palins, Hillary Clintons und Condoleezza Rice’.
Es kommen noch viele weitere Themen in den Betrachtungen der folgenden Kapitel vor: die einschränkende und rückschrittliche Darstellung von Frauen im Reality-TV, der Aufstieg der Autorinnen und ihrer Autofiktion, wie die Girlboss-Ära das individualistische Ethos des Postfeminismus zu Gold machte. Es faszinierte mich jedoch, wie viel sich dessen, was ich zu verstehen versuchte, auf Pornografie zurückführen ließ. Sie ist das prägendste Kulturgut unserer Zeit – das, was am meisten unser Denken über Sex und somit über einander beeinflusst hat. Denn „Pornografie informiert, überzeugt, diskutiert nicht“, schrieb Amia Srinivasan 2022 in ihrem Buch Das Recht auf Sex. „Pornografie trainiert.“[viii] Sie hat eine ganze Menge der Popkultur trainiert – wie bei dieser Lektüre noch zu sehen sein wird –, um Frauen als Objekte zu sehen, als Sache, die man mundtot macht, eingrenzt, fetischisiert, brutalisiert. Und sie hat auch den Frauen geholfen zu trainieren. Die Sozialpsychologin Rachel M. Calogero fand 2013 in einer Studie heraus, dass Frauen deutlich seltener zum Aktivismus neigten und nach sozialer Gleichberechtigung strebten, je mehr sie zur Selbstobjektifizierung – der Kernbotschaft des Postfeminismus und der Pornografie gleichermaßen – tendierten.[ix] In meinen Augen erklärt das schon viel dessen, was Frauen und der Machtverteilung im 21. Jahrhundert passiert ist.
Dieses Buch ist auf keinen Fall vollständig, denn ich habe thematisch mehr ausgelassen, als ich reinnehmen konnte, vor allem, weil ich zum größten Teil Verbindungen herstellen und Muster erkennen wollte. Der ausgewählte Zeitabschnitt war primär geprägt von Heteronormativität, Gender-Essenzialismus und einer starren Binarität – und all diese Punkte haben meine Möglichkeiten eingeschränkt, jenseits dieser Korsette schreiben zu können. Dies ist nur ein kleines Puzzleteil des viel größeren Projekts der Neubewertung. Immerhin ist es ein Ausdruck von Hoffnung, wenn man die Geschichte gemeinsam analysiert: Wir wollen und sollten all die Falschabzweigungen verstehen, damit wir uns einen anderen Weg in die Zukunft besser vorstellen können.
[1] Anm. d. Übers.: Trotz der Vorwürfe der sexuellen Belästigung wurde Thomas zum Richter des Supreme Court ernannt, während Hill öffentlich vernommen, der Falschaussage bezichtigt und später entlassen wurde.
Anmerkungen Einleitung
[i] Steven Daly, „Britney Spears, Teen Queen: Rolling Stone’s 1999 Cover Story“, Rolling Stone, 15. April 1999, www.rollingstone.com/music/music-news/britney-spears-teen-queen-rolling-stones-1999-cover-story-254871/.
[ii] Monica Hesse, „Tradwives, Stay-At-Home Girlfriends and the Dream of Feminine Leisure“, Washington Post, 10. April 2024, www.washingtonpost.com/style/power/2024/04/10/tradwives-stay-at-home-girlfriends-modern-couples/.
[iii] Susan Bolotin, „Voices from the Post-Feminist Generation“, New York Times, 17. Oktober 1982, www.nytimes.com/1982/10/17/magazine/voices-from-the-post-feminist-generation.html.
[iv] Caity Weaver, „The Rise of the Spice Girls Generation“, New York Times, 20. Juli 2019, www.nytimes.com/2019/07/19/style/spice-girls-reunion.html.
[v] Elizabeth Gleick, „A v. Fine Mess“, New York Times, 31. Mai 1998, archive.nytimes.com/www.nytimes.com/books/98/05/31/reviews/
980531.31gleickt.html.
[vi] Natasha Walter, Living Dolls – Warum junge Frauen heute lieber schön als schlau sein wollen. Übers. v. Gabriele Herbst. Frankfurt am Main: Krüger, 2011. [Zitat vom Buchumschlag der Originalausgabe.]
[vii] Krista Smith und James Wolcott, „It’s Raining Teens“, Vanity Fair, 7. Juli 2008, www.vanityfair.com/news/2003/07/teens-portfolio200307.
[viii] Amia Srinivasan, Das Recht auf Sex: Feminismus im 21. Jahrhundert. Übers. v. Claudia Arlinghaus & Anne Emmert. Stuttgart: Klett Cotta, 2022, S. 109.
[ix] Rachel M. Calogero, „Objects Don’t Object: Evidence That Self-Objectification Disrupts Women’s Social Activism“, Psychological Science 24, Nr. 3 (22. Januar 2013), S. 312–18, doi.org/10.1177/0956797612452574.
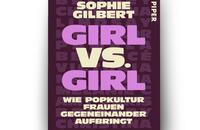


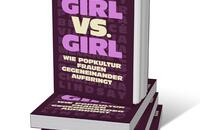
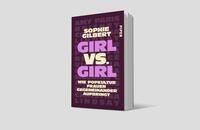


DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.