

Größer als ich Größer als ich - eBook-Ausgabe
Die Autobiografie
— Norwegens Ski-Ikone hautnah und ehrlichGrößer als ich — Inhalt
Der sympathische Superstar der Skiszene erzählt
Der Gentleman des Wintersports so authentisch wie nie: Norwegens Ski-Ikone Aksel Lund Svindal zeichnet seine herausragende Sportlerkarriere nach.
Als Aksel Lund Svindal 2019 das Ende seiner Profikarriere bekannt gab, wurde er sofort von Fans und Kritikern vermisst. In seiner Autobiografie meldet sich der Olympiasieger in eigenen Worten zurück.
Zweimal Olympia-Gold, fünf Weltcup-Siege, 21 Meistertitel allein in Norwegen: Aksel Lund Svindal hat alles erreicht, was es im Skisport zu erreichen gibt. Dabei hat er die Sportwelt stets mit seiner Fairness, seinem sympathischen Auftreten und seiner unglaublichen Disziplin begeistert.
„Größer als ich“ ist nicht weniger sympathisch, nicht weniger diszipliniert und ein wunderbar persönlicher Streifzug durch die Gedankenwelt eines Supersportlers. Authentisch und ohne falschen Filter erzählt Svindal in seiner Autobiografie von seinem harten Weg zum Erfolg. Er beschreibt lustige Anekdoten abseits der Piste und würdigt inspirierende Menschen, die ihn an die Spitze gebracht haben.
Der bezwingende Charme Svindals reißt Leser auf jeder Seite mit. „Größer als ich“ ist eine Einladung zum Griff nach den Sternen, eine Anleitung zum Durchhalten und eine selbstkritische Aufarbeitung eigener Misserfolge.
„Man muss kein Fan sein, um an diesem Buch Gefallen zu finden.“ ― Neue Osnabrücker Zeitung
Der Nr.-1-Bestseller aus Norwegen: spannende Einblicke in den Weißen Sport
Ski-Kollegen wie Marcel Hirscher oder Felix Neureuther bezeichnen Aksel Lund Svindal als Vorbild und Ikone. Sie feiern seine Persönlichkeit mit der gleichen Begeisterung wie seine sportlichen Höhenflüge. Auch sie sind Fans der Biografie, die in Norwegen auf Anhieb Bestsellerstatus erreichte und nun endlich auf Deutsch erschienen ist.
Das perfekte Geschenk für Männer und Frauen mit großen Ambitionen!
Selbst wer Wintersport nur im Fernsehen sieht oder unter Abfahrt etwas völlig anderes versteht, wird von der Offenheit und Feinfühligkeit Svindals begeistert sein. „Größer als ich“ ist ein Geschenk mit Durchlesegarantie und macht aus jedem Leser einen lebenslangen Fan.
Leseprobe zu „Größer als ich“
Erster werden
Ich stehe allein am Start.
Mein Kopf ist leer, die Außenwelt hat aufgehört zu existieren. Die Piste liegt unter mir. Ich kenne sie auswendig, kann sie vor mir sehen, wenn ich die Augen schließe, jeden Meter, jede Kurve, und ich weiß genau, was ich tun muss.
Alles ist bis ins letzte Detail eingeübt, in Tausenden von Trainingsstunden wiederholt, Jahr für Jahr. Ich verlasse mich auf den Körper, und ich verlasse mich auf den Kopf. Ich habe mir einen Plan gemacht. Die Piste ist besichtigt. Im Kopf bin ich sie schon viele Male gefahren.
Jetzt kommt [...]
Erster werden
Ich stehe allein am Start.
Mein Kopf ist leer, die Außenwelt hat aufgehört zu existieren. Die Piste liegt unter mir. Ich kenne sie auswendig, kann sie vor mir sehen, wenn ich die Augen schließe, jeden Meter, jede Kurve, und ich weiß genau, was ich tun muss.
Alles ist bis ins letzte Detail eingeübt, in Tausenden von Trainingsstunden wiederholt, Jahr für Jahr. Ich verlasse mich auf den Körper, und ich verlasse mich auf den Kopf. Ich habe mir einen Plan gemacht. Die Piste ist besichtigt. Im Kopf bin ich sie schon viele Male gefahren.
Jetzt kommt das Rennen.
Jetzt liegt alles an mir.
Wenn es losgeht, übernimmt der Instinkt. Das Gedächtnis des Körpers, die Balance, die Bewegungen, ein Gefühl, außer mir selbst zu sein und zugleich intensiv gegenwärtig.
Die Spitzengeschwindigkeit liegt bei 150 Kilometern pro Stunde, der Untergrund ist pures Eis. Die steilsten Partien sind viel steiler als der Anlauf einer Skisprungschanze. Bremsen geht nicht, Anhalten ist unmöglich, es ist, wie auf großen Wellen zu surfen, die sich auf dem Meer brechen, du kannst nicht gegen sie ankämpfen, du musst dich anpassen, ihren Bewegungen folgen.
Die kürzestmögliche Linie mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit.
Das ist Abfahrt.
Das Einzige, was ich tun kann, ist weiterfahren. Und egal, wie schnell ich bin, ich will, dass es noch schneller geht.
Entlang der Strecke ist der Jubel von dreißigtausend Zuschauern zu hören, aber für mich ist es still. Das Einzige, was ich höre, ist der Wind. Ich brauche dieses Rauschen. Es hilft mir, das Gleichgewicht zu halten. Es erzählt mir etwas über meine Geschwindigkeit.
Ich habe den Tunnelblick. In neunzig Sekunden blinzele ich ein Mal. Nehme jede Information auf, die wichtig ist, sonst nichts. Das Einzige, was ich sehe, sind die Welt direkt vor mir, die Elemente, zu denen ich mich verhalte, die Konturen im Schnee und eine Linie, die nicht existiert, die nur ich sehen kann.
Die Ideallinie, der Bogen, der als schnellster Weg durch eine Kurve führt.
Ich befinde mich in der Zukunft. Die Geschwindigkeit ist so hoch, dass ich dort sein muss, eine Sekunde der Zeit voraus, vierzig Meter vor meinem Körper. Darauf ist alles in mir fokussiert.
Abfahrt ist Angst.
Das gleiche Gefühl, wie wenn du im Auto die Kontrolle verlierst und erkennst, dass es gleich krachen wird. Die akute Alarmbereitschaft des Nervensystems, der Schock im Körper und das pumpende Adrenalin. Wie bei einem Crash auf der Autobahn, wieder und wieder, jede Sekunde, fast zwei Minuten lang.
Abfahrt ist eine Erzählung mit einfacher Dramaturgie. Es gibt keine Haltungsnoten. Alles, was zählt, ist, Erster zu werden.
Die Schwerkraft. Die Zentrifugalkraft. Die Geschwindigkeit. Ich kämpfe gegen Gegner, die so alt wie die Erde sind. Dann ist es vorbei.
Weil ich die Ziellinie überquere.
Oder weil ich gar nicht so weit komme.
Der Sturz
Beaver Creek, Colorado. Dienstag, 27. November 2007.
Ich war nie besser gewesen als in jenem Herbst. Bereits im Februar hatte ich im schwedischen Åre zweimal WM-Gold gewonnen. Ich hatte die Saison mit dem Sieg im Gesamtweltcup beendet, 13 Punkte vor dem Vorjahressieger, dem Österreicher Benjamin Raich, nachdem ich ganz am Ende in Lenzerheide in der Schweiz drei Siege hintereinander geholt hatte.
Die Vorbereitung im Frühling und Sommer war gut gelaufen, und als es auf den Start der neuen Saison zuging, war ich gut in Form. Kjetil André Aamodt und Lasse Kjus hatten aufgehört, meistens war ich der Einzige, der für Norwegen fuhr, besonders in den Speed-Wettbewerben Abfahrt und Super-G.
Ich hatte mit Athleten aus anderen Ländern trainiert. Zuerst waren wir in Neuseeland, wo ich mit den Deutschen und Österreichern Riesenslalom und Super-G fuhr. Danach zogen wir weiter nach Chile, um mit den Kanadiern Abfahrt und Super-G zu trainieren. Ich war der Schnellste. Wir ließen den anderen keine einzige Bestzeit, und Pella Refsnes, der Krafttrainer des Olympiatoppen, des Nationalen Trainingszentrums für Spitzensportler in Oslo und der einzige Trainer, der mit mir in Chile war, sagte, dass es fast ein bisschen dreist sei.
Als die Weltcupsaison 2007/2008 begann, siegte ich weiter. Ich gewann den Riesenslalom im österreichischen Sölden und den Super-G in Lake Louise in Kanada, und als zwei Tage später das Abfahrtstraining in Beaver Creek beginnen sollte, hatte ich ein gutes Gefühl.
Ich stand nackt vor dem Spiegel im Hotelzimmer und putzte mir die Zähne. So gut wie jetzt war ich noch nie vorbereitet, dachte ich. Es war ein geiles Gefühl, denn wenn ich eins hasse, dann ist es, vor einem Rennen nicht vorbereitet zu sein.
Damit kann ich nicht umgehen.
Es gibt immer etwas, das man nicht zu hundert Prozent unter Kontrolle hat, das muss man akzeptieren. Aber ich will die Kontrolle über das haben, was ich beeinflussen kann. Je mehr Kontrolle ich habe, desto weniger muss ich darauf hoffen, Glück zu haben. Oder darauf bauen, dass der Zufall mir in die Karten spielt.
Zwei Jahre zuvor hatte ich mit dem Super-G von Lake Louise mein erstes Weltcuprennen gewonnen, das war ein ganz neues Erlebnis gewesen, und alle Gefühle und der ganze Medienrummel hatten mich viel Kraft gekostet. Jetzt hatte ich mehr Erfahrung. Ich war voller Energie, und als ich mich auf die Waage stellte, zeigte sie 103 Kilo an. Neuer Rekord. Es war perfekt, denn ich wollte schwer sein. Beim Abfahrtslauf ist die Schwerkraft der Motor. Oder, wie Kjetil André Aamodt und Lasse Kjus zu sagen pflegten: Fett ist Tempo.
Ich fühlte mich wohl in Beaver Creek, es ist einer der besten Wintersportorte in den USA. Im Jahr zuvor hatte ich dort die Kombination gewonnen, bei der man Slalom und Abfahrt oder Super-G fährt und die Zeiten dann addiert.
Die Rennstrecke lag mir, und ich war voller Selbstvertrauen. Das ist ganz entscheidend im alpinen Skisport. Ich muss den Glauben haben, gewinnen zu können. Aber erhöhtes Selbstvertrauen kann auch gefährlich sein. Die Risikobereitschaft wächst, wenn ich weiß, dass ich gewinnen kann. Und wenn die Geschwindigkeit zunimmt, werden jede Kurve, jeder Sprung und jede Schussfahrt im Steilhang schwieriger zu bewältigen. Gleichzeitig erhöht sich die Wahrscheinlichkeit eines Sturzes.
Ein Abfahrtsrennen dauert drei Tage. Aus Sicherheitsgründen sollen alle Läufer vor Beginn des Rennens auf der Strecke trainiert haben. Wir absolvieren zwei Trainingsläufe. Den ersten zwei Tage vor dem Rennen und den zweiten am Tag davor. Vor jedem Trainingslauf und vor dem eigentlichen Rennen haben wir eineinhalb Stunden Zeit, um uns mit der Strecke vertraut zu machen. Eineinhalb Stunden, um eine Piste zu studieren, die wir im Rennen in eineinhalb Minuten durchfahren. Da gilt es, die Zeit gut zu nutzen.
Wenn ich die Strecke studiere, gleite ich langsam ab-
wärts, spreche unterwegs mit den Trainern und präge mir alle Einzelheiten ein.
Gleite abwärts und klettere wieder hoch, gleite abwärts und klettere wieder hoch.
Schließe die Augen und merke mir die Linie.
Der Plan ist klar, dann kommt der Probelauf, ich fahre die Strecke ab und teste die geplante Geschwindigkeit. Wenn ich ins Ziel komme, memoriere ich die gesamte Strecke als zusammenhängendes Ganzes. Ich schließe die Augen und bewege die Arme und sehe alles vor mir. Diese Phase ist wichtig, denn je mehr ich von der Strecke weiß, umso geringer erscheint mir das Risiko – und umso kühner wage ich zu fahren.
Wenn die Strecke am Tag des Rennens besichtigt ist, wärmen wir uns auf Skiern auf, gern mit ein paar Runden auf einer Riesenslalompiste, um die Bewegungen in Gang zu bekommen. Eine halbe Stunde vor dem Rennen nehmen wir den Lift hinauf zum Start, wo wir die üblichen Aufwärmroutinen absolvieren und die Rennstrecke noch ein paarmal im Kopf durchgehen. Fünf Minuten vor dem Start erhalten wir per Walkie-Talkie letzte Hinweise von den Trainern. Sie informieren uns über den letzten Stand der Verhältnisse und sagen uns, ob diese sich verändert haben oder nicht.
„Alles ist exakt so, wie wir es geplant haben.“
„Das Tempo ist etwas höher als gestern, der Sprung geht über sechzig Meter, nicht vierzig.“
Solche Dinge teilen die Trainer uns mit, und wenn es Änderungen gibt, nehmen wir in einem letzten gedanklichen Durchgang Justierungen vor.
Bei der Besichtigung vor dem Trainingslauf in Beaver Creek hatte ich den Eindruck, dass der Hang in einem außerordentlich guten Zustand war. Die Rennstrecke heißt „Birds of Prey“, Raubvögel, und die Sprünge tragen Namen wie „Peregrine“ (Wanderfalke), „Goshawk“ (Habicht) und „Golden Eagle“ (Steinadler). Der letzte ist einer der weitesten im gesamten Weltcup, und an diesem Tag waren die Verhältnisse in der flachen Anfahrt zum Sprung ideal. Ich betrachtete sie, sah die schnellste Linie und dachte: Das krieg ich hin.
Im Starthaus. Ich blickte hinunter auf die Piste, füllte die Lungen mit Luft, in tiefen Zügen, eins, zwei, drei, der Starter zählte die Zeit herunter, two seconds, one second, volle Konzentration, ich stieß mich vom Start ab, krümmte mich in die Hocke, wählte eine freche Linie in der steilen Passage, die ideale Spur den Hang hinunter, und ich dachte: Es läuft perfekt. So schnell war ich auf dieser Piste noch nie.
Der „Golden Eagle“ ist normalerweise ein Sprung zwischen vierzig und sechzig Metern, je nach Geschwindigkeit. Auch wenn ein Abfahrtsläufer sechzig Meter weit springt, hat er versucht, so kurz wie möglich zu springen, denn in der Luft geht es langsamer als am Boden.
In der letzten Kurve vor dem „Golden Eagle“ hatte ich ein bisschen zu viel Rücklage. Ich war schneller als vorhergesehen. Beim Absprung war ich ein wenig aus dem Gleichgewicht. Es war ein Fahrfehler, der geschah, weil mein Tempo so hoch war, nachdem ich in der Passage davor die Ideallinie so gut getroffen hatte. Die absolut letzte Stelle, wo du in der Abfahrt einen Fehler machen willst, ist unmittelbar vor einem Sprung. Die Weite des Sprungs ist nur ein Moment. Die größte Herausforderung ist der Höhenunterschied, der rasch bis auf vierzig Meter anwachsen kann. Die Landungen sind hart.
In der Regel bin ich in der Lage, einen Fehler zu korrigieren, aber manchmal geht es nicht. Es überrascht mich, wenn es passiert, weil ich daran gewöhnt bin, die ganze Zeit aus der Balance zu sein, mich aber immer wieder zu fangen vermag. Ich glaube, alles geht gut, bis ich begreife, dass nicht alles gut geht, und dieser Dienstag im November 2007 in Beaver Creek war ein solcher Tag. Ich verlor die Kontrolle, verschwand über die Absprungkante und wurde herumgerissen.
Als Erstes dachte ich: Das wird kein guter Sprung.
Das Einzige, was ich sah, waren Wolken und Himmel, nicht der Hang, nicht die Baumspitzen, nicht das orangefarbene Sicherheitsnetz, nichts.
Ich begriff, dass ich es nicht schaffen würde, mich zu fangen. Ich versuchte mich zu drehen, um nicht auf dem Nacken zu landen. Ich konnte nichts tun, außer mich in der Luft zusammenzurollen, mich auf den Aufschlag vorzubereiten und das Beste zu hoffen.
Teil 1
1982–1988
1.
Sommer 1988, neunzehn Jahre davor.
Ich war fünf Jahre alt und stand auf dem Asphalt im Daleveien, wo wir wohnten, Mutter, Vater, mein kleiner Bruder Simen und ich.
Ein Stück die Straße weiter unten wohnte ein Junge, der Fredrik hieß. Er war älter als ich, und er war an ein Skateboard gekommen. Es war das erste Mal, dass ich eines sah. Skateboards waren damals in Norwegen noch verboten und wurden erst im Jahr darauf erlaubt.
Das Skateboard war schwarz und orangefarben. Ich wollte wissen, wie man damit fuhr und wie schnell es gehen konnte. Fredrik sagte, ich könnte es selbst ausprobieren. Zuerst war ich enttäuscht. Es ging zu langsam, es machte keinen Spaß. Ich wollte mehr Tempo, und das kriegt man an abschüssigen Stellen. Ich nahm das Skateboard mit auf einen kleinen asphaltierten Hang. Er war nicht lang, aber steil, zumindest für einen Fünfjährigen.
Ich stellte mich auf das Brett, und was dann passierte, begriff ich erst hinterher. Das Brett verschwand unter meinen Füßen. Ich fiel nach hinten und schlug mit dem Kopf auf den Asphalt. Da blieb ich bewusstlos liegen, während Fredrik nach Hause lief und seinen Vater Terje holte, der auch unser Fußballtrainer war.
Terje kam angelaufen. Er muss gedacht haben, ich sei tot, als er mich da liegen sah, aber als er bei mir ankam, merkte er, dass ich atmete. Er hob mich hoch und trug mich nach Hause. Ich erwachte in seinen Armen und begriff nichts. Vater kann sich noch daran erinnern, wie sie mit mir nach Hause kamen. Es klopfte an der Tür, und da stand Terje und hatte mich auf dem Arm.
Ich weinte.
Vater bekam einen Schock.
Weil ich Mutter und Vater nicht unnötig Sorgen machen wollte, sagte ich, dass alles in Ordnung sei und ich allein gehen könne.
Ich konnte es nicht.
Das war meine erste Verletzung. Ich hatte eine kräftige Gehirnerschütterung, und Mutter und Vater sollten aufpassen, wurde ihnen gesagt, dass ich nicht einschliefe, sondern vierundzwanzig Stunden wach bliebe. Ich lag auf dem braunen Sofa im Wohnzimmer. Meine Eltern kauften mir eine Uhr, damit ich etwas hatte, womit ich mich beschäftigen konnte. Sie dachten wohl, es sei weniger wahrscheinlich, dass ich dann einschliefe.
An die Uhr kann ich mich noch immer erinnern.
Es war eine blaue Swatch.
Goofy war der große Zeiger, Micky Maus der kleine.
2.
Ich bin in einer stillgelegten Bäckerei in Fetsund in der Region Akershus aufgewachsen. Ursprünglich hieß sie „Svindals bakeri“, und Großmutter und Großvater waren die Inhaber. Sie hatten sie von meinem Urgroßvater, dem Vater meines Großvaters väterlicherseits, geerbt, der offenbar ein gewiefter Unternehmertyp war.
Großmutter war fürsorglich und pflichtbewusst. Sie arbeitete mit Großvater zusammen und genauso hart wie er. Als sie in Rente ging, hatte sie dreißig Jahre lang keinen Tag gefehlt.
Die Bäckerei hatte neben den Großeltern noch zwei Angestellte, die zwischen Strømmen, wo sie wohnten, und ihrem Arbeitsplatz pendelten. Großvater kam aus Fetsund, aber Großmutter kam aus Strømmen, und zu irgendeinem Zeitpunkt muss es ihr gelungen sein, ihn zu überreden, dorthin zu ziehen. Großvater hing an Fetsund, aber Großmutter sagte immer: „Strømmen er drømmen“, Strømmen ist der Traum. Vielleicht überzeugte ihn das.
Großmutter liebte solche Ausdrücke, Redensarten und Sprichwörter, die auf einfache Art und Weise klarstellten, wie die Welt zusammenhing. Neben „Strømmen er drømmen“ war einer ihrer klassischen Sprüche: „Das ist ganz sicher. Der Arzt hat es gesagt.“
Der Daleveien lag direkt an der Eisenbahnlinie. Damals war es ein kleines Zentrum, wohin die Leute kamen, um einzukaufen, doch im Lauf der Siebzigerjahre änderten sich die Einkaufsgewohnheiten der Menschen. Jetzt gingen sie lieber nach Fetsund, und die Bäckerei brachte nicht mehr genug ein, um davon leben zu können. Schließlich wurde sie stillgelegt. Die Großeltern vermieteten das Haus für einige Jahre. Dann stand es leer, bis Mutter und Vater es ein paar Jahre vor meiner Geburt übernahmen und zu einem Wohnhaus umbauten.
Zusätzlich zu der Bäckerei hatten Großmutter und Großvater eine Kurzwarenhandlung betrieben, in der sie alles von Kolonialwaren bis zu Textilien verkauften. Sie hieß „Svindals manufaktur“ und lag im Haus neben der Bäckerei. Auch die Kurzwarenhandlung wurde aufgegeben. Vater erbte die Bäckerei. Sein Onkel, den wir nur Onkel Bjarne nannten, war mit Else verheiratet, die wir Tante Else nannten. Sie erbten die Kurzwarenhandlung. Die Bäckerei war umgebaut, aber das Haus von Bjarne und Else sah weiterhin aus wie ein alter Kaufmannsladen. Es war weiß und hatte im Erdgeschoss große Ladenfenster. Tante Else und Onkel Bjarne wohnten in der ersten Etage.
Mutter arbeitete in einem Reisebüro und pendelte zwischen Fetsund und Oslo. Vater gründete 1982, in dem Jahr, in dem ich geboren wurde, seine eigene Firma als Steuerberater. In den ersten Jahren hatte er sein Büro zu Hause. Danach zog die Firma in neue Räume in Lillestrøm. Vater hat erzählt, dass Mutter es für Wahnsinn hielt, sich selbstständig zu machen, als sie gerade ihr erstes Kind erwarteten, doch er fand, es sei ein guter Zeitpunkt.
Drei Jahre später bekam ich einen kleinen Bruder. Mutter und Vater hatten beschlossen, dass er Mikkel heißen sollte. Sie fragten mich, ob mir der Name gefalle. „Auch bäh bäh und hü hott, hü hott“, sagte ich. Danach gelang es ihnen nicht mehr, an etwas anderes zu denken als an Reineke Fuchs, und so endete es schließlich mit Simen.
Simen und ich gingen in einen Kindergarten namens „Nerdrum Dagpark“. Er machte um zwei Uhr zu, sodass Tante Else auf uns aufpassen musste, bis Mutter und Vater von der Arbeit kamen. Wir fanden sie superlustig, und das ist sie immer noch. Im Sommer 2018 war ich bei ihrem neunzigsten Geburtstag im Festsaal des Missionshauses im Zentrum von Fetsund, gleich neben der Mietwohnung, in die sie viele Jahre nach Onkel Bjarnes Tod gezogen ist. Ihr neunzigster Geburtstag war wie eine Zeitreise dreißig Jahre zurück. Das Missionshaus, die Menschen, das Essen und die Limonade von Roma Mineralvannfabrikk, alles war so wie damals, als ich ein kleiner Junge war. Tante Else erzählte, sie habe uns Rosinenbrötchen gebacken, als wir Kinder waren. Da sie und Onkel Bjarne im ersten Stock wohnten, legte sie die Brötchen in einen Korb, den sie zu uns hinunterließ, während wir auf dem Hof standen.
3.
Auf der gegenüberliegenden Seite des Daleveien wohnte mein bester Freund Christian. Er war ein paar Jahre älter als ich und der Jüngste in seiner Geschwisterschar. Seine großen Brüder waren die Zwillinge Robert und Harald Stoltenberg.
Wir fanden die Stoltenberg-Zwillinge cool, sie waren Jugendliche, fast erwachsen, sie hatten einen Talentwettbewerb von NRK P3, dem besonders für junge Menschen gemachten Hörfunkprogramm des Norsk Rikskringkasting, der staatlichen Rundfunk- und Fernsehanstalt, gewonnen, und sie hatten sich ein Cabrio gekauft, einen gelben Suzuki Jimny Jeep, in dem wir auch mal sitzen durften. Die Stoltenberg-Zwillinge gingen in die Welt hinaus, bis zum NRK, und als sie nach Hause kamen, brachten sie den Hauch von etwas Größerem mit nach Fetsund.
Christian und ich waren viel zusammen. Wir waren oft bei ihm, doch noch öfter bei mir, denn im Parterre hatten wir einen langen Gang, der in ein großes Kaminzimmer überging. Der Gang hatte einen glatten Kiefernfußboden, die perfekte Bahn, um auf Strümpfen zu rutschen, beinahe wie eine glatt polierte Bowlingbahn.
Christian erinnert sich an mehr als ich, vielleicht weil er acht war und ich fünf. Er hat erzählt, dass Mutter manchmal herunterkam und uns bat, uns zu beruhigen, damit niemand zu Schaden kam.
Simen und ich hatten zwei Fortbewegungsmittel, die in dem Gang benutzt werden konnten. Ein Laufrad aus Plastik und ein Laufauto. Sie gehörten Simen, er war ja erst drei Jahre alt, doch wir benutzten sie alle drei. Wir schoben einander an, um ordentlich Fahrt aufzunehmen, sodass wir uns auf die Seite legen und ins Kaminzimmer rutschen konnten. Das Laufrad war gelb und rot und hatte schwarze Plastikräder, die auf dem Holzboden Spuren hinterließen. Aber wir waren liebe Jungen, wir holten einen Lappen und wischten die Spuren nach jedem Lauf weg.
Mutter legte viel Wert darauf, dass wir uns bewegten, deshalb bekamen wir ein kleines Trampolin zum Hüpfen. Es stand in der einen Ecke des Kaminzimmers, in der anderen waren viele Grünpflanzen, Palmen mit großen Blättern. Im Winter veranstalteten wir Picknicks zwischen den Pflanzen. Mutter gab uns Ritz-Cracker, jedem einen Plastikbecher und roten Saft in einer Thermoskanne, und dann saßen wir in der grünen Oase, Simen und Christian und ich, und fühlten uns wie Entdeckungsreisende in einer anderen Zeit.
4.
Schon von klein auf war ich von Autos fasziniert. Ich erinnere mich daran, dass ich mit Mutter auf dem Weg zum Kindergarten am Bahnhof vorbeiging. Ich betrachtete den Verkehr, zeigte auf die Autos und sagte:
„Volvo!“
„BMW!“
„Audi!“
Ich kannte nicht die Namen der verschiedenen Modelle, doch ich erkannte die Marken.
Und ich achtete darauf, ob die Autos ein oder zwei Auspuffrohre hatten.
Im Jahr vor meiner Geburt, 1981, hatte Vater einen gebrauchten BMW 528 mit einem 2,8-Liter-Motor gekauft. Er besaß zwei Auspuffrohre, und das war das Tollste, was ich mir vorstellen konnte, denn es bedeutete, dass es ein sportliches Auto war und dass es schnell fuhr.
Eines Tages baute Vater einen Unfall. Ich war nicht dabei, aber Mutter und Simen. Vater hatte ein bisschen zu viel Gas gegeben, erklärte er, sodass der Wagen von der Straße abkam und auf dem Dach landete. Mutter, Vater und Simen blieben unverletzt, doch der Wagen war schrottreif, und Vater musste einen neuen kaufen.
Er bestellte einen nagelneuen grünen BMW 520. Das Modell war gerade erst auf den Markt gekommen, und Vater war superstolz.
Ich weiß noch, wie er ihn abholte. Ich wartete voller Spannung, und als er auf den Hof einbog, lief ich ihm entgegen. Ich lief direkt an Vater vorbei, der noch auf dem Fahrersitz saß, und hinter das Auto, um die Auspuffrohre zu checken.
Noch heute erinnere ich mich an den Schock, als ich sah, dass der Wagen nicht zwei Auspuffrohre hatte, sondern nur eins.
Fetsund ist ein kleiner Ort, und wenn damals jemand ein neues Auto bekam, erschienen die Nachbarn, um es zu bestaunen. Der neue BMW stand auf dem Hof hinter unserem Haus, und um ihn herum standen die Nachbarn. Sie redeten und traten gegen die Reifen und diskutierten über den Wagen. Vater fand es bestimmt super, aber ich war nicht beeindruckt.
5.
Zu einem bestimmten Zeitpunkt fingen alle Kinder in der Nachbarschaft an, Fußball zu spielen. Ich fing auch an, aber ich war nicht so gut.
Vater interessierte sich nicht für Fußball, wir hatten es also bis dahin nie gespielt. Auch Christian war nicht davon begeistert. Er war ein smarter Typ, aber nicht besonders sportlich.
Alle Jungen traten in den Fet IL, den Sportclub Fet Idrettslag, ein. Wir hatten blaue Trikots und rote Hosen. Terje, der Vater von Fredrik mit dem Skateboard, war der Trainer, und wir wurden von der Postbank gesponsert, weil der Vater eines meiner Mannschaftskameraden dort arbeitete.
Es war wie immer bei Mannschaftssportarten. Manche waren gut, andere nicht besonders gut, und viele befanden sich dazwischen.
Ich gehörte zur mittleren Kategorie. Physisch war ich zwar in der Lage, wie ein Verrückter zu rennen, aber ich hatte kein Ballgefühl. Die Besten dribbelten oder passten sich untereinander die Bälle zu, aber Typen wie ich wurden nicht so viel ins Spiel einbezogen. Ich hätte sicher besser werden können, wenn ich mehr geübt hätte, doch das tat ich nicht. Ich war nicht wirklich interessiert, aber ich ging dennoch weiter zum Training. Ich hatte gelernt, dass man etwas, was man angefangen hatte, auch zu Ende bringen sollte. Mutter und Vater bestimmten. Ich konnte nicht einfach aufhören, nicht nachdem ich gesagt hatte, dass ich dabei sein wollte. Der Mitgliedsbeitrag war bezahlt, Fußballschuhe waren angeschafft worden. Diese Regeln galten auch, als Mutter mich in der Tanzschule angemeldet hatte.
Die Tanzschule wurde in einem alten Versammlungshaus oben bei der Fetsundbrücke veranstaltet. Die Mütter hatten sie organisiert, und alle Jungen in der Straße meldeten sich an. Keiner von uns ahnte, was auf uns zukam, und als wir zur ersten Stunde antraten, wurde uns gesagt, dass wir jeder mit einem Mädchen tanzen sollten.
Die anderen weigerten sich.
Die meisten hörten nach der ersten Stunde wieder auf, nur ich und ein anderer Junge machten weiter. Ich weiß nicht mehr, ob Mutter und Vater Druck auf mich ausübten. Die Jungen fanden es doof, mit Mädchen zu tanzen. Ich auch, aber da ich einmal Ja gesagt hatte, war an Aufgeben nicht zu denken.
Zum Abschluss gab es eine Vorführung, damit die Eltern sehen konnten, was wir gelernt hatten. Ich hatte gute Hosen, ein Hemd und eine Fliege an. Alle Eltern waren da, und die Lehrerin sagte zu mir und dem einzigen anderen Jungen, weil wir so tüchtig gewesen seien, dürften wir miteinander tanzen.
6.
Mein Großvater mütterlicherseits war Pilot. Er war bestimmt der Pilot mit den meisten Flugstunden in der Geschichte Norwegens. Und dieser Rekord wird nie übertroffen werden, denn als Großvater flog, gab es noch keine Sicherheitsstandards und vorgeschriebenen Ruhezeiten wie heute.
Er flog ein Wasserflugzeug in Westnorwegen. Seine Aufträge reichten von Krankentransporten im Gebirge bis zum Transport von Baumaterial und Post. Dann wechselte er zur Fluggesellschaft Sterling. Sie flogen anfangs von Fornebu aus, und so landeten Großmutter und Großvater in Bærum, obwohl sie beide aus Bergen stammten. Ungefähr zur gleichen Zeit beschlossen sie, in Geilo eine Hütte zu bauen, es war ein geografischer Kompromiss, in der Mitte zwischen Oslo und Bergen.
Geilo war ein Skiort, aber Bærum ebenso. Die Großeltern wohnten in einem Reihenhaus gleich am Skigebiet Kirkerudbakken, und beide engagierten sich im örtlichen Skisport. Großmutter war aktives Mitglied im Bærums Skiklub, und nach und nach wurden die Kinder es auch. Alle drei fuhren Ski, und sie waren gut.
Onkel Roar war Reserve bei den Olympischen Winterspielen 1972 in Sapporo, und Mutter und Tante Gerty gehörten dem Europacupteam an. Mutter hatte seit ihrer Kindheit alpinen Skisport betrieben. Am besten war sie im Slalom und Riesenslalom, und sie vertrat Norwegen bei Wettbewerben in den Alpen bis in die Mitte der Siebzigerjahre.
Auch Vater war ein guter Skifahrer. Er wurde Kreismeister und fuhr aktiv, bis er sechzehn Jahre alt war. Dann machte er einen Trainerkurs. Er trainierte lokale Klubs in der Region Romerike und an der Scottish Norwegian Ski School in den Cairngorm Mountains in den schottischen Highlands, was damals ein attraktives Ziel für Alpinskifahrer war, denn es war für viele Briten noch nicht so erschwinglich, in die Alpen zu reisen.
Später begann er als Skilehrer in dem kleinen Wintersportort Beitostølen. Mutter machte das Gleiche. Dort begegneten sie sich 1975. Ein paar Jahre später wurden sie ein Paar, und so gesehen ist es vielleicht angebracht zu sagen, dass mein Leben an einem Skihang begann.
Nach meiner Geburt am 26. Dezember 1982 dauerte es nicht länger als drei Monate, bis ich zum ersten Mal auf der Hütte der Großeltern in Geilo war. Das war Ostern 1983, und danach verbrachten wir alle, wirklich alle Ferien im Winterhalbjahr dort.
Die Weihnachtsferien.
Die Winterferien.
Die Osterferien.
Und sicher auch die Herbstferien, während wir auf den Schnee warteten.
Es stand nie zur Debatte, anderswohin zu fahren, wir kannten nichts anderes, und so blieb es, bis ich als Fünfzehnjähriger nach Oppdal ging, um das Skigymnasium zu absolvieren.
Simen und ich fuhren nicht Ski, um gut zu werden, sondern weil wir es liebten. Wenn wir uns in Geilo aufhielten, waren wir ständig zusammen. Fuhren Ski, übten Sprünge, warfen Schneebälle, gruben Schneehöhlen und bauten Schneemänner.
Wir liebten alles, was mit Schnee und Winter zu tun hatte. Die Hütte lag nur ein paar Hundert Meter vom Skilift entfernt, und schon im Alter von fünf, sechs Jahren begannen wir, allein damit zu fahren.
Mutter und Vater waren froh über unseren Eifer, aber sie sahen es nicht als Training an, und ich bezweifle, dass sie uns je als zukünftige Skirennstars betrachteten. Ich glaube, keiner von beiden dachte damals an so etwas, aber es war schön, einen gemeinsamen Sport zu haben, der uns allen Freude machte.
Als wir anfingen, Skirennen zu fahren, landeten wir in der Regel im Mittelfeld. In allen Sportarten gibt es Kinderstars, auch im alpinen Skisport. Weder Simen noch ich gehörten zu dieser Kategorie, aber wir hatten Ehrgeiz. Wir interessierten uns dafür, was wir wie machten, und wollten ständig mehr lernen.
Wir trainierten viel am Varingskollen, und Vater hat erzählt, dass es, wenn wir uns ins Auto gesetzt hatten, um nach Hause zu fahren, nicht lange dauerte, bis ich fragte, ob wir nicht umkehren könnten. Ich war nicht besonders tough, aber ich liebte es, Ski zu fahren, und tat es, so oft es ging. Es gefiel mir, mich mit denen, die um mich herum waren, zu messen, ich wollte die anderen Elfjährigen besiegen, aber ich träumte nie davon, Weltmeister zu werden.
Die Hütte in Geilo war eine klassische norwegische Fjellhütte aus den Fünfzigerjahren mit Rundhölzern, offenem Dachgebälk und einem Dachüberstand vor der Eingangstür, die in der Mitte geteilt werden konnte, damit man hinauskommen konnte, auch wenn es in der Nacht stark geschneit hatte.
In der Stube war ein riesiger, aus Naturstein gemauerter Kamin. Darin machten wir abends nach einem langen Tag auf den Skiern Feuer.
In der Regel war die Hütte voll. Großmutter und Großvater waren da, Mutter, Vater und Simen und ich, mein Onkel und meine Tante und die Vettern Torjus und Mikkel, die etwas jünger waren als wir. Simen und ich schliefen im selben Raum. Morgens frühstückten wir gemeinsam und hatten unsere Routinen, wie wir so schnell wie möglich raus auf die Piste gelangten. Frühstücken, Zähne putzen, anziehen: wollene Strumpfhosen, Wollpullover, Daunenjacke, Skihose, Handschuhe, Helm, die Stiefel im Gang und die Stöcke vor der Hütte.
Onkel Ingvar, der mit Mutters Schwester Gerty verheiratet war, arbeitete als Trainer beim Skiverband und für den Skiklub Lommedalens IL, und manchmal lud er echte Slalomstangen aufs Autodach und brachte sie mit auf die Hütte.
Heute ist es viel strenger geworden, doch damals durften wir unsere Piste noch selbst anlegen. Wir fragten den Liftmann am Hang, ob es okay wäre. In der Regel sagte er Ja, solange wir uns am Waldrand hielten, auf der rechten Seite von Hallstensgård, wo wenig Leute waren.
Zu der Zeit gab es viele Starthäuschen am Hang, Buden, die hier und da auf dem Skigelände standen. Sie waren klein und windschief, aber ich erinnere mich noch daran, wie großartig wir es fanden, mit echten Slalomstangen eine Piste abzustecken und in einem echten Starthäuschen starten zu können.
Simen und ich trainierten jeden Tag stundenlang Slalom, und das führte dazu, dass wir gute Skiläufer wurden. Wir fuhren zusammen und pushten uns so gegenseitig. Die anderen Kinder erlebten uns wahrscheinlich als ziemlich unsozial, aber ich glaube, das war uns egal. Das Wichtigste war, Slalom zu fahren. So sammelten wir eine Menge wertvoller Erfahrungen, zu denen die Kinder, mit denen zusammen wir in Rælingen und zu Hause in Romerike fuhren, keinen Zugang hatten. Doch für uns war es kein bewusstes Training. Wir fuhren Slalom, weil es eine coole Herausforderung war.
7.
Simen und ich wurden in eine echte Skifahrerfamilie hineingeboren. Vater hat uns die ganze Zeit unterstützt, aber er kaufte uns nicht einfach so die Ausrüstung. Wir mussten sie uns zu Weihnachten und zu unseren Geburtstagen wünschen.
Vater war enthusiastisch, aber er hat mich nie gedrängt. Viele Eltern machen das, besonders Väter – schon möglich, dass ich noch besser geworden wäre, wenn mein Vater von meinem zehnten Lebensjahr an das Vollzeitprojekt gehabt hätte, einen Weltmeister aus mir zu machen. Vielleicht hätte ich ja auch aufgehört. Wie auch immer, ich bin froh, dass er es nicht tat.
Das heißt nicht, dass er nicht engagiert war, im Gegenteil, er war in höchstem Maß engagiert, und es gibt zahlreiche Fernsehaufnahmen, auf denen er jubelt wie ein völlig Verrückter. Er fand es großartig, als ich mit vierzehn anfing, in Oslo und Akershus Rennen zu fahren, als ich mit fünfzehn das Hovedlandsrennen gewann und als ich nach Oppdal ging und später an europäischen Wettbewerben und sogar an der Juniorenweltmeisterschaft teilnahm.
Simen und ich lernten früh, dass du das, was du dir auftischst, auch auslöffelst. Wenn du etwas tust, dann tu es richtig, das war stets Vaters Prinzip. Wenn wir an einem Samstag zum Varingskollen wollten, dann kam es nicht infrage, dass wir zweimal die Piste hinunterfuhren und danach im Aufwärmraum Kakao tranken. Ich verstand, was er meinte. Wir hatten uns entschieden, ein Wochenende Ski zu fahren, dann sollten wir das auch tun.
Ich erinnere mich noch an eine Begebenheit, als wir bei sehr großer Kälte auf dem Kvitfjell trainierten.
„Willst du nicht ein paar Runden im Rennanzug fahren?“, fragte Vater.
Er sagte nicht, dass ich es tun solle, er stellte nur die Frage. Ich war dreizehn Jahre alt. Ich wusste, dass er recht hatte, dass es das Richtige war, wenn ich besser werden wollte. Aber es war viel kälter, im Rennanzug zu fahren, und ich weigerte mich. Die anderen Kinder kommentierten es und meinten, Vater sei streng, aber so habe ich es nie aufgefasst.
Nicht die Erwachsenen bestimmen, was Spiel ist, sondern die Kinder. Die Erwachsenen können das Spiel verderben, zum Beispiel wenn sie das Training zu ernst oder zu uninteressant gestalten. Mit Spiel meine ich nicht, um Bäume herumzufahren und rückwärts zu springen, ich meine, dass ich mich innerhalb des Wettbewerbs bewegt und ständig versucht habe, Dinge herauszufinden. Ich habe auf spielerische Art und Weise die Fähigkeit entwickelt, schnell zu beschleunigen. Wie oft hast du nicht schon jemanden zu einem Achtjährigen sagen hören: „Lauf und hol deinen Beutel, dann stoppe ich deine Zeit!“
Eine Aufgabe wird zu einem Spiel umfunktioniert. Also warum ist es dann kein Spiel, wenn man eine Piste an einem Hang hinunterfährt?
„Versuch’s mal, dann stoppe ich deine Zeit!“
Elfmeterschießen auf dem Schulhof ist Spiel, warum kann es also kein Spiel sein, wenn zwei Mannschaften gegeneinander antreten, auch wenn sie Trikots tragen, die sie von ihrem Klub bekommen haben?
Im Ski Alpin gibt es viele Beispiele von Vätern, die alles dafür tun, dass ihr Kind möglichst gut wird. Sie kommen im Slalom viel häufiger vor als in der Abfahrt und im Super-G, weil die Speed-Disziplinen eine ganz andere Teamarbeit verlangen. Es ist nicht so einfach, dort solo zu fahren. Slalom ist ein bisschen wie Tennis, du kannst Bälle gegen eine Wand schlagen oder deinen Vater dazu bringen, am Marikollen eine Piste abzustecken, wie Henrik Kristoffersen es gemacht hat. Für Slalomfahrer kannst du eine eigene Trainingsstrecke einrichten.
Kjetil André Aamodt hat Finn. Henrik Kristoffersen hat Lars. Marcel Hirscher hat Ferdinand.
Marcel war Österreichs großer Alpinstar, bis er im Spätsommer 2019 seinen Rücktritt bekannt gab. Er hat mehr Weltcupsiege geholt als irgendein anderer Alpinfahrer, abgesehen von Ingemar Stenmark. Das ist vielleicht kein Zufall, denn sein Vater ist ein echter Perfektionist. Manchmal konnte Ferdinand Hirscher so dicht dabei sein, wenn sein Sohn fuhr, dass er sich beinahe auf der Piste befand. Und wenn Marcel nach dem ersten Lauf führte, kam sein Vater direkt hinter ihm herbei und drückte ihn, fast noch bevor er die Ziellinie überquert hatte.
Ich habe viele solcher Vater-Sohn- oder Vater-Tochter-Beziehungen gesehen. Es ist nicht sicher, dass es den Kindern schadet, aber ich habe oft darüber nachgedacht, dass viele von ihnen keine Einzelkinder sind. Sie haben Geschwister, und wie viel Zuwendung bekommen diese, wenn der Vater seine gesamte Zeit dem Bruder oder der Schwester widmet, damit er oder sie Weltmeister wird? Falls er das tut, verbraucht er dabei nicht auch seine ganze Energie?
Das ist eine Geschichte, die selten erzählt wird.
Ich glaube nicht, dass ich ein solcher Vater werden möchte, wenn ich selbst Kinder bekomme. Wenn die Kinder sich sehr für eine Sportart interessierten, würde ich versuchen, es so einzurichten, dass sie so viel Zeit damit verbringen könnten, wie sie wollten. Ich würde denken: Wenn du Lust hast, diesen Sport auszuüben, dann sollst du so trainieren können, dass du die Möglichkeit erhältst, gut zu werden. Wenn es sich ums Skilaufen drehte, würde ich es so einrichten, wie Mutter und Vater es für Simen und mich taten.
Ich glaube nicht, dass ich enttäuscht wäre, wenn sich zeigte, dass meine Kinder sich überhaupt nicht für alpines Skifahren interessierten. Doch wenn sie erklärten, dass sie gut werden wollten, aber keine Lust auf Training hätten, dann wäre ich enttäuscht.
Ich würde sie ein bisschen herausfordern.
Du sagst, du willst gut werden? Super! Dann fahren wir zum Varingskollen, nehmen etwas zu essen und zu trinken mit, und dann trainieren wir.












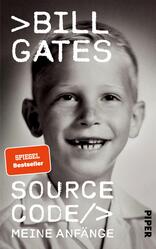
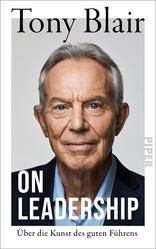

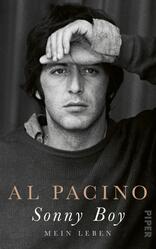



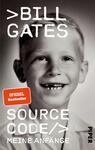

DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.