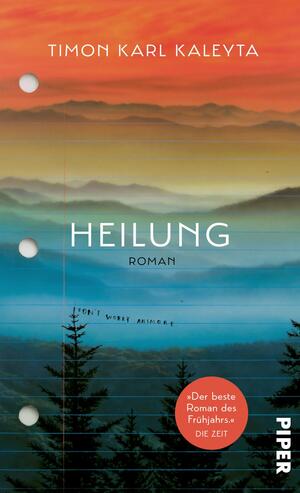
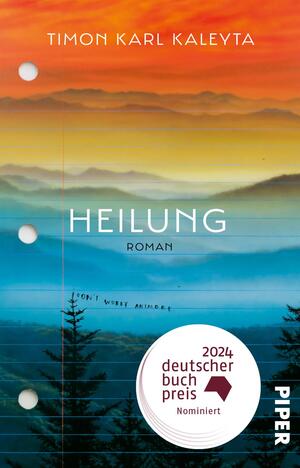
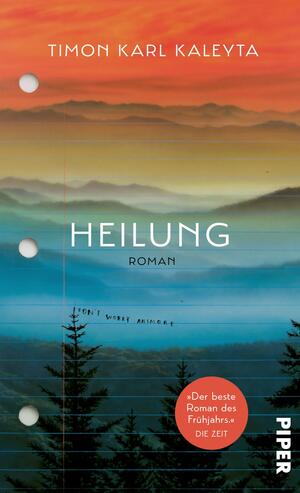
Heilung Heilung Heilung - eBook-Ausgabe
Roman
— Nominiert für den Deutschen Buchpreis 2024„Kaleytas Protagonist wandelt auf seiner Reise durch die verschiedenen Facetten einer Selbstfindungsobsession des Gegenwartsmenschen.“ - Der Spiegel
Heilung — Inhalt
Nominiert für den Deutschen Buchpreis 2024
Ein dubioses Spa, ein entkräfteter Mann und die Frage, was es heute bedeutet, glücklich zu sein
Ein Mann kann nicht mehr schlafen. Mit den Kräften am Ende, fürchtet er, alles zu verlieren: seine Ehe, seinen Status, das Leben. Seine Frau Imogen schickt ihn ins San Vita, ein mysteriöses Nobelresort in der verschneiten Stille der Dolomiten. In Obhut von Prof. Trinkl soll er dort zu sich selbst finden. Doch er sträubt sich aus Angst, sich in die Seele schauen zu lassen. Und zu Recht: Trinkl verspricht ihm zwar Heilung, flüstert ihm aber ein in der Vergangenheit begründetes Unbehagen ein, das die Ursache seiner Probleme sein soll.
Verängstigt und doch voller Hoffnung flieht der Mann zu seinem besten Freund aus Kindertagen. Und ahnt noch nicht, wie weit er gehen muss, um endlich von allem geheilt zu werden.
Ein überraschender Roman. Schlafwandelnd und doch hellwach. Zwischen Traum und wahrster Wirklichkeit.
„Die schönste Bergklinik der Literatur seit dem Zauberberg, mysteriöse Schlaflosigkeit und eine abenteuerliche Erstverschlimmerung. Beim Lesen beginnt die Heilung aber schon auf Seite 1. Ganz herrlich!“ – Eckhart Nickel
„Ein glänzend geschriebener, ein unterhaltsamer und intelligenter deutscher Roman, das hat man nicht alle Tage“ – Denis Scheck über „Die Geschichte eines einfachen Mannes“
„Der beste Roman des Frühjahrs“ – Die Zeit
Leseprobe zu „Heilung“
Rund um das Außenbecken lag meterhoch Schnee. Die Gipfel der Berge ragten nach allen Seiten hin in den sich bereits verdunkelnden Nachmittagshimmel. Es war kaum ein Laut zu hören, die Bäume schluckten jedes Geräusch, nur in meinen Ohren pochte nach den Behandlungen des Tages das Blut im Takt meines Pulses. Ich glitt in das warme, salzige Wasser und tauchte unter.
Schon seit Tagen fiel der Schnee ohne Unterlass aus den Wolken, es war einer der kältesten Winter der vergangenen Jahrzehnte. Große Teile Europas lagen unter einer dichten weißen Decke. Auch [...]
Rund um das Außenbecken lag meterhoch Schnee. Die Gipfel der Berge ragten nach allen Seiten hin in den sich bereits verdunkelnden Nachmittagshimmel. Es war kaum ein Laut zu hören, die Bäume schluckten jedes Geräusch, nur in meinen Ohren pochte nach den Behandlungen des Tages das Blut im Takt meines Pulses. Ich glitt in das warme, salzige Wasser und tauchte unter.
Schon seit Tagen fiel der Schnee ohne Unterlass aus den Wolken, es war einer der kältesten Winter der vergangenen Jahrzehnte. Große Teile Europas lagen unter einer dichten weißen Decke. Auch jetzt schneite es, und als ich nach ein paar Sekunden wieder auftauchte, den Kopf in den Nacken legte und mir die Haare zurückstrich, fielen dicke Flocken auf mein Gesicht, wo sie augenblicklich schmolzen.
Ich ließ mich einige Minuten lang treiben, starrte hinauf in den rauschenden Himmel und atmete ein und aus. Wenn meine Ohren dabei für ein paar Sekunden lang untertauchten, hörte ich ein tiefes Dröhnen. Über der Wasseroberfläche war wieder alles still.
Als ich mich nach einer Weile in Bauchlage drehte und in Richtung Aufgang schwamm, legte eine Frau von vielleicht Mitte dreißig ihren Bademantel ab und stieg mit federnden Schritten unmittelbar vor mir ins Wasser. Ich sah, dass ihre Wangen und ihre Stirnpartie von einer vermutlich gerade beendeten kosmetischen Anwendung glühten. Ihr Körper war durchtrainiert, drahtig, doch anmutig, und als sie mir scharf in die Augen sah, wandte ich meinen Blick abrupt ab, um ihr zu erkennen zu geben, dass ich ihre Nacktheit keinen Moment zu lang betrachten würde. Ich trocknete mich in der klirrenden Kälte ab, streifte mir den Bademantel über, und erst als ich die Tür zum Innenbereich öffnete, drehte ich mich noch einmal kurz nach ihr um – die Frau schwamm langsam, ich sah nur ihren über das Wasser dahingleitenden Hinterkopf.
Tags zuvor war ich auf Anraten meiner Frau Imogen hierhergereist. Hoch in die Berge Südtirols, ins San Vita, ein luxuriöses Gesundheitsresort, das erst vor rund zwei Jahren eröffnet hatte und mit seinem ganzheitlichen Ansatz aus Naturheilkunde und Spitzenmedizin seither international für Aufsehen sorgte. Auf der minimalistischen Webseite stand nur ein einziger Satz, dunkelgrau auf weiß: Länger besser leben.
Imogen hatte entschieden, dass ich meinem Problem, das längst zu unserem Problem geworden war, dass ich meinem „Zustand“, wie sie es nannte, noch einmal anders begegnen müsste. Dass nur hier, in den Dolomiten, auf 1500 Metern Höhe, abgeschottet von den Ablenkungen des Alltags, eine Lösung gefunden werden konnte.
„Du musst es versuchen“, hatte sie noch am Tag der Abreise gesagt und meine Hände mit ihren umfasst. „Gib Professor Trinkl und seinem Team zumindest die Chance, dir zu helfen!“
Seit Wochen wehrte ich mich dagegen, machte ihr Vorwürfe, verlor immer wieder die Nerven. Ich glaubte nicht daran, dass Prof. Trinkl mir würde helfen können, aber dass ich meiner Frau so ablehnend und gereizt begegnete, war selbstverständlich bereits Teil meines Problems, das weiß ich jetzt.
Mein „Zustand“ hatte sich vor drei Jahren schleichend eingestellt. Immer früher am Tag überfiel mich eine entsetzliche Müdigkeit. Eine Müdigkeit, so umfassend, dass sie all meine Gedanken lähmte, so erdrückend, als hinge eine schwere Bleischürze über meinen Schultern.
Wie ein dem Leben entrissener Geist stand ich morgens mit dunklen Augenhöhlen vor dem Spiegel. Innerhalb weniger Wochen verlor ich sieben Kilo an Gewicht, ich hatte kaum noch Appetit. Die Hosen rutschten mir von den Hüften, die Hemden wehten um meine Schultern, und sosehr ich es auch ignorieren wollte, schon gegen Mittag ließ ich mich wieder auf das Tagesbett in unserer Küche fallen. Dort glitt ich in ein mehrstündiges Dösen, aus dem ich viel zu spät völlig orientierungslos hochschreckte. Und es dauerte ein, zwei Minuten, bis ich wieder wusste, wer oder wo ich war.
Monatelang tat ich die Müdigkeit ab und versuchte, ihr beizukommen, indem ich immer noch etwas früher zu Bett ging. Doch als auch nach zwölf Stunden Nachtruhe keine Besserung eintrat, als ich, je mehr ich schlief, immer nur noch träger wurde, ahnte ich, dass etwas Grundlegendes ins Rutschen gekommen war.
„So geht es nicht weiter. Wir müssen was tun“, höre ich Imogen noch heute sagen. Und es war die Sorge in ihrem Ausdruck, die Strenge, mit der sie mir bedeutete, endlich etwas zu unternehmen, die meinen Trotz weckten. Lange Zeit verbat ich ihr, das Thema anzusprechen. Ich war sicher, mein Zustand würde genauso schnell und unvermittelt wieder verschwinden, wie er gekommen war.
Erst nach über einem Jahr ohne Besserung erklärte ich mich bereit, mir helfen zu lassen. Doch je mehr Spezialisten ich aufsuchte, je präziser ich ihnen meine Symptome schilderte und je gründlicher sie mich untersuchten, desto eindeutiger geriet am Ende die Diagnose: Ich war nicht krank. Mir fehlte nichts.
An manchen Tagen schaffte ich es nicht mehr aus dem Bett, ich ließ mich hängen, und an den Abenden, wenn Imogen nach ihrer Arbeit langsam zur Ruhe kam, saßen wir wortlos beieinander, ehe wir zu Bett gingen. Später hörte ich sie manchmal leise in ihrem Zimmer weinen. Was war bloß über mich gekommen, fragte ich mich, bis der Aufenthalt in einem Schlaflabor eine erste Antwort lieferte.
„Hier, sehen Sie … Diese Kurve zeigt es ganz deutlich“, sagte der Somnologe und deutete auf einen Graphen, der sich spitz über Millimeterpapier schlängelte. „Sie finden nicht in den Tiefschlaf. Kein einziges Mal. Wirklich erstaunlich.“
Ich schaute ihn fragend an.
„Und leider auch besorgniserregend. Dafür ist das menschliche Gehirn nicht gemacht.“
„Und das heißt?“
„Na ja, das Gehirn … es braucht seine Ruhephasen.“
„Aber ich schlafe eigentlich gut.“
Der Arzt schaute sich die Ergebnisse noch einmal genauer an.
„Na gut, dann frage ich anders. Können Sie mir sagen, wann Sie zum letzten Mal geträumt haben?“
Seltsamerweise konnte ich mich nicht entsinnen.
„Experimente an Ratten haben gezeigt, dass die Tiere nicht länger als eine Woche überleben, wenn man ihnen das Träumen nimmt“, führte er aus. „Sie verlieren den Verstand und verenden schließlich.“
„Wovon träumen Ratten?“, fragte ich zurück, bekam aber keine Antwort.
Stattdessen zeigte er mir eine Videoaufzeichnung der untersuchten Nacht. Darauf war zu sehen, wie ich, ohne selbst Notiz davon zu nehmen, alle zehn bis fünfzehn Minuten wach wurde, den Kopf hob, die Augen aufriss, nervös die Bettseite wechselte und wieder einschlief – so ging das die ganze Nacht, eine einzige Raserei.
„Sie finden keine Entspannung“, sagte er, „etwas blockiert. So etwas wie Sie habe ich, ehrlich gesagt, noch nie gesehen.“
„Schön und gut, aber was können wir tun?“
„Wir müssen, nein, Sie müssen die Ursache für diese Blockade finden. Und sie beseitigen …“ Er legte die Stirn in Falten und sah mich an. „Ich bin zwar kein Therapeut, aber möglicherweise gibt es da, grob gesprochen, etwas, das Sie beschäftigt?“
„Nein“, entgegnete ich.
„Irgendein Problem?“
Ich schüttelte den Kopf.
„Belastet Sie etwas? Eine Veränderung? Eine schwere Aufgabe? Haben Sie Angst?“ Er trat ganz nah an mich und sprach im Vertrauen zu mir. „Probleme finanzieller Natur? Wissen Sie, das ist keine Schande.“
Ich schloss die Augen. „Nein“, sagte ich ruhig. „Geld ist kein Problem. Meine Frau und ich … Wir …“ Ich wollte den Satz nicht zu Ende führen. „Uns geht es gut.“ Ich unterdrückte ein Gähnen.
„Na dann, wenn Sie keine Probleme haben … Vielleicht müssen Sie einfach Ihr Leben ändern?“
Da ich der festen Überzeugung war, dass man Probleme ausschließlich mit sich selbst auszumachen hat, begann ich, Sport zu treiben. Ich stellte meine Ernährung um, verzichtete auf Fleisch, trank mehrere Liter Wasser am Tag, hörte mit dem gelegentlichen Rauchen auf und veränderte fast sämtliche meiner Gewohnheiten. Und doch verschlechterte sich mein Zustand. Ja, es kam mir sogar so vor, als wäre diese Verschlechterung gerade deswegen eingetreten, weil ich mit jemandem darüber gesprochen hatte, als wäre es bereits ein Fehler gewesen, der Sache überhaupt auf den Grund gehen zu wollen, anstatt darauf zu vertrauen, dass alles irgendwie gut werden würde.
Inzwischen wachte ich jede Nacht mehrfach auf, war mit einem Mal hellwach und fand bis zum frühen Morgen nicht wieder in den Schlaf. Um Imogen mit meiner Unruhe nicht zu belästigen, schliefen wir in getrennten Zimmern, und nicht selten verließ ich nach Mitternacht unsere Wohnung und fuhr mit dem Aufzug hinunter in die Tiefgarage, setzte mich in unser Auto, schaltete die Klimaanlage ein und lauschte bis zum Morgengrauen dem nächtlichen Radioprogramm. Und manchmal döste ich dabei sogar für ein paar Momente ein.
Innerhalb von zwei Jahren war ich für Imogen zu einer Last geworden. Ich sehe das inzwischen ganz klar. Und sooft ich mir auch vornahm, dass mit dem kommenden Tag alles anders werden würde, sowenig war ich im Alltag noch imstande, so etwas wie Normalität aufrechtzuerhalten. Eine Normalität, die Imogen allerdings für ihre berufliche Tätigkeit dringend benötigte.
„Vielleicht brauchst du therapeutische Hilfe?“, probierte es meine Frau. „Kann doch sein?“
„Fängst du jetzt auch noch damit an?“
„Es ist keine Schande, zu einem Psychologen zu gehen. Ich kenne Hunderte Leute, die das tun.“
„Verschone mich bitte mit diesem Unsinn!“ Entgegen meiner Natur wurde ich immer aggressiver.
„Oder … es sind die Hormone?“
„Kann sein“, bemühte ich mich.
„Vielleicht klappt es ja deswegen nicht bei uns“, sagte Imogen, und ich verstand ihre Andeutung sofort. „Vielleicht hängt alles miteinander zusammen?“
„Vielleicht“, sagte ich, doch in Wahrheit hatte ich aufgegeben. Ich glaubte nicht mehr daran, dass ich meine Schlafstörung und alles, was damit einherging, in den Griff bekommen würde. Viel eher wollte ich mich damit arrangieren, so wie ich es immer getan hatte, wenn ich mich mit einem Problem konfrontiert sah. Ich würde mich an den Zustand gewöhnen, das Beste daraus machen und lernen, damit umzugehen – insgeheim fürchtete ich mich jedoch vor dem Tag, an dem Imogen erkannte, dass sie ohne mich besser dran war.
Dieser Tag allerdings war noch nicht gekommen. Mindestens eine Woche, besser zwei oder drei, würde ich nun bei Prof. Trinkl in den Bergen verbringen. Imogen hatte bei einem Abendessen ihres Galeristen erstmals vom San Vita erfahren, sie hatte aus erster Hand von Menschen gehört, die, wie es hieß, von Grund auf verändert von dort zurückgekehrt waren. Und obwohl ich ihr zu verstehen gab, dass ich die Kosten für Aufenthalt und Behandlung entschieden zu hoch fand, obwohl ich sie davor warnte, mich im San Vita heimlich einer Seelenschau unterziehen lassen zu wollen, ließ sie keine Widerrede gelten und arrangierte alles.
„Sei unbesorgt, es ist etwas anderes“, sagte Imogen bei meiner Abreise. „Im San Vita ist alles anders.“
Ich musste zumindest so tun, als würde ich daran glauben. Es war meine letzte Chance. Und so war ich gegen meinen erklärten Willen hierhergekommen.
Bedingt durch die extreme Witterung erreichte ich den winzigen Bahnhof in Terlan erst mit drei Stunden Verspätung. Es war bereits stockfinster. Als einziger Passagier stieg ich aus und sah in dem dichten Schneegestöber die Hand kaum vor Augen. Ich versuchte, das Resort telefonisch zu erreichen, doch eine Verbindung ließ sich nicht herstellen.
Plötzlich sah ich, zunächst schemenhaft, dann immer deutlicher, eine gedrungene, winzige Gestalt auf mich zukommen.
„Verzeihung?“, rief ich ihr zu, da war sie schon ganz dicht an mich herangetreten, lächelte und streckte die Hand nach meinem Gepäck aus.
„Darf ich?“
Der Mann war beinahe so breit wie hoch, er erinnerte mich an einen Zwerg. Ich nickte.
„Schön, dass Sie es geschafft haben. Wir haben uns bereits Sorgen gemacht“, sagte er mit einer gepressten Stimme, in seinem Bart glitzerten ein paar Eiszapfen. „Wenn Sie mir bitte folgen wollen? Es ist nicht weit.“
Mit festem Schritt stapfte er voraus, meine Reisetasche über seine rechte Schulter geworfen, das dichte Fell seiner Kapuze wippte vor mir auf und ab.
„Sie haben hier aber nicht seit drei Stunden auf mich gewartet?“, rief ich ihm zu und lachte, und er drehte sich um und lachte nur zurück, da erreichten wir die schmale Straße. „Bitte verzeihen Sie die Umstände.“ Er deutete auf einen uralten roten Fiat Panda, der mit laufendem Motor im gelben Licht einer Laterne stand. „Mit schwereren Autos kommen wir nicht gut durch die Serpentinen.“
„Natürlich“, antwortete ich und zwängte mich auf die Rückbank, während der kleine Mann meine Tasche im Kofferraum verstaute.
Die Fahrt dauerte etwa eine halbe Stunde. Draußen vor dem Fenster war nicht das Geringste zu erkennen. Mein Fahrer sprach kein Wort mehr, und auch ich stellte keine Fragen. Einmal stöhnte er leise und riss hektisch das Lenkrad herum, ohne dass das Auto eine besondere Wende gemacht hätte. Erst jetzt bemerkte ich, dass mit seinem linken Arm etwas nicht stimmte. Er lenkte und schaltete nur mit der rechten Hand.
Wir glitten dahin. Ich hatte mich in losen Gedanken verloren, als wir wie aus dem Nichts zum Stehen kamen und im Scheinwerferlicht des Fiat ein schweres Eisentor aufschwang. Vor uns lag die hell erleuchtete Einfahrt einer Tiefgarage, die unmittelbar in den Berg hineinführte.
Noch in dem Moment, da ich aus dem Wagen stieg, nahm mich eine Ärztin im weißen Kittel in Empfang. Sie führte mich aus der kargen Garage hinaus in ein Treppenhaus und weiter ins Atrium. Überall knarzte das Holz, das Licht war warm und wohlig, es duftete nach Zirbe und aromatischen Ölen.
„Im Namen von Professor Trinkl heiße ich Sie herzlich willkommen. Hatten Sie eine gute Reise?“
Ich lächelte verkniffen.
„Sie haben gleich Gelegenheit, sich auszuruhen“, sagte sie. „Wir müssen nur noch rasch einen Blick auf Sie werfen. Es geht auch ganz schnell.“
In einer Art Aufnahmezimmer legte ich hinter einem Paravent meine Kleidung ab und gab sie mitsamt meinen Wertgegenständen in eine weiße Kunststoffbox. Auch mein Telefon durfte ich nicht bei mir behalten. Stattdessen fand ich später auf dem Sekretär meiner Hütte einen Füllfederhalter, mit dem ich rund um die Uhr Nachricht und Empfänger auf einen Bogen Papier notieren konnte, um, sobald eine Antwort vorlag, diese, ebenfalls handschriftlich, zugestellt zu bekommen.
Lediglich meine goldene Armbanduhr behielt ich an – Imogen hatte sie mir vor ein paar Jahren gekauft, eine kleine Überraschung, und ich hatte sie seither kein einziges Mal abgelegt. Ich streifte die bereitliegende Unterwäsche aus angenehm weicher Baumwollgaze über und trat halb nackt hinter dem Paravent hervor.
Ich durchlief ein Belastungs-EKG sowie eine Koloskopie, eine Assistentin maß meinen Puls und Blutdruck und schloss mich zur Überprüfung der Lungenfunktion an eine mit zahlreichen Schläuchen und Pumpen versehene Maschine an. Schließlich schoben mich zwei Pfleger der Länge nach in einen Kernspintomographen. Nachdem ich all diese Tests hatte über mich ergehen lassen, gab ich eine Harn- und Stuhlprobe ab, wurde für die erste Nacht mit zwei Sensoren an den Schläfen versehen, und zuallerletzt nahm man mir drei Ampullen Blut ab, sodass mir beim Aufstehen kurz schwarz vor Augen wurde.
„Damit haben Sie das Unangenehmste auch schon hinter sich“, sagte die Ärztin mit einem Lächeln, „ab jetzt geht es nur noch bergauf.“ Und dann gingen wir gemeinsam meine Termine für die kommenden sieben Tage durch. Ein straffer Zeitplan der Säuberung und Regeneration lag vor mir, der – wie sie es ausdrückte – vollständigen Neuorganisation meiner Selbstheilungskräfte.
Es fiel mir schwer, mich auf all ihre Erklärungen zu konzentrieren. Doch ich nickte verständig, tat nach der langen Reise ganz einfach, was sie von mir verlangte, und verschwand im Anschluss an ein leichtes Abendessen, bei dem ich nur etwas gedünstete Forelle und zwei kleine Salzkartoffeln zu mir nahm, in meine Holzhütte, wo mich bereits eine handschriftliche Nachricht von Imogen erwartete.
Wenn du das hier liest, hast du schon viel geschafft. Ich bin unglaublich stolz auf dich. Die Leute sagen, Professor Trinkl könne zaubern. Es heißt, er blicke direkt in die Menschen hinein und nehme sie als sie SELBST wahr!
Bitte lass es einfach geschehen. Und dann kommst du geheilt wieder zurück. Abgemacht?
Nichts versetzte mich zu jener Zeit in größere Panik als die Vorstellung, jemand könnte in mich hineinsehen. Trotzdem machte ich mich gleich an eine Antwort und schrieb, einerseits, weil es der Wahrheit entsprach, andererseits, weil ich wusste, dass Imogen es von mir erwartete, zwei kurze Sätze auf das bereitliegende Papier:
Ich liebe dich. Und: Das werde ich.
Die erste Nacht im San Vita verbrachte ich in gewohnter Nervosität. Ich fand in dem riesigen Zirbenholzbett, unter den schweren, gestärkten Oberbetten, keine Ruhe. Mitten in der Nacht wachte ich auf, und nach ein paar Momenten der Orientierung nahm ich die Beißschiene aus dem Mund, ging barfuß über die warmen Holzdielen zum Fenster und schaute hinaus in die eisklare Nacht.
Hier und da flackerte noch Licht in den anderen Hütten, die sich rund um einen kleinen, vermutlich künstlich angelegten See reihten. Aus ihren Schornsteinen stieg dünner Rauch auf, sonst regte sich weit und breit nichts. Der Schneefall hatte ausgesetzt, ein greller Vollmond stand hoch am Himmel, nur ganz langsam zogen einzelne Wolken an ihm vorbei, und erst jetzt erkannte ich, dass das Resort von dichtem Wald umgeben war.
Alles im San Vita war zur Ruhe gekommen. Ich warf mir eine Wolldecke über, schlüpfte in die samtenen Hausschuhe und trat hinaus auf die Terrasse. Mein Atem schlug aus. Irgendwo rief ein Kauz. Dann wieder Stille. Ich verlor mich in Gedanken, als ich plötzlich ein Knacken im Unterholz hörte. Etwas kam langsam aus dem Wald und näherte sich über die geschlossene Schneedecke dem Haupthaus. Ich sah eine dunkle Gestalt, die ein totes Tier hinter sich herzog und dabei eine tiefe Spur hinterließ. Vor einem der Seitenflügel blieb sie stehen, öffnete eine in den Boden eingelassene Tür und verschwand die Treppe hinunter – und ich meinte zu hören, wie der Kopf des Tieres Stufe für Stufe dumpf auf Beton schlug.
Erst kurz vor Sonnenaufgang schlief ich noch einmal ein.
Am kommenden Tag warteten schon Termine auf mich. Nach dem Frühstück hatte ich bereits eine Telomerlängenmessung zur Bestimmung meines biologischen Alters über mich ergehen lassen und mich im Anschluss ein paar Stunden mit Dampfbädern, Saunagängen und Solebädern beruhigt. Nun würde ich Prof. Trinkl erstmals persönlich kennenlernen und mit ihm meine Labor- und Testergebnisse durchgehen. Für alle Gäste stellte das Aufeinandertreffen mit Trinkl eine besondere Erfahrung dar, so viel hatte ich im Vorfeld verstanden. Und obwohl ich mich innerlich noch immer dagegen wehrte, obwohl ich auf die raunende Bewunderung gegenüber dem Professor nicht das Geringste gab, obwohl ich ausschließen konnte, dass hier, an diesem Ort, die Lösung meines Problems auf mich wartete, so bewirkte, nach allem, was ich heute weiß, allein die Luftveränderung, vielleicht die ausgezeichnete Forelle am Vorabend, vielleicht die Massage gleich nach dem Mittagessen oder die allgemeine Zugewandtheit, mit der mir begegnet wurde, bereits eine kleine Verschiebung meiner Wahrnehmung.
Doch das gestand ich mir zu diesem Zeitpunkt noch nicht ein. Ganz im Gegenteil.
Der Professor erwartete mich in seinem Zimmer, das im zentral gelegenen Hauptgebäude zu finden war. Die gesamte Anlage war durch ein unterirdisches Tunnelsystem verbunden. Man trat aus seiner Hütte hinaus ins Freie, dann ein paar Stufen hinab in ein Netz aus Gängen, das einen zu den Behandlungen leitete, ohne dass man sich Wind und Wetter aussetzen musste. Anders als die Behandlungsräume der Assistenzärzte aber, die klinisch modern gestaltet waren, weiß, hell erleuchtet und mit spiegelnden Oberflächen, empfing mich der Professor in einer Art Salon. Flammen tanzten in einem Kamin, die holzvertäfelten Wände sorgten für einen wohligen Klang, und Trinkl saß in einem Ohrensessel vor einem beeindruckenden Bücherregal und kraulte den Kopf eines Berner Sennenhundes, der gutmütig vor seinen Füßen auf einem Fell lag und vor sich hin döste.
Ich stand in der Tür und klopfte zweimal fest gegen das Holz.
„Guten Abend“, sagte ich.
Langsam erhob sich Prof. Trinkl und drehte sich in meine Richtung. Er war groß, bestimmt ein Meter neunzig, in jedem Fall größer als ich. Er trug einen steifen weißen Kittel, darunter Jeans und an den Füßen ausgetretene Wildlederloafer. Seine Haare waren voll, leicht ergraut und lockig – ich schätzte ihn auf um die sechzig, und dennoch machte er einen agilen, athletischen Eindruck. Gewiss, dachte ich, wäre er in der Lage, mich zu überwältigen.
„Guten Abend, treten Sie ein.“ Er machte eine einladende Geste.
Ich zog den Gurt meines Bademantels fest und schritt in meinen Pantoffeln lautlos über die auf dem Tafelparkett ausgelegten Läufer. An einem Sekretär in der Ecke saß eine weiß gekleidete junge Frau und begann augenblicklich, in einen Computer zu tippen.
Prof. Trinkl kam mit einem breiten Lächeln auf mich zu. Er hatte einen festen Händedruck. Auch ich drückte entschieden zu, und je länger wir uns die Hände schüttelten, desto fester und fester geriet unser Griff.
„Und? Wie gefällt es Ihnen bei uns?“, fragte Trinkl.
„Gut“, sagte ich knapp und erwiderte sein Lächeln.
„Haben Sie sich schon eingelebt?“
„Ja“, sagte ich.
Trinkls Augen waren gütig, und doch erkannte ich in ihnen von der ersten Sekunde an den Wunsch, in mich einzudringen.
„Wunderbar. Das höre ich gern. Und …“ Er machte eine Pause. „Wie war Ihre erste Nacht?“
Für einen Moment war ich irritiert, ließ im Griff etwas nach, was der Professor erkannte, und sogleich lockerte auch er seinen Händedruck.
„Wissen Sie, die Sache ist, ich …“, wollte ich zu einer Antwort ansetzen, da unterbrach er mich.
„Lassen Sie gut sein, das war eine Fangfrage“, sagte er und ließ meine Hand nun los. „Natürlich haben Sie schlecht geschlafen. Deswegen sind Sie ja hier, nein?“
Trinkl wandte sich ab und durchmaß in aller Seelenruhe den Raum, bis er vor dem Fenster zum Stehen kam.
„Kommen Sie“, rief er mir zu. „Lassen Sie uns ein wenig plaudern.“
„Sollten wir nicht über meine Testergebnisse sprechen?“, fragte ich zurück. „Ich meine, darum geht es doch.“
Trinkl lachte. „Gewiss, gewiss“, sagte er. „Aber warum die Eile? Wir haben alle Zeit der Welt.“
Ich trat zu ihm ans Fenster, er deutete nach draußen. Die gesamte Anlage leuchtete in bernsteinfarbenem Licht, wie heiße Quellen unterbrachen die verschiedenen Badestellen den Schnee.
„Hübsch, nicht wahr?“
Ich zuckte mit den Schultern und nickte. „Ja, natürlich.“
Trinkl lächelte und hielt dann, ohne hinzusehen, der Assistentin seine offene Hand entgegen. „Schön.“
Die Frau reichte ihm eine Akte. Trinkl warf einen Blick hinein, ging entspannt die eingelegten Blätter durch und machte dabei ein paar Brummgeräusche. Urplötzlich verzog er das Gesicht, als hätte ihn ein Schmerz durchfahren, dann klappte er die Akte wieder zu.
„Schlechte Nachrichten?“, fragte ich verunsichert.
„Nein“, sagte Trinkl. „Ganz und gar nicht. Jedenfalls, nicht im herkömmlichen Sinne.“ Er musterte mich von oben bis unten, nahm meine Hand, befühlte meinen Puls und ließ sie wieder los. „Erzählen Sie doch mal: Was hat Sie hierhergeführt?“
„Ich hatte gehofft“, ich stockte, „meine Frau hatte gehofft, Sie könnten mir helfen. Bei meinem Schlafproblem.“
„Ha!“, rief Trinkl. „Ich hab’s gewusst. Das ist das Problem. Natürlich!“
„Welches Problem?“
„Sie sind noch nicht wirklich hier. Sie fühlen es nicht“, sagte Trinkl laut, doch ohne jede Spur von Aggressivität. „Sie lassen sich nicht richtig auf unser Angebot ein. So etwas haben meine Leute schon angedeutet. Sie wehren sich. Im Grunde genommen wehren Sie sich seit dem Moment, da Arnim Sie am Bahnhof aufgelesen hat. Übrigens: Ein wunderbarer kleiner Mensch, finden Sie nicht?“ Trinkl drückte seine Stirn an die Scheibe. „Ach, schauen Sie, da unten! Da ist er ja!“
Ich sah ebenfalls hinunter und versuchte, in dem schummrigen Licht etwas zu erkennen. „Was macht er denn da?“, fragte ich.
„Er fällt einen Baum“, sagte Trinkl und schmunzelte. „Der Mann ist ein Faszinosum. Man weiß nie, womit er gerade beschäftigt ist und warum, manchmal sehe ich ihn tagelang nicht. Und doch ist er da. Immer und überall. Hält seine Augen und Ohren wach. Ohne ihn wären wir alle verloren.“
Ich nickte nur.
„Aber zurück zu Ihnen. Also, was genau missfällt Ihnen hier?“
„Wissen Sie“, ich wog jedes Wort genau ab, „ich war in den letzten Jahren bei sehr vielen Spezialisten. Ich bin, wie soll ich sagen, nicht mehr besonders hoffnungsfroh, was …“
„Sie waren aber noch nicht im San Vita!“, fiel mir Trinkl mit erhobenem Zeigefinger ins Wort. „Sie waren noch nicht im San Vita.“ Er legte die Akte auf den Sekretär, ging zum Kamin, erweckte die Glut mit einem Schüreisen zum Leben und legte zwei Scheite Holz nach. „Was glauben Sie“, fragte er nun aus einigen Metern Entfernung, „ist der Unterschied zwischen einem gewöhnlichen ›Krankenhaus‹ und uns?“
Ich legte einen interessierten Gesichtsausdruck auf. „Verraten Sie es mir.“
„Gern. Passen Sie auf“, entgegnete Trinkl. „In ein Krankenhaus … oder sagen wir: In eine Klinik – das klingt besser – kommen die Menschen, weil ihr Leben ein Ende zu nehmen droht, ein Unfall, eine schwere Krankheit et cetera. Diese Menschen glauben allerdings, noch nicht an der Reihe zu sein. Sie wollen den Tod noch ein kleines bisschen hinauszögern. Aber seien wir ehrlich, was ist das für ein unwürdiges Unterfangen für alle Beteiligten? So viel Hoffnung, so viel Leid, so viel Ernüchterung.“
„Hm“, sagte ich.
„Zu uns aber kommen die Menschen aus einem anderen Grund. Sie kommen, weil ihr Leben erst so richtig losgehen soll. Das ist der Unterschied.“ Er machte eine bedeutungsvolle Pause. „Ins San Vita kommen Menschen, die wissen, dass sie gesund sind. Sie haben bereits die besten Ärzte der Welt aufgesucht. Und nun wollen sie von uns bestätigt bekommen, dass auch darüber hinaus alles in Ordnung ist. Sie wollen, wie soll ich sagen, von einem unguten Gefühl befreit werden, von einem Unbehagen, das sie belastet.“
„Ein Unbehagen?“
„Ja, und dieses Unbehagen nimmt zu, ganz allgemein. Verstehen Sie?“
Ich hörte die Assistentin tippen, der riesige Hund rollte sich im Schlaf auf die Seite.
„Ich verstehe, ehrlich gesagt, überhaupt nichts von dem, was Sie mir sagen wollen … Ich finde sogar, Sie reimen sich da eine ganze Menge zusammen. Ein Unbehagen? Ein ungutes Gefühl?“, fragte ich fast grob.
„Ganz ruhig“, sagte der Professor und lächelte. Das Tippen pausierte, die beiden warfen sich einen verschwörerischen Blick zu. „Wir fangen noch einmal ganz von vorn an, in Ordnung?“ Trinkl zeigte mit dem Finger auf meine Akte. „Ihre Ergebnisse sind eindeutig: Sie sind kerngesund. Ich gratuliere.“ Er deutete eine Verbeugung an. „Ihr Blut. Ihr Gehirn. Ihr Herz. Ihre Leber. Ihre Lunge. Ihr Urin. Ihr Stuhl – gerade Ihr Stuhl … Das sieht alles gut aus. Sehr gut sogar. Sie sind bis ins letzte Glied Ihres Genoms und Ihres Körpers ohne gravierende Fehler. Gut, Sie haben ein paar allergische Dispositionen, wenn ich das richtig deute, aber wer hat die nicht? Wer hat die nicht …“ Trinkl lachte trocken auf. „Nichts, also wirklich gar nichts in Ihnen fällt aus der Ordnung. Keine Entzündungen. Keine Wucherungen. Keine Anzeichen für den geringsten Verfall – dabei sind Sie schon jenseits der vierzig. Da ist einfach nichts, was einem normalen Arzt Sorgen bereiten würde.“
„Gut“, sagte ich. „Aber das weiß ich bereits.“
„Sehen Sie! Genau das meinte ich. Und es kommt noch besser, unsere Untersuchungen haben ergeben, dass Sie biologisch gesehen im Körper eines Einunddreißigjährigen stecken. Mit anderen Worten … Sie könnten, so wie viele andere unserer Gäste, problemlos einhundert Jahre alt werden.“
Trinkl bückte sich zu seinem Hund hinunter und kraulte ihn hinter den Ohren. „Die Frage ist nur: Wie wollen Sie diese einhundert Jahre verbringen?“
Ich spürte, wie mich mit einem Mal eine enorme Müdigkeit überkam. Die Aufregung bei der Ankunft, die großen Erwartungen meiner Frau, die Anspannung vor dem Gespräch mit Professor Trinkl hatten mich derart in Erregung versetzt, dass ich die Erschöpfung kaum bemerkt hatte. Nun aber spürte ich, dass meine Beine schwach wurden.
„Entschuldigen Sie, dürfte ich mich kurz setzen?“
„Aber ja“, sagte Trinkl und deutete auf eine olivgrüne Récamiere. Ich legte mich ungelenk darauf ab, da ich tunlichst vermeiden wollte, durch eine Unachtsamkeit delikate Körperteile zu entblößen.
„Sie sind sehr müde, nicht wahr?“, sagte Trinkl.
„Sehr müde, ja …“
Er trat zu mir und legte mir eine Hand auf die Schulter. „Drei Jahre bald, wenn ich nicht irre?“
Ich drehte ruckartig meinen Kopf zu ihm. „Woher wissen Sie das so genau?“
Er lächelte. „Ich habe mit Ihrer Frau gesprochen. Sie haben eine wunderbare, eine sehr starke Frau an Ihrer Seite. Sie können sich glücklich schätzen. Ich denke, sie liebt Sie.“
„Aber …“, wollte ich meiner Verwunderung Ausdruck verleihen, doch der Professor unterbrach mich erneut.
„Ihre Frau hat mir auch davon erzählt, wie sehr Sie beide sich ein Kind wünschen.“ Trinkl machte eine Pause. „Das hatten Sie im Anamnesegespräch mit meiner Kollegin gar nicht erwähnt. Also, dass es da auch so ein kleines Problemchen gibt.“
„Was?!“ Ich versuchte aufzustehen, aber Trinkl übte von oben einen sanften Druck auf meine Schultern aus und hielt mich so auf der Liege.
„Bitte, das ist keine Schande. Und vor allem ist es nichts, wofür Sie sich schämen müssten.“ Er begann, behutsam meine Schultern zu massieren. „Sie verkrampfen so leicht. Lassen Sie los.“
Die Müdigkeit zwang mich, meinen Widerstand aufzugeben. Ich gähnte.
„So ist es gut“, sprach er. Die Assistentin tippte noch schneller als zuvor, sie musste mittlerweile mehrere Seiten vollgeschrieben haben. „Wollen Sie denn nicht wissen, was wirklich hinter Ihrem Unglück steckt?“
„Aber mir fehlt nichts!“, sagte ich wie ein Mantra auf. „Die Medizin sagt, dass mir nichts fehlt!“
„Na!“ Trinkl wirkte geradezu erfreut. „Jetzt kommen wir dem Kern schon näher.“ Er unterbrach seine Massage, dann sprach er in fast flüsterndem Ton weiter. „Mit der Medizin ist es so eine Sache. Sie ist eine Wissenschaft. Und mit der Wissenschaft ist es ganz allgemein, na ja, ›schwierig‹“, erklärte er. „Sie kann uns, weiß Gott, nicht auf alles eine Antwort liefern. Ich meine, sehen Sie sich um.“ Er wies abermals durch die Fenster nach draußen. „Hatte man uns nicht gesagt, das alles würde schon längst ein Ende haben? Hatte uns ›die Wissenschaft‹ nicht erklärt, so etwas werde es nicht mehr geben? Den herrlichen Schnee. Die bitterkalten Nächte. Und jetzt? Sehen Sie! Es ist bald April, und die halbe Welt liegt eingefroren da. Ist das nicht wunderbar? Was sagt Ihnen Ihre Wissenschaft dazu?“
„Woher soll ich das wissen?“, gab ich zurück. „Eine Ausnahme, eine Anomalie?“
„Eine Anomalie? Mag sein, mag nicht sein“, Trinkl zuckte mit den Schultern. „Wir werden sehen. Für den Moment aber wollen wir das Wetter genießen, nein? Und seien Sie ehrlich, wünschen wir uns nicht alle, die Wissenschaftler hätten sich bloß geirrt?“
„Ich weiß nicht, worauf Sie hinauswollen.“
„Ich will sagen, dass es für den Menschen immer erst da interessant wird, wo die Wissenschaft gar nicht hinkommt – mit ihren Sensoren, ihren Messinstrumenten, ihren Lupen und Analysen. So ist es doch! Sagen Sie mir, dass es so ist!“
„Dafür, dass Sie so abfällig über die Wissenschaft reden, betreiben Sie hier aber einen enormen medizinischen Aufwand“, antwortete ich, woraufhin Trinkl einen Lacher ausstieß.
„Touché!“ Er hob in gespielter Verteidigung die Hände. „Aber wissen Sie was? Das hat alles seine Berechtigung. Wir wollen schließlich gesunde Menschen behandeln. Gesundheit ist die Voraussetzung dafür, die richtigen Fragen stellen zu können. Aber die Wissenschaft hat blinde Flecken, das ›wissenschaftliche Prinzip‹ gilt nur bis zu einem gewissen Punkt. Und an diesen sind wir beide spätestens jetzt gelangt.“ Trinkl glitt mit seinen Händen über meine Schultern hinweg und legte sie flach auf meinen Brustkorb. Dabei beugte er sich weit zu mir herunter und sprach mir ins Ohr. „Im Inneren des Menschen toben Kämpfe, von denen die Wissenschaft nicht viel zu berichten weiß, verstehen Sie? Kämpfe, die wir mit wissenschaftlichen Methoden nicht in den Griff bekommen werden.“ Er machte eine Pause. „Niemals.“
Ich spürte, dass Trinkl sich zu seiner Assistentin umdrehte und ihr etwas zu verstehen gab.
„Und jetzt schließen Sie einmal die Augen für mich.“
Widerwillig kniff ich sie zu.
„Ich habe Ihnen ja bereits von dem Unbehagen erzählt? Von dem eigentlichen Grund, warum Menschen aus aller Welt zu uns kommen.“
Ich nickte.
„Gut. Denn ich glaube, und urteilen Sie jetzt bitte nicht voreilig, ich glaube, dass auch in Ihnen ein Unbehagen sein Unwesen treibt“, sagte er mit einer gewissen Genugtuung.
„Und was soll das für ein ›Unbehagen‹ sein?“
„Um das herauszufinden, sind wir hier. Entscheidend ist allerdings, dass Sie selbst darauf kommen. Ich kann Ihnen dabei leider nur assistieren, ich kann versuchen, es Ihnen auf Ihrem Weg so angenehm wie möglich zu machen.“ Der Professor machte noch mal eine Pause. „Also … Warum nehmen Sie dieses Angebot nicht einfach an?“
Ich atmete ein und aus. Ich dachte an Imogen. An meine Wünsche. An ihre Hoffnung. Dann brach es aus mir heraus. „Sie wollen mir doch irgendwas andichten! Sie machen mich schon ganz wirr!“
Aufgeschreckt von meinem Tonfall schoss Trinkls Hund in die Höhe und bellte zweimal laut in meine Richtung. Trinkl beruhigte ihn mit einer winzigen Handbewegung, und der Hund legte sich wieder auf seinen Platz.
„Ach was! Seien Sie unbesorgt. Dafür sind andere zuständig … Mit so einem Hokuspokus geben wir uns hier nicht ab. Nicht im San Vita, nicht, solange ich hier etwas zu sagen habe.“
Beruhigt sank ich auf die Liege zurück.
„Schauen Sie“, fuhr Trinkl ruhig fort. „Jedes Unbehagen zeitigt ein anderes Symptom und hat einen anderen Ursprung. Ihr Symptom liegt klar vor uns, die Ursache dagegen versteckt sich hartnäckig … Wir müssen in Erfahrung bringen, was Sie daran hindert, wieder schlafen zu können und zu funktionieren. Denn das ist es doch, was Sie wollen, nein?“
Mich hatte nun alle Kraft verlassen, mir fielen beinahe die Augen zu.
„Halt, nicht einschlafen, nicht jetzt! Es wird gerade erst spannend.“ Er rüttelte mich an der Schulter. „Die gute Nachricht ist nämlich … Ich habe bereits eine Spur ausgemacht. Ich habe eine Idee, in welcher Richtung Sie suchen müssen. Oder anders gesagt, ich möchte Ihnen für heute eine Art Rätsel mit in die Nacht geben. Wären Sie dazu bereit?“
Ich widersprach nicht. Ich wollte den Tag nur noch hinter mich bringen.
„Schauen Sie bitte einmal hier.“ Trinkl nahm eine kleine Fernbedienung in die Hand und betätigte einen Knopf. Unmittelbar vor mir kam ein Bildschirm aus der Decke gefahren. „Sie waren heute im Dampfbad, nicht wahr?“
Ich nickte unsicher.
„Lassen Sie mich Ihnen zeigen, was mir dabei aufgefallen ist“, sagte er, und auf dem Bildschirm erschienen die Aufnahmen zweier Überwachungskameras. Die eine zeigte den Eingangsbereich vor dem Dampfbad, die zweite eine unscharfe Infrarotaufnahme aus seinem Inneren. Ich rutschte auf der Récamiere herum.
Auf dem Bildschirm waren zahlreiche Gäste zu sehen. Auch die Frau aus dem Außenbecken, vor der ich einige Stunden zuvor meinen Blick abgewandt hatte, erkannte ich wieder.
„Schauen Sie genau hin. Trauen Sie sich“, sagte Trinkl. „Alles ist ganz normal. Die Menschen erreichen das Dampfbad, legen ihre Bademäntel ab, hängen sie auf, treten ein, nehmen den Wasserschlauch, da! Schauen Sie hin, die Leute setzen sich auf den erstbesten Platz und genießen ihre Anwendung. Ganz normal also.“
Ich wollte gerade etwas erwidern, als er mir schon im Ansatz das Wort abschnitt. „Und jetzt kommen Sie. Sie schleichen sich regelrecht an das Dampfbad heran. Immer wieder schauen Sie sich nervös um. Und als Sie endlich vor der Tür stehen, ziehen Sie nicht einfach den Bademantel aus und gehen hinein, nein, Sie stehen – ich kann es Ihnen ganz genau sagen – achtundfünfzig Sekunden lang davor, legen schützend Ihre Hand über die Augen und schauen hinein.“ Trinkl sah mich an. „Dann erst fassen Sie sich endlich ein Herz. Aber wie!“
Ich erkannte mich nun in Infrarot.
„Wieder stehen Sie minutenlang wie angewurzelt da und starren in den dichten Nebel. Warum setzen Sie sich nicht einfach? Sie wollten doch ins Dampfbad … Sie tun ein paar Schritte, strecken Ihren Kopf vor, wie ein Vögelchen, und dann, dann rufen Sie, glaube ich, ein leises HALLO?.“
Mir wurde schwindelig.
„Es dauert noch mal fast zwei Minuten, bis Sie den Versuch abbrechen und unverrichteter Dinge wieder hinausgehen. Was haben Sie da gemacht? Hatten Sie vor irgendetwas Angst? Fühlten Sie sich beobachtet?“ Er hielt die Aufnahme an. „Was ist das für eine merkwürdige Unruhe in Ihnen? Was für eine Verunsicherung rumort in Ihnen, dass Sie es nicht schaffen, wie jeder normale Mensch in ein Dampfbad zu gehen? Wonach suchen Sie denn? Was fehlt Ihnen?“
Sekundenlang hörte ich nur das Knistern des Kaminfeuers, es dauerte, bis ich wieder zu Sinnen kam. „Ich … ich“, setzte ich stotternd an.
„Bitte.“ Trinkl wischte mir mit dem Ärmel seines Kittels eine Schweißperle von der Stirn. „Zerstören Sie nicht den Moment. Wie ich sagte, es ist bislang nur eine Frage. Eine Spur, der wir nachgehen wollen. Vielleicht wollen Sie darüber nachdenken, nein?“
Ich starrte ihn mit weit aufgerissenen Augen an.
„Gut. Wir sehen uns morgen.“
Wir lernen den Erzähler und Protagonisten deines neuen Romans „Heilung“ in einem Moment großer Schwäche kennen. Er, der eigentlich immer obenauf war, leidet plötzlich unter existenzieller Schlaflosigkeit. Aber was ist er eigentlich für ein Typ? Und was steht für ihn auf dem Spiel?
Der Erzähler wäre gern einer, der seine Gefühle und Affekte unter Kontrolle hat. Er gibt vor, sein Leben rational geführt und seine Entscheidungen rational getroffen zu haben. So erklärt er einmal, dass der Mensch nur glücklich werden könne, wenn er seine eigenen limitierten Möglichkeiten akzeptiert. Man dürfe niemals anfangen, darüber hinaus zu träumen, sich nicht zu Höherem berufen fühlen – das führe nur zu Enttäuschung und Leid. So rechtfertig er vor sich selbst die Tatsache, dass er sich ganz in den Dienst seiner erfolgreichen Frau gestellt hat, die ihm ein enorm privilegiertes Leben ermöglicht. Als ihn die Schlaflosigkeit heimsucht und er zu nichts mehr zu gebrauchen ist, fürchtet er, all das zu verlieren. Denn in seinen Augen macht ihn das für seine Frau nutzlos.
Er will also unbedingt den Normalzustand wiederherstellen, koste es, was es wolle. Du selbst kokettierst ganz gern damit, selbst jahrelang unter massiver Schlaflosigkeit gelitten zu haben. Hat dich das Thema so beschäftigt, dass du ein Buch darüber schreiben wolltest, oder was stand am Anfang?
Ich wollte eigentlich einen Roman schreiben, in dem jemand unter einer diffusen Schuld leidet. Unter einem immer lauter bohrenden Gefühl, einem Unbehagen, das er zunächst nicht zu fassen bekommt, das ihn aber zunehmend ratloser und unruhiger macht, und dem er dann Schritt für Schritt auf die Spur kommt. Erst beim Schreiben habe ich gemerkt, dass diese Schuld selbst überhaupt nicht in dem Roman vorkommen darf. Sie manifestiert sich, wenn man so will, in einem akuten Problem: Ein Mann, der vorgibt, absolut glücklich zu sein, kann nicht mehr schlafen. Das ist etwas sehr Grundlegendes, das sich auf jeden Bereich eines Lebens auswirkt – irgendetwas arbeitet da in ihm, irgendetwas macht ihm Angst. Aber um was es sich dabei handeln könnte, ob er eine verborgene Schuld spürt oder ein anderes Problem, ein Geheimnis, dieser Frage bin ich erst im Laufe des Schreibens nähergekommen. Klar ist, er hat ein Schlafproblem, das er nicht ignorieren kann, so gern er es würde.
Er kommt also ins San Vita, ein abgelegenes Nobelresort in den Dolomiten, um sich seinem Problem zu widmen. Was erlebt er dort und was wird ihm dort versprochen?
Gegen seinen Willen schickt seine Frau Imogen ihn in dieses luxuriöse Gesundheitsresort. Ich glaube, wir müssen es uns als eine Institution vorstellen, in der Menschen, die es sich leisten können, von ihren diffusen Zivilisationskrankheiten geheilt werden wollen – so erklärt Professor Trinkl, der Leiter des San Vita, ja auch zu Beginn, dass dort nicht Kranke, sondern Gesunde behandelt werden. Man wolle hier den eigentlichen Problemen des Menschen auf den Grund gehen, seinem Unbehagen, was auch immer das sein soll. Und genau das ist ja etwas, das unserem Erzähler gar nicht gefällt. Denn kaum etwas fürchtet er mehr, als andere in sein Inneres blicken zu lassen. Deshalb wehrt er sich anfangs auch noch gegen die Behandlung von Professor Trinkl. Er befürchtet, heimlich einer Psychotherapie unterzogen zu werden. Erst im Laufe seines Aufenthalts beginnt er, dem Heilungsversprechen des San Vita zu vertrauen, er gibt sich mehr und mehr hin. Es passieren ein paar merkwürdige, teils verstörende, teils betörende Dinge, die Methoden des Professors sind so ungewöhnlich wie verführerisch, und es scheint, dass unser Erzähler mit der Zeit beginnt, über sich selbst nachzudenken. Und damit beginnt dann langsam auch die Heilung bzw. das ganze Unheil, je nachdem.
Der Protagonist ist kein Hochstapler – dennoch verbindet ihn etwas mit Patricia Highsmiths berühmtester Figur Tom Ripley?
Der Erzähler meines Romans ist sicherlich kein Ripley. Er agiert nicht berechnend oder abgebrüht, er will zu Beginn des Romans eben nicht das Leben eines anderen leben, er verbietet sich solche Gedanken geradezu. Er will sich dazu zwingen, er selbst zu bleiben und all seine Probleme mit sich selbst auszumachen. Und trotzdem spielt das Thema, ein anderer werden zu können und werden zu wollen, im Laufe des Romans eine zentrale Rolle. Ripley als Figur hat mich immer fasziniert. Unter gewissen Umständen würde ich vielleicht alles genauso machen wie er. Ich kann ihn gut verstehen – ist es nicht viel leichter, sich aus einem anderen, gelungenen Leben alles zu klauen, als sich etwas Eigenes, Sinnvolles auszudenken und in die Tat umzusetzen. Ich glaube, jeder Mensch hat den Wunsch, sich zu verwandeln, auf welche Weise auch immer, und irgendwann ereilt dieses Schicksal auch unseren Erzähler. Er merkt es nur nicht.
Erkläre mir mal, warum vielleicht gerade in der heutigen Zeit ein Roman über das Glück „Heilung“ heißen muss.
Ich bin unsicher, was das betrifft. Einerseits vernehme ich in den letzten Jahren einen allgemeinen, omnipräsenten Wunsch nach Heilung, wobei im Detail unklar bleibt, worin diese Heilung bestehen soll, in einem gesunden Körper, einem gesunden Geist? Es muss etwas zu tun haben mit dem so grundlegenden Bedürfnis des Menschen, nach langer Suche endlich glücklich zu sein. Doch ist man glücklich, wenn es gelingt, von allen Problemen, Sorgen und Ängsten geheilt zu sein? Ist ein Leben ohne Unglück und Not denkbar? Ist ein „geheiltes“ Leben überhaupt erstrebenswert? Und zu welchem Preis?
Unser Erzähler hat, so glaubt er, seine ganz eigene Glücksformel gefunden. Und erst als er damit ins Wanken gerät, begibt er sich auf den beschwerlichen Weg der Heilung. Manchmal denke ich, es ist ein kleines bürgerliches Drama, das wir in dem Roman miterleben. Wir sehen jemandem dabei zu, wie er verzweifelt nach etwas sucht, nach einem Urzustand, nach dem vermeintlichen Glück. Aber müssen wir ihn uns deshalb am Ende als einen geheilten Menschen vorstellen? Ich weiß es nicht.
„Am Anfang dieser Geschichte steht die Schlaflosigkeit. Und ein Erzähler, der sich nichts sehnlicher wünscht, als davon befreit zu werden. Zurück ins Glück. Geheilt sein.
Nach dem hochgelobten Debüt, „Die Geschichte eines einfachen Mannes“, greift Timon Karl Kaleyta in seinem zweiten Roman den allgegenwärtigen Wunsch nach Heilung auf, um von etwas so Aktuellem wie universell Menschlichem zu erzählen: Was als Kuraufenthalt beginnt, von dem sich der Protagonist ein Ende seiner durchwachten Nächte erhofft, wird zu einer rastlosen Suche nach dem Glück. Aber wie findet man das Glück heute? In stiller Einkehr? Beim Therapeuten? In der Abgeschiedenheit der Natur? Oder im Schoß der Familie? Wagt man einen Neuanfang? Muss man ganz man selbst werden oder ein ganz anderer?
„Heilung“ ist ein literarisches Vexierspiel, anspielungsreich und doch nonchalant, überraschend komisch und unerhört abgründig. Und Timon Kaleyta erweist sich einmal mehr als der elegante Erzähler eines Romans, der nicht auf alles eine Antwort findet, aber ganz gewiss in der Lage ist, Erkenntnis zu stiften." Hannes Ulbrich, Lektor
„Der vielleicht eleganteste und humorvollste deutschsprachige Roman der Frühjahrssaison.“
„Das Ganze ist ein groteskes, fröhlich skurriles, flottes Lesevergnügen.“
„Eine abenteuerliche, aber vor allem höchst originelle Geschichte, erzählt der Autor (…) in seinem Roman ›Heilung‹.“
„Ein wunderbarer Roman.“
„Kaleytas Protagonist wandelt auf seiner Reise durch die verschiedenen Facetten einer Selbstfindungsobsession des Gegenwartsmenschen.“
„Der Autor ist mit einer Gabe gesegnet, die in der Prosa seltsamerweise zuletzt kaum kultiviert wurde: Er verfügt über Originalität. Dass er wie nebenbei auch sehr handfeste Themen verhandelt, spricht umso mehr für seinen Roman.“
„Ein zeitgenössischer Sanatoriumsroman, der an Thomas Manns ›Zauberberg‹ erinnert.“
„Spielerisch, elegant und ohne jegliche Schwere jongliert Kaleyta mit zeitkritischen Betrachtungen zu Achtsamkeit, Selbstverwirklichung und Entfremdung, maßt sich aber keine letztgültige Diagnose an. Vielleicht ist die beste Strategie mit den Anwürfen und Überforderungen der Postmoderne zurecht zu kommen, diese mit Ironie zu unterwandern. Dieser unterhaltsame und schlaue Roman liefert dafür jedenfalls zahlreiche Argumente.“
„Kaleyta hat einen Sinn für Dramaturgie. Immer wieder findet er Spannungsmomente. Er verdichtet sie im letzten Kapitel…“
„Man sollte Timon Karl Kaleytas ›Heilung‹ genießen. (...) eine Komödie im Ton einer Ironie, die höflich bleiben und sich lieber lustig machen als draufhauen will.“
„Eine Auszeit brauchen wir doch alle. Am liebsten ganz weit weg. Und für immer. Timon Karl Kaleyta legt in ›Heilung‹ den Horror dieses Traums frei.“
„Eine wirklich spannende Geschichte um Schuld, Glück und um die Suche nach sich selbst.“
„Spielerisch elegant und ohne jegliche Schwere jongliert Timon mit zeitkritischen Betrachtungen zu Achtsamkeit, Selbstverwirklichung, Entfremdung (...) Es macht einfach unheimlich viel Spaß.“
„Ein glänzender Roman (...) Mühelos trägt er den Leser von Szene zu Szene. Und er lässt diesen Leser am Ende mit der erschreckenden Erkenntnis zurück, dass der Ausweg aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit wohl auch heute nicht ohne Gewalt zu haben ist.“
„Man kann wahnsinnig viel aus diesem Buch herausholen. Und der Schluss ist wirklich ein Knaller!“
„Die bemerkenswerte Wiederauferstehung des klassischen Sanatoriumsromans, elegant erzählt, voll des charakteristisch-impliziten Spotts, aber aktualisiert mit Verweisen auf Stephen Kings ›Shining‹, Hermann Burgers ›Künstliche Mutter‹, Paolo Sorrentinos ›Youth‹ und David Lynchs ›Twin Peaks‹.“
„Kaleytas Icherzähler ist eine eigenständige Figur. Er symbolisiert die Allgemeingültigkeit der Suche nach dem Glück in der heutigen Zeit.“
„Symbolgesättigt verhandelt der Autor und Musiker Kaleyta (...) in seinem zweiten Roman die Themen Männlichkeitsideale sowie Selbstoptimierungswahn und kontrastiert hintersinnig die unheimliche, sterile Wellness-Welt in den Dolomiten mit dem naturverbundenen Alltag auf dem Bauerngut.“
„Ein wirklich herausragend gut geschriebener, äußerst kluger Roman.“
„Ein Buch, das nachdenklich macht.“
„Der Autor ist mit einer Gabe gesegnet, die in der Prosa seltsamerweise zuletzt kaum kultiviert wurde: Er verfügt über Originalität.“
„Ein untergründiger, zu Recht gefeierter Roman, der bestens in die unruhige Wirklichkeit passt.“
„Was ist das für ein gekonnt überzeichneter Roman, der den Helden durch die Trugbilder eines sinnhaften Lebens führt? Einer zum Wachbleiben!“
„Die Fantasie, die sehr prägnanten Figuren, die denkwürdigen Szenen, die Verbindung von Grusel und Komik haben mich an diesem Buch sehr beeindruckt.“
„Der vermutlich interessanteste Roman dieser Saison: Timon Karl Kaleytas ›Heilung‹, ein mit allen Wassern der Ironie, der Gegenwartskritik und der literarischen Parodie gewaschener Roman eines jungen Autors, der das Zeug hat zum deutschsprachigen Michel Houellebecq zu werden.“
„Bitter-groteske Abrechnung mit Erlösungsfantasien.“
„Kaleyta hat mit seinem Roman eine schöne Parabel auf den Achtsamkeits- und Selbstoptimierungswahnsinn unserer Gegenwart geschrieben.“
„In dieser Story versteckt ist natürlich auch einiges an Philosophie: über Freundschaft, über Schuld, über Selbstsuche und den Sinn des Lebens. Also: wenn man ein wenig das Absurde mag, dann ist der Roman genau das Richtige.“
„Timon Karl Kaleyta hat einen Roman über wohl niemals versiegende Sehnsucht nach Eindeutigkeit, nach Wahrheit, nach den ganz großen Gefühlen geschrieben, nach einer Idylle, die schnell in einen faschistischen Fiebertraum abgleiten kann, über das Böse, das sich als Gutes, Schönes und Poetisches, vor allem aber als Vitales und Gesundes tarnt.“
„Bis zur letzten Seite lässt er offen, an was genau sein Ich-Erzähler (...) leidet, was ihn in einen fast apathischen Zustand getrieben hat. Er ist Symptomträger für die Krise der Moderne, die nahezu alle Gewissheiten auflöst, auch den Glauben daran, dass alle Probleme sich mit kühler Rationalität klären lassen, es auf alles befriedigende Antworten gibt.“
„Doppelbödige Erzählung einer Selbstfindung.“
„Eine hochkomische Entlarvung der Versprechungen der modernen Glücksindustrie.“
„Viel Literatur, viel Empfindsamkeit und Heilung im neuen Roman von Timon Karl Kaleyta.“
„Der Autor ist originell, einfallsreich, erzählt mit hintergründigem Witz und großer Fabulierlust und versteht es letztlich auch, seine Leser mit überraschenden Wendungen zu bannen.“























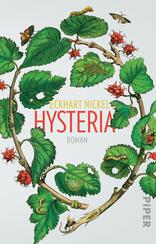
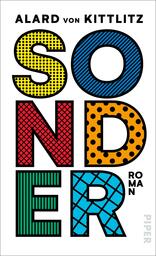













Eine grauenhaft, merkwürdig und zugleich bezaubernde Lektüre wird vom Autor geschaffen. Viele kritische Momente lässt dieser im Laufe des Romans (auch im Nachhinein) einfließen und hinterfragen. Das Buch regt zum Denken an! Eine Hauptfigur, die auf seiner verzweifelten Suche nach einer Art Heilung ist. Das Aufkommen eines unerbittlichen Glauben an erlösender Verbundenheit.
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.