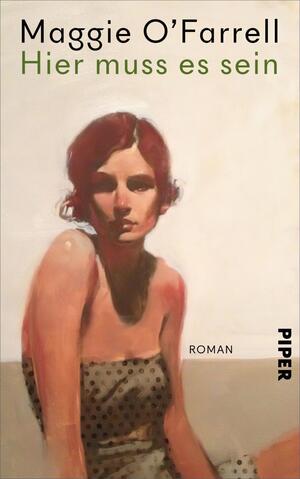
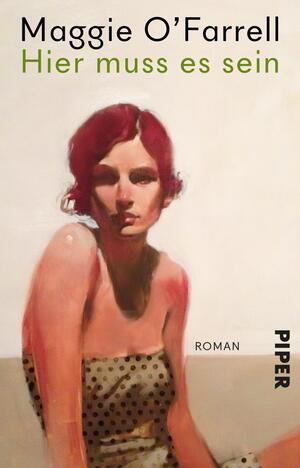
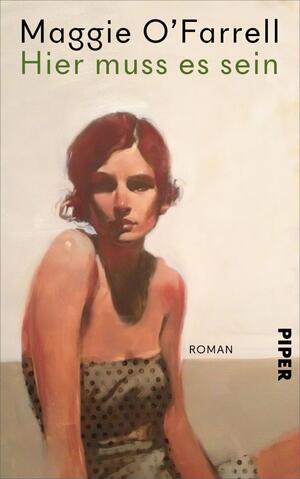
Hier muss es sein Hier muss es sein Hier muss es sein - eBook-Ausgabe
Roman
— Sunday-Times-Bestseller und Buch des Jahres 2024 der Belletristik-Couch„Einmal mehr beweist dieser Roman, was psychologische Einfühlungsgabe, kombiniert mit den Errungenschaften moderner Romankunst, zu leisten imstande ist.“ - Basler Zeitung
Hier muss es sein — Inhalt
„Glaubst du, es könnte sein, dass wir am Ende unserer Geschichte angelangt sind?‹“
Claudette Wells ist eine Frau, die zur Schrotflinte greift, sobald sich ein Fremder ihrem abgelegenen Haus in Donegal nähert. Vor Jahren schon floh sie mit ihrem Sohn Ari in dieses Refugium im Nordwesten Irlands. Warum aber gab sie ihre Karriere als Filmstar auf, obwohl die Welt und der berühmte schwedische Regisseur Timou Lindstrom ihr zu Füßen lagen?
Als Daniel Claudette zum ersten Mal begegnet, ahnt er nichts von der komplizierten Vergangenheit dieser scheinbar so berühmten wie rastlosen Frau. Der Linguistikprofessor aus Brooklyn lässt sein altes Leben hinter sich, um zu Claudette und Ari zu ziehen. Doch als Daniel vom Tod seiner Ex-Geliebten Nicola Janks erfährt, bricht eine über Jahrzehnte verdrängte Schuld über ihn herein. Und reißt ihn aus dem Leben, das er und Claudette sich aufgebaut haben.
Keine Autorin wurde in Großbritannien zuletzt so gefeiert wie Maggie O’Farrell. In „Hier muss es sein“ brilliert sie mit dem nuancierten Porträt einer Ehe, so verschlungen wie die Liebe selbst.
„Ein hinreißender Roman über Liebe und Hoffnung, der mitten ins Herz trifft.“ The Sunday Times
„›Hier muss es sein‹ ist ein stilistisches, erzählerisches und emotionales Meisterwerk, eine komplexe und nuancierte Geschichte, die sich mühelos zwischen verschiedenen Figuren, Kontinenten und Zeitebenen hin- und herbewegt.“ Observer
„Maggie O’Farrell lenkt ihre Figuren mit der Kunstfertigkeit einer Magierin. Sie ist eine geschickte, blendende Chronistin menschlicher Beziehungen.“ The Guardian
Leseprobe zu „Hier muss es sein“
Ein ganz komisches Gefühl
in den Beinen
Daniel, Donegal, 2010
Ein Mann.
Er steht auf der Stufe der Hintertür und dreht sich eine Zigarette. Das Wetter ist wechselhaft, wie so oft, der Garten glänzt saftig grün, die Äste sind schwer vom Regen, der weiterhin fällt.
Der Mann bin ich.
Ich stehe vor der Tür, die Tabakdose in der Hand, und beobachte etwas zwischen den Bäumen, eine Gestalt am Rand des Gartens, wo die Pappeln dicht an den Zaun heranrücken. Einen anderen Mann.
Er hat ein Fernglas und eine Kamera dabei.
Ein Vogelbeobachter, sage ich mir, während ich das [...]
Ein ganz komisches Gefühl
in den Beinen
Daniel, Donegal, 2010
Ein Mann.
Er steht auf der Stufe der Hintertür und dreht sich eine Zigarette. Das Wetter ist wechselhaft, wie so oft, der Garten glänzt saftig grün, die Äste sind schwer vom Regen, der weiterhin fällt.
Der Mann bin ich.
Ich stehe vor der Tür, die Tabakdose in der Hand, und beobachte etwas zwischen den Bäumen, eine Gestalt am Rand des Gartens, wo die Pappeln dicht an den Zaun heranrücken. Einen anderen Mann.
Er hat ein Fernglas und eine Kamera dabei.
Ein Vogelbeobachter, sage ich mir, während ich das dünne Papierchen über die Zunge ziehe, die gibt es hier öfter. Aber zugleich denke ich: Wirklich? Vögel beobachten, so weit hinten im Tal? Und ich denke, wo sind meine Tochter, das Baby, meine Frau? Wie schnell könnte ich bei ihnen sein, wenn ich müsste?
Mein Herz dreht hoch, hämmert in meiner Brust. Blinzelnd schaue ich in den weißen Himmel. Ich bin im Begriff, in den Garten zu treten, der Kerl soll wissen, dass ich ihn gesehen habe, soll sehen, dass ich ihn sehe. Er soll erkennen, wie groß ich bin, dass ich die Statur eines ehemaligen Topleichtathleten habe (mittlerweile zugegebenermaßen nicht mehr ganz so straff und knackig). Er soll sich seine Chancen ausrechnen, ich gegen ihn. Er braucht nicht zu erfahren, dass ich mich noch nie mit jemandem geprügelt habe und nicht gedenke, daran etwas zu ändern. Er soll sich so fühlen, wie ich mich gefühlt habe, wenn mein Vater mich vor einer Bestrafung zur Rede stellte: „Mich täuschst du nicht“, pflegte er zu sagen und dabei mit dem Finger erst auf seine Brust zu zeigen und dann auf mich.
Mich täuschst du nicht, würde ich am liebsten schreien, während ich die Selbstgedrehte und das Feuerzeug in meine Tasche stecke.
Der Typ schaut zum Haus herüber. Ich sehe das Aufblitzen der Sonne auf einer Linse und eine Armbewegung, mit der er sich eine Haarsträhne aus der Stirn gewischt oder den Auslöser einer Kamera betätigt haben könnte.
Sehr schnell passiert jetzt zweierlei. Der Hund – ein schnurrhaariger, langbeiniger, leicht arthritischer Irischer Wolfshund, der normalerweise neben dem Ofen schläft – saust durch die Tür, an meinen Beinen vorbei und in den Garten, unter anhaltendem tiefem Gebell, und eine Frau kommt um das Haus herum.
Sie hat das Baby auf dem Rücken, trägt einen Südwester, wie ihn üblicherweise Nordseefischer tragen, und hat ein Gewehr in der Hand.
Und sie ist meine Frau.
An Letzteres habe ich mich immer noch nicht so recht gewöhnt, nicht nur, weil es kaum vorstellbar ist, dass dieses Wesen jemals bereit gewesen sein soll, mich zu heiraten, sondern auch, weil sie immer wieder unvermutet solche Nummern abzieht.
„Herrgott, Schatz!“, japse ich und werde kurz vom kieksenden Klang meiner Stimme abgelenkt. Unmännlich trifft es nicht ganz. Ich klinge, als tadelte ich sie wegen eines schlecht ausgewählten neuen Vorhangstoffs oder weil sie Pumps trägt, die nicht zu ihrer Handtasche passen.
Sie ignoriert meinen schrillen Einwurf – wer könnte es ihr verdenken? – und schießt in die Luft. Einmal. Zweimal.
Wer, so wie ich, noch nie aus nächster Nähe einen Gewehrschuss gehört hat, dem sei gesagt, dass es sich um eine ohrenbetäubende Explosion handelt. Im Kopf blitzen magnesiumfarbene Lichter auf, in den Ohren gellt der dreigestrichene Ton einer Arie, die Nase ist von Teergeruch erfüllt.
Der Knall prallt von der Hauswand ab, dann vom Berg und wieder von der Wand: ein riesiger akustischer Tennisball, der im Tal hin und her springt. Während ich zusammenfahre, mich ducke, die Arme über den Kopf schlage, ist das Baby, wie mir auffällt, seltsam ungerührt. Der Kleine lutscht weiter am Daumen, den Kopf an die Mähne seiner Mutter gelehnt. Fast so, als wäre er das gewohnt. Als hörte er so etwas nicht zum ersten Mal.
Ich richte mich auf. Nehme die Hände von den Ohren. In der Ferne sprintet eine Gestalt durch das Unterholz. Meine Frau dreht sich um. Sie klappt das Gewehr in der Armbeuge auf. Pfeift nach dem Hund. „Ha!“, sagt sie zu mir, bevor sie wieder um die Hausecke verschwindet. „Dem hab ich’s gezeigt.“
Meine Frau, sollte ich anmerken, ist verrückt. Nicht im Sinne von Gehört-in-die-Klapse – wobei ich mich manchmal frage, ob es in ihrem Leben nicht auch solche Phasen gegeben hat –, sondern auf eine subtilere, gesellschaftsfähigere, weniger auffällige Weise. Sie denkt anders als andere Menschen. Sie ist der Ansicht, jemanden mit dem Gewehr zu bedrohen, der – höchstwahrscheinlich völlig arglos – am Zaun unseres Grundstücks herumlungert, sei nicht nur zulässig, sondern vielmehr absolut angemessen.
Hier die nackten Tatsachen über die Frau, die ich geheiratet habe:
Sie ist, wie ich vielleicht erwähnt habe, verrückt.
Sie ist eine Weltflüchterin.
Sie ist offenkundig bereit, jeden mit dem Gewehr zu bedrohen, von dem sie befürchtet, er könnte ihr Versteck ausfindig machen.
Ich flitze durchs Haus, sofern ein Mann meiner Körpergröße flitzen kann, um sie abzufangen. Die werde ich mir zur Brust nehmen. Sie kann nicht in einem Haus mit kleinen Kindern ein Gewehr aufbewahren. Das geht einfach nicht.
Ich wiederhole diese Sätze im Geiste, während ich durchs Haus eile, will meinen Protest damit beginnen. Aber als ich vorne aus der Haustür trete, komme ich mir plötzlich vor wie in einer anderen Welt. Anstelle des grauen Nieselregens hinterm Haus erfüllt hier strahlender, rosiger Sonnenschein den Garten, der glitzert und funkelt, als wäre er aus Diamant gehauen. Meine Tochter springt über ein Seil, das von ihrer Mutter geschwungen wird. Meine Frau, gerade noch eine Furcht einflößende Gestalt mit Gewehr, langem grauen Mantel und einem Hut gleich der Kapuze des Sensenmanns, hat den Südwester abgesetzt und wieder ihre übliche Erscheinungsform angenommen. Das Baby krabbelt durchs Gras, die Knie nass vom Regen, in der Faust eine Irisblüte, und gurrt und plappert zufrieden vor sich hin.
Es ist, als wäre ich in eine andere Zeit geraten, wie in einem dieser Märchen, wo jemand meint, eine Stunde geschlafen zu haben, beim Aufwachen aber feststellt, dass es ein ganzes Leben war, alle geliebten Menschen tot, alles Vertraute verschwunden. Komme ich wirklich nur von der anderen Seite des Hauses, oder habe ich hundert Jahre geschlafen?
Ich schüttele diesen Gedanken ab. Die Sache mit dem Gewehr muss aufs Tapet, und zwar sofort. „Seit wann“, will ich wissen, „besitzen wir eine Feuerwaffe?“
Meine Frau hebt den Kopf, erwidert meinen Blick mit eisenharter, widerständiger Miene, und das Springseil in ihrer Hand sinkt zu Boden. „Wir nicht“, sagt sie. „Ich.“
Eine typische Reaktion. Sie beantwortet die Frage scheinbar, aber nicht wirklich. Vielmehr geht sie auf einen Bestandteil der Frage ein, der nicht zur Diskussion steht. Das klassische Ausweichmanöver.
Ich pariere. Darin habe ich mehr als genug Übung. „Seit wann besitzt du eine Feuerwaffe?“
Sie zuckt mit der einen Schulter, die nackt ist, wie ich sehe, zu einem sanften Gold gebräunt, über das ein dünner weißer Träger verläuft. Einen Moment lang spüre ich eine reflexhafte Regung in der Tiefe meiner Unterwäsche – seltsam, dass sich das bei Männern mit dem Alter nicht ändert, dass uns alle nur ein hauchdünnes Etwas von unserem Teenager-Ich trennt –, aber ich lenke meine Aufmerksamkeit wieder auf unser Gespräch. So leicht kommt sie mir nicht davon.
„Seit jetzt“, antwortet sie.
„Was ist eine Feuerwaffe?“, fragt meine Tochter, das herzförmige Gesichtchen ihrer Mutter zugewandt.
„Das ist ein Überbegriff“, sagt meine Frau, „so wie Schusswaffe. Er meint das Gewehr.“
„Ach so, das Gewehr“, sagt meine süße Marithe, sechs Jahre alt und zu gleichen Teilen Kobold, Engel und Sylphide. Sie dreht sich zu mir um. „Der Weihnachtsmann hat Donal ein neues gebracht, und da hat er gesagt, dass Maman dieses hier haben kann.“
Ihre Äußerung verschlägt mir einen Moment lang die Sprache. Donal ist ein übel riechender Homunkulus, der noch weiter hinten im Tal das Land bestellt. Er – und seine Frau vermutlich auch – hat, so kann man wohl sagen, ein Problem mit der Aggressionsbewältigung. Leicht schießwütig, unser Donal. Er schießt auf alles, was ihm unter die Augen kommt: Eichhörnchen, Kaninchen, Füchse, Wanderer (kleiner Scherz).
„Was soll das?“, frage ich. „Du hast eine Feuerwaffe im Haus und …“
„Ein Gewehr, Daddy. Sag Gewehr.“
„… ein Gewehr, ohne mir etwas davon zu sagen? Ohne mit mir darüber zu sprechen? Weißt du denn nicht, wie gefährlich das ist? Was ist, wenn eins der Kinder …“
Meine Frau dreht sich um, und ihr Saum wischt durch das nasse Gras. „Müssen wir uns nicht langsam auf den Weg zum Bahnhof machen?“
Ich sitze hinter dem Steuer, eine Hand am Zündschlüssel, die Zigarette, die ich mir vorhin gedreht habe, zwischen die Lippen geklemmt. Ich fische in meiner Hosentasche nach meinem Feuerzeug oder Streichhölzern. Ich bin entschlossen, diese Zigarette irgendwann demnächst zu rauchen, noch vor zwölf. Ich beschränke mich auf drei Zigaretten pro Tag, und Mann, die brauche ich wirklich.
Außerdem schreie ich lauthals. Am Ende der Welt zu leben befördert diese Art von hemmungslosem Verhalten.
„Los jetzt!“, brülle ich, von heimlicher Bewunderung für die Lautstärke erfüllt, zu der ich imstande bin, für das Echo, das vom Berg zurückgeworfen wird. „Ich verpass noch meinen Zug!“
An Marithe scheint die ganze Aufregung völlig vorüberzugehen, was einerseits löblich, andererseits ärgerlich ist. Sie hält einen Socken in der Hand, in dem offenbar ein Tennisball steckt, steht mit dem Rücken zum Haus und zählt laut (auf Gälisch, wie ich mit gelinder Überraschung bemerke). Bei jeder Zahl – aon, dó, trí, ceathair – schlägt sie die Ballsocke gegen die Wand, gefährlich nah an ihrem Körper. Ich schaue ihr zu, während ich weiter rufe – sie kann das ziemlich gut. Ich frage mich, wo sie dieses Spiel gelernt hat. Vom Gälischen ganz zu schweigen. Sie wird von ihrer Mutter zu Hause unterrichtet, wie zuvor schon ihr älterer Bruder, bis er rebellierte und sich (mit meiner heimlichen Unterstützung) in einem Internat in England anmeldete.
Mein Terminkalender sieht so aus, dass ich oft unter der Woche zum Arbeiten in Belfast bin und am Wochenende wieder hierherkomme, in den hintersten Winkel von Donegal. Ich unterrichte Linguistik an der Uni, bringe den jüngeren Semestern bei zu analysieren, was sie um sich herum hören, zu hinterfragen, wie Sätze konstruiert und Wörter verwendet werden, und Vermutungen anzustellen, warum das so sein könnte. In meiner Forschung habe ich mich immer auf die Entwicklung der Sprache konzentriert. Ich bin keiner dieser Traditionalisten, die jammern und klagen, dass die Grammatik verfalle oder semantische Standards unterlaufen würden. Nein, ich kann dem Prinzip der Veränderung viel abgewinnen.
Aus diesem Grunde gelte ich auf dem äußerst beschränkten Gebiet der akademischen Linguistik als Außenseiter. Nicht unbedingt eine Auszeichnung, aber was soll’s. Wer je im Radio eine Sendung über Neologismen, grammatikalische Verschiebungen oder die Art und Weise verfolgt hat, wie Jugendliche sich Begriffe für ihre eigenen, oft subversiven Zwecke aneignen, der hat als Vertreter der Ansicht, dass Veränderung etwas Gutes und Anpassungsfähigkeit begrüßenswert sei, vermutlich mich sprechen hören.
Das habe ich beiläufig auch mal zu meiner Schwiegermutter gesagt, die mich daraufhin einen Moment lang mit dem herrischen Blick ihrer mit Mascara umrandeten Augen fixierte und in ihrem makellosen Pariser Englisch sagte: „Ah, aber nein, ich hätte dich nicht gehört, ich schalte das Radio aus, sobald ich einen Amerikaner sprechen höre. Ich ertrage diesen Akzent einfach nicht.“
Akzent hin oder her, in wenigen Stunden soll ich eine Vorlesung über Pidgins und Kreolsprachen halten, illustriert am Beispiel eines einzigen Satzes. Wenn ich diesen Zug jetzt verpasse, gibt es keinen anderen mehr, der mich rechtzeitig in die Stadt bringen könnte. Dann wird es keine Vorlesung geben, keine Pidgins, keine Kreolsprachen, wohl aber eine Schar junger Studierender, die nichts über die faszinierende, komplexe linguistische Genealogie des Satzes „him thief she mango“ erfahren werden.
Außerdem soll ich nach der Vorlesung einen Flug in die USA antreten. Nach ausgiebigem transatlantischem Druck seitens meiner Schwestern fliege ich wider besseres Wissen zur Geburtstagsparty meines Vaters, der neunzig wird. Was für eine Art von Party man mit neunzig Jahren noch feiern kann, sei dahingestellt – ich rechne mit stapelweise Papptellern, Kartoffelsalat und lauwarmem Bier und mit einer Gästeschar, die geschlossen zu ignorieren versucht, dass der Gefeierte selbst finster und knurrig in einer Ecke sitzt. Meine Schwestern sagen schon seit Längerem, unser Vater könne jeden Moment das Zeitliche segnen, und sie wüssten wohl, dass er und ich oft unterschiedlicher Meinung gewesen seien (um es dezent auszudrücken), aber wenn ich nicht bald käme, würde ich das bis an mein Lebensende bereuen. Blablabla. Hört zu, sage ich ihnen, der Mann geht jeden Tag drei Kilometer zu Fuß, isst genug Pulled Pork, um den Bundesstaat New York seiner gesamten Schweinepopulation zu berauben, und wenn man ihn mal am Telefon erwischt, klingt er alles andere als gebrechlich: Auf meine Unzulänglichkeiten und Fehleinschätzungen weist er mich immer noch sehr eloquent und energisch hin. Und was seinen viel beschrienen möglichen Tod angeht: So, wie ich das sehe, hat in der Brust dieses Mannes von vornherein kein Herz geschlagen.
Dieser Besuch – der erste seit mehr als fünf Jahren – ist nicht der Grund, so rede ich mir ein, warum ich mich so gestresst fühle, erklärt nicht mein unglaubliches Verlangen nach Nikotin oder das nervöse Zucken meines einen Augenlids, während ich dasitze und warte. Er hat nichts damit zu tun, gar nichts. Ich bin heute einfach ein bisschen überreizt. Ich werde nach Brooklyn fahren, meinen Alten besuchen, nett sein, zu der Party gehen, werde ihm das Geburtstagsgeschenk überreichen, das meine Frau besorgt und eingepackt hat, ich werde mit meinen Nichten und Neffen plaudern, werde die erforderliche Anzahl von Tagen dort ausharren – und dann werde ich mich so schnell wie möglich aus dem Staub machen.
Ich öffne die Autotür einen Spaltbreit und schreie in die feuchte Luft: „Wo bleibt ihr denn? Ich verpasse meine Vorlesung!“, und dann erspähe ich ein zerknicktes Streichholzbriefchen im Fußraum des Wagens. Ich tauche hinunter wie ein Perlenfischer und komme triumphierend, Briefchen in der Hand, wieder hoch.
In diesem Moment reißt meine Frau die Tür auf und fängt an, das Baby in seinen Kindersitz zu schnallen. Ich atme auf, während ich ein Streichholz anzünde. Wenn wir jetzt fahren, sollten wir es schaffen.
Marithe klettert auf ihren Platz, der Hund drängt herein, springt über die Sitzlehne in den Kofferraum, die Beifahrertür geht auf, und meine Frau schlüpft ins Auto. Sie hat, wie ich sehe, eine Männerhose an, die sie in der Taille mit etwas gebunden hat, das mir verdächtig nach einer meiner Seidenkrawatten aussieht. Darüber trägt sie einen Mantel, der, wie ich weiß, mehr gekostet hat, als ich im Monat verdiene – ein großes Ungetüm aus Leder und Tweed, mit Schulterstücken und Schlaufen –, und auf dem Kopf eine Kaninchenfellmütze mit kunstvoll gearbeiteten Ohrenklappen. Noch ein Geschenk von Donal?, liegt mir auf der Zunge, doch ich spreche es nicht aus, weil Marithe im Auto sitzt.
„Puh“, sagt meine Frau, „ist das scheußlich da draußen.“
Auf den Rücksitz wirft sie einen Weidenkorb, einen Rupfensack, etwas, das aussieht wie ein Kandelaber aus Messing, und schließlich einen uralten, angelaufenen Schneebesen.
Ich sage nichts.
Ich lege den ersten Gang ein und löse die Handbremse, von einem absurden Erfolgsgefühl erfüllt, als wäre es eine große Leistung, meine Familie zu einem um lediglich zehn Minuten verspäteten Aufbruch zu bewegen, und ziehe den ersten Rauch des Tages tief in die Lunge, wo er sich zusammenrollt wie eine Katze.
Meine Frau langt herüber, pflückt mir die Zigarette von den Lippen und drückt sie aus.
„He!“, protestiere ich.
„Nicht mit den Kindern im Wagen“, sagt sie und deutet mit dem Kopf zum Rücksitz.
Ich will gerade darauf eingehen, gegenargumentieren – ich habe eine komplette Verteidigungsrede parat, die um die Frage kreisen wird, was wohl gefährlicher für Minderjährige ist, Feuerwaffen oder Zigaretten –, da wendet sich meine Frau mir zu, fixiert mich mit ihrem jadegrünen Blick und lächelt mich mit solcher Zärtlichkeit, solcher Vertrautheit an, dass sich die Worte meiner Rede in Luft auflösen, verdunsten wie Wassertropfen in der Sonne.
Sie legt mir die Hand aufs Bein, gerade so, dass es noch anständig ist, und flüstert: „Du wirst mir fehlen.“
Als Linguist finde ich es faszinierend, auf welch unterschiedliche Weisen Erwachsene über Sex reden können, ohne dass kleine Kinder den blassesten Schimmer haben, worüber da gerade gesprochen wird. Es ist ein eindrückliches Beispiel für die Anpassungsfähigkeit von Bedeutungen beim Sprechen. Wenn meine Frau so lächelt und sagt: „Du wirst mir fehlen“, heißt das übersetzt so viel wie: Solange du weg bist, muss ich ohne auskommen, aber sobald du wieder da bist, schleif ich dich ins Schlafzimmer und reiß dir alle Kleider vom Leib. Und wenn ich mich daraufhin räuspere und antworte: „Du mir auch“, heißt das: Ja, auf diesen Moment werde ich mich die ganze Woche über freuen.
„Ist das mit deiner Reise jetzt okay für dich?“
„Nach Brooklyn?“ Ich versuche, es ganz beiläufig zu sagen, aber die Worte klingen leicht erstickt.
„Zu deinem Dad“, stellt sie klar.
„Ah“, sage ich mit einer vagen, kreisförmigen Handbewegung. „Ja, das wird schon. Er ist … äh, also, das wird schon. Es ist ja nicht lang.“
„Na ja“, setzt sie an, „ich glaube, dass er …“
Womöglich spürt Marithe etwas, jedenfalls ruft sie plötzlich etwas lauter als nötig: „Gatter, Maman! Gatter!“
Ich halte an. Meine Frau schnallt sich ab, öffnet die Wagentür, steigt aus und knallt die Tür so heftig wieder zu, dass das regennasse rhombusförmige Fenster auf der Beifahrerseite vibriert. Im nächsten Augenblick erscheint sie in dem Panorama vor der Windschutzscheibe: Sie entfernt sich vom Auto. Das reizt bei dem Baby irgendeine präverbale Synapse: sein neuronales System teilt ihm mit, dass der Anblick seiner sich entfernenden Mutter nichts Gutes ist, dass sie womöglich nie mehr wiederkommt, dass er hier drinnen zugrunde gehen wird, dass die Gegenwart seines leicht geschwätzigen und nur gelegentlich anwesenden Vaters nicht ausreicht, um sein Überleben zu sichern (da ist was dran). Er stößt ein verzweifeltes Heulen aus, ein Signal ans Mutterschiff: Mission abbrechen, unmittelbare Rückkehr erforderlich.
„Calvin“, sage ich und nutze die Zeit, um meine Zigarette von der Ablage über dem Armaturenbrett zu nehmen, „hab ein bisschen Vertrauen.“
Meine Frau entriegelt das Gatter und zieht es auf. Ich nehme den Fuß von der Kupplung, trete aufs Gas, und das Auto gleitet durch das Tor, das meine Frau hinter uns wieder schließt.
Es gibt, sollte ich erwähnen, zwölf Gatter zwischen Haus und Straße. Zwölf. Das bedeutet, dass sie ein Dutzend Mal aussteigen, eins dieser verdammten Dinger auf- und zumachen und wieder einsteigen muss. Die Straße ist in Luftlinie kaum mehr als einen halben Kilometer entfernt, aber sie zu erreichen dauert eine kleine Ewigkeit. Und wenn man es allein machen muss, ist es eine elende Plackerei, meistens auch noch im Regen. Manchmal brauche ich etwas aus dem Dorf – eine Flasche Milch, Zahncreme, irgendeinen ganz normalen Haushaltsartikel – und stehe von meinem Sessel auf, nur um mich im nächsten Moment daran zu erinnern, dass ich auf dem Hin- und Rückweg insgesamt vierundzwanzig Gatter werde auf- und zumachen müssen, woraufhin ich wieder in meinen Sessel sinke und denke, ach verdammt, wer braucht schon saubere Zähne?
Das Wort „abgelegen“ beschreibt das Haus nicht einmal ansatzweise. Es steht in einem der am dünnsten besiedelten Täler Irlands, das so hoch gelegen ist, dass selbst Schafe es meiden, von Menschen ganz zu schweigen. Und meiner Frau beliebt es, im höchsten, fernsten Winkel dieses Tals zu wohnen, erreichbar nur über einen Weg, der durch zahlreiche Viehweiden führt. Daher die Gatter. Um hierher zu gelangen, muss man wirklich hierher gelangen wollen.
Die Autotür wird aufgerissen, und meine Frau schiebt sich wieder auf den Beifahrersitz. Noch elf Gatter. Das Baby bricht erleichtert in Tränen aus. Marithe schreit: „Eins! Ein Gatter! Eins, Daddy, eins haben wir!“ Mit ihrer Liebe zu den Gattern ist sie allein. Vom Armaturenbrett kommt jetzt ein hysterisches Piepen, das signalisiert, dass meine Frau ihren Sicherheitsgurt wieder anlegen soll. Was sie nicht tun wird. Das Blinken und Piepen wird so lange andauern, bis wir die Straße erreicht haben. Es ist ein Streitpunkt in unserer Ehe: Ich finde, der Aufwand des ständigen An- und Abschnallens wird durch die Beseitigung dieses höllischen Geräuschs wettgemacht; sie ist anderer Ansicht.
„Also, dein Vater“, fährt meine Frau fort. Sie besitzt, neben all ihren sonstigen Gaben, eine erstaunliche Fähigkeit, unterbrochene Gespräche in Erinnerung zu behalten und wieder aufzugreifen. „Ich glaube wirklich …“
„Kannst du dich nicht einfach anschnallen?“, fahre ich sie an. Ich kann nicht anders. Meine Toleranzschwelle für repetitive elektronische Geräusche ist sehr niedrig.
Sie dreht mit unendlicher, genüsslicher Langsamkeit den Kopf und schaut mich an. „Wie bitte?“, sagt sie.
„Dein Sicherheitsgurt. Kannst du nicht wenigstens einmal …“
Ich werde von einem weiteren Gatter, das aus dem Nebel auftaucht, zum Schweigen gebracht. Sie steigt aus, geht zum Gatter vor, das Baby schreit, Marithe ruft eine Zahl etc. etc. Bis zum vorletzten Gatter hat sich ein dumpfer Druck in meinen Schläfen aufgebaut, der sich zu einem anhaltenden Schmerz auszuweiten droht.
Während meine Frau zum Auto zurückläuft, rauscht das Radio, erstirbt, erwacht knisternd wieder zum Leben. Wir lassen es immer an, denn der Empfang bleibt in dieser Gegend größtenteils eine Wunschvorstellung, und jeder Fetzen Dialog oder Musik wird mit Jubel begrüßt.
„O Brendan! Brendan!“, sagt eine Schauspielerin in irgendeinem Studio voller Inbrunst. „Nimm dich bloß in Acht!“ Der Empfang geht in statisches Rauschen über.
„O Brendan, Brendan!“, kreischt Marithe begeistert und trampelt mit den Füßen gegen meine Rückenlehne. Das Baby, das die allgemeine Stimmung schnell erfasst, kräht vergnügt und umklammert die Ränder seines Sitzes, und die Sonne wählt genau diesen Moment, um überraschend in Erscheinung zu treten. Irland sieht grün und freundlich aus, als wir durch die Pfützen hindurch dem letzten Gatter entgegengleiten.
Meine Frau und Marithe debattieren, wovor Brendan sich wohl in Acht nehmen sollte, das Baby wiederholt einen n-Laut, und ich denke, dass es mit dieser Art, seinen Gaumen zu nutzen, früh dran ist, während ich zugleich beiläufig am Sendersuchknopf drehe.
Ich halte am allerletzten Gatter. Ein Glasgower Akzent dringt durch das weiße Rauschen, erfüllt das Auto, es ist der bewusst ernste Ton der Nachrichtensprecher. Aufgrund einer geografischen Anomalie können wir hier ab und zu die schottischen Nachrichten empfangen. Es geht um eine bevorstehende Regionalwahl, einen Politiker, der beim Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit erwischt worden ist, eine Schule ohne Schulbücher. Ich drehe den Senderknopf durch Wellen von Nichts, suche nach Sprache, hoffe auf eine menschliche Stimme.
Meine Frau steigt aus dem Auto, geht zum Gatter vor. Ich sehe, wie der Wind Strähnen ihres Haars erfasst und mit ihnen spielt, sehe ihren aufrechten Ballerinagang, ihre Hand im fingerlosen Handschuh, die nach dem Riegel des Gatters greift.
Die Antenne des Radios tut ihr Bestes und erwischt eine Frauenstimme: ruhig, aber zögerlich. Es geht um die Geschlechterverhältnisse in der Arbeitswelt, eines dieser Themenmagazine, die man vormittags auf BBC hören kann. Eine Achtzigjährige aus Südwestengland erzählt, wie es war, als eine der ersten Frauen überhaupt eine Ingenieursstelle zu bekommen, und ich will den Knopf schon weiterdrehen, denn das wird meine Frau unbedingt hören wollen, und mir steht der Sinn nach guter Musik. Doch dann dringt eine andere Stimme aus den kleinen perforierten Lautsprechern auf Höhe meiner Knie: die fallende Intonation und langen Vokale der gebildeten Engländer.
„Und da dachte ich, mein Gott“, sagt die Frau im Radio – in mein Auto, in die Ohren meiner Kinder –, „das muss die gläserne Decke sein, von der ich so viel gehört habe. Sollte es wirklich so schwer sein, sie mit meinem Schädel zu durchstoßen?“
Diese Worte erzeugen bei mir einen tiefen Widerhall von Erinnertem. Ohne Vorwarnung schießt mir eine Reihe von Bildern durch den Kopf: ein Kopfsteinpflaster, im Nebel verschwommen, ein Fahrrad, das an ein Geländer gekettet ist, ein von Kiefernduft erfüllter Wald, ein federnder Nadelteppich, ein Telefonhörer, an den weichen Knorpel der Ohrmuschel gedrückt.
Ich kenne diese Frau, will ich ausrufen, ich kannte sie. Fast drehe ich mich um und sage es zu meinen Kindern auf der Rückbank: Diese Frau habe ich mal gekannt.
Ich erinnere mich an dieses schwarze Cape, das sie immer trug, an ihre Vorliebe für Schuhe, die nicht zum Gehen taugten, für sonderbaren gegliederten Schmuck, für Sex im Freien, da wird die Stimme ausgeblendet, und die Moderatorin teilt uns mit, wir hätten gerade Nicola Janks gehört, eine Aufnahme aus den 1980er-Jahren.
Ich schlage mit der Handfläche aufs Lenkrad. Nicola Janks, ausgerechnet. Diesem Nachnamen bin ich nie und nirgends sonst begegnet. Sie ist und bleibt die einzige Janks, die ich jemals kannte. Sie hatte, erinnere ich mich vage, einen verrückten zweiten Vornamen, irgendwas Griechisches oder Römisches, das auf Eltern mit einem Faible für antike Mythologie schließen ließ. Wie war der Name noch gleich? Es ist nicht wirklich überraschend, halte ich mir reumütig vor Augen, dass meine Erinnerungen an diese Zeit etwas verschwommen sind, wenn man bedenkt, wie viel ich damals …
Und dann denke ich gar nichts mehr.
Die Moderatorin ergänzt in einem beherrschten, behutsamen Ton, dass Nicola Janks nicht lange nach diesem Interview verstorben sei.
Mein Gehirn gerät ins Stottern, wie ein Motor, der im nächsten Moment stehen bleiben wird. Ich schaue instinktiv nach meiner Frau. Sie hat das Gattertor geöffnet und wartet darauf, dass ich hindurchfahre.
Ich habe ein Gefühl, als wäre ein Fenster vom Wind aufgestoßen worden oder als wäre ein Dominostein gegen einen anderen gefallen und hätte eine Kettenreaktion ausgelöst. Eine Flutwelle ist herangerauscht und hat sich wieder zurückgezogen, und was darunter war, ist für immer verändert.
Ich blicke wieder zu meiner Frau. Sie hält das Gatter fest. Lehnt sich mit ihrem ganzen Gewicht dagegen, damit es nicht vor das fahrende Auto schwingt. Sie hält es fest, vertraut darauf, dass ich den Wagen durchs Tor steuere, den Wagen, in dem ihre Kinder sitzen, ihre Nachkommen, ihre Lieben. Der irische Wind bauscht ihr Haar wie ein Segel. Jetzt späht sie durch die Windschutzscheibe nach meinem Gesicht, fragt sich, warum ich nicht losfahre, aber von ihrem Standort sieht sie nur die Spiegelung der Wolken in der Scheibe. Von ihrem Standort aus könnte ich genauso gut nicht mehr da sein.
„Souverän verschlungene Beziehungschronik, die ständig Perspektive, Zeit und Ort wechselt – ebenso fesselnd wie anspruchsvoll.“
„Ein Meisterstück.“
„packend wie ein Krimi“
„Feinsinnig und nuanciert schreibt sie in ihrem neuen Roman über eine scheiternde Ehe.“
„Maggie O’Farrell schreibt zart, poetisch und auch lustig, ihre Romane sind Kunstwerke.“
„Gute Unterhaltung also und gleichzeitig gute Literatur; denn Maggie O’Farrell ist eine geschmeidige, eigenwillige Stilistin, voller Sympathie für ihre gebeutelten Protagonisten.“
„Sie nähert sich ihren Figuren sprachlich brillant – und mit genauem Blick für Beziehungen.“
„Ein lesenswertes Porträt einer Ehe, aufgebaut auf Geheimnissen und unbewältigter Vergangenheit.“
„Die irisch-britische Autorin Maggie O’Farrell ist eine großartige Zuhörerin der zwischenmenschlichen Töne, seien sie noch so leise, und eine begnadete Erzählerin, die mühelos die Fäden ihres über 500-Seiten-Buchs trotz kunstvoller Knoten zusammenbringt.“
„Ihr neuer Roman ist so komplex strukturiert, dass man in jedem Kapitel Einflüsse von James Joyce und Marcel Proust spürt. Sie ist eine Meisterin des stilistischen Ornaments und der sprachlichen Arabesken. Diesen Titel dürfte ihr kaum eine ihrer Kolleginnen streitig machen.“
„Einmal mehr beweist dieser Roman, was psychologische Einfühlungsgabe, kombiniert mit den Errungenschaften moderner Romankunst, zu leisten imstande ist.“
„Ein so fesselndes wie berührendes Porträt einer besonderen Ehe.“
„O’Farrells Prosa ist geprägt von einer fabelhaften Einfühlungsgabe, ausgefeilten Dialogen, subtilem Humor – und analytischer Schärfe. Sie seziert große Gefühle und persönliches Glück, Lüge und Betrug, Verlust und Trauer wie mit dem Skalpell eines hochempathischen Chirurgen.“
„›Hier muss es sein‹(zeigt) Maggie O’Farrells herausragende Kunst der Figurendarstellung sowie die Mühelosigkeit, mit der sie Lebensgeschichten miteinander verwebt und diese, wie in ihren späteren Romanen, über raumzeitliche Grenzen hinweg orchestriert.“
„O’Farrell erzählt komplex, einsichtsreich und mit trockenem Humor, sie baut die Erzählung in ungewöhnlichen Geschwindigkeiten ohne billige Emotionalität.“
„Präzise, unbestechlich und zutiefst romantisch.“
„Maggie O’Farrell versteht sich auf Suspense genauso wie auf die Darstellung emotionaler Irrungen und Wirrungen.“
„Familiengeschichte/ n als Zerreißprobe des Lebens, abgründig, tiefsinnig, durchgeknallt, übermütig und voller bizarrer Überraschungen. Das ist der Stoff, aus dem die irischbritische Schriftstellerin Maggie O’Farrell ihre Romane webt.“









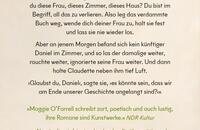
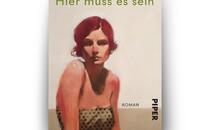
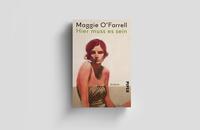
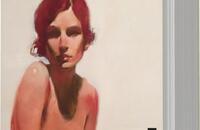
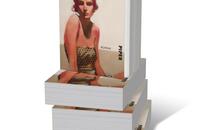
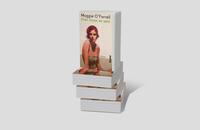
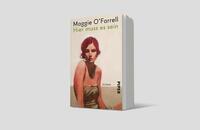
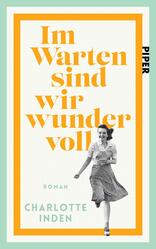
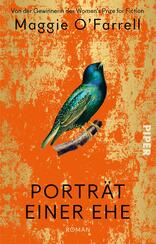

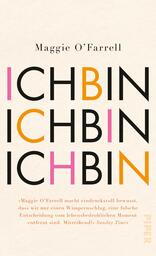

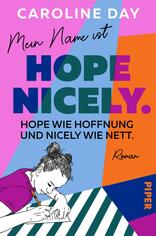
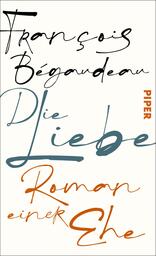
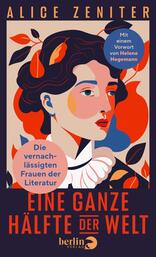

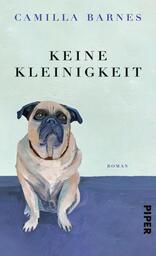


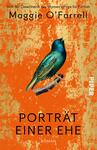
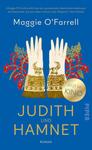
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.