
Höllenjazz in New Orleans (City-Blues-Reihe 1) - eBook-Ausgabe
Roman
„Ein vielversprechendes Debüt, spannend, atmosphärisch dicht, mit ungewöhnlichen ›Helden‹ und einem Hauch von Ironie. Sehr lesenswert. Gerne mehr davon.“ - Ruhr Nachrichten
Höllenjazz in New Orleans (City-Blues-Reihe 1) — Inhalt
Der mysteriöse „Axeman-Mörder“ versetzt ganz New Orleans in Angst und Schrecken. Seine Waffe ist eine Axt, sein Markenzeichen Tarotkarten, die er bei seinen Opfern hinterlässt. Detective Michael Talbot ist mit dem Fall betraut und verzweifelt an der Wendigkeit des Killers. Der ehemalige Polizist Luca d'Andrea sucht ebenfalls nach dem Axeman – im Auftrag der Mafia. Und Ida, die Sekretärin der Pinkerton Detektivagentur, stolpert zufällig über einen Hinweis, der sie und ihren besten Freund Louis Armstrong mitten in den Fall hineinzieht. Als Michael, Luca, Ida und Louis der Identität des Axeman immer näherkommen, fordert der Killer die Bewohner von New Orleans heraus: Spielt Jazz – sonst komme ich, um euch zu holen.
Leseprobe zu „Höllenjazz in New Orleans (City-Blues-Reihe 1)“
Prolog
New Orleans, Mai 1919
Anderthalb Stunden später, als er eigentlich mit der Arbeit hätte anfangen sollen, stolperte John Riley in die Redaktionsräume der Times-Picayune. Er setzte sich an seinen Schreibtisch, nahm langsam einen tiefen Atemzug und hob den Blick, um sich umzusehen. Selbst in seinem benebelten Zustand entgingen ihm die verstohlenen Blicke seiner Kollegen nicht, und er fragte sich, wie derangiert er eigentlich aussah. Er war am Abend zuvor ausgegangen, in sein Stammlokal in der Elysian Fields Avenue. Jetzt hob er eine Hand ans Gesicht, [...]
Prolog
New Orleans, Mai 1919
Anderthalb Stunden später, als er eigentlich mit der Arbeit hätte anfangen sollen, stolperte John Riley in die Redaktionsräume der Times-Picayune. Er setzte sich an seinen Schreibtisch, nahm langsam einen tiefen Atemzug und hob den Blick, um sich umzusehen. Selbst in seinem benebelten Zustand entgingen ihm die verstohlenen Blicke seiner Kollegen nicht, und er fragte sich, wie derangiert er eigentlich aussah. Er war am Abend zuvor ausgegangen, in sein Stammlokal in der Elysian Fields Avenue. Jetzt hob er eine Hand ans Gesicht, um sich davon zu überzeugen, dass er nicht mehr schwitzte. Als seine Finger über mindestens zwei Tage alte Stoppeln strichen, bereute er, dass er sich auf den Weg zur Arbeit gemacht hatte, ohne vorher in den Spiegel zu schauen.
Sein Blick wanderte zu seinem Schreibtisch und landete auf der Schreibmaschine. Der schwarze Metallrahmen, die halbmondförmig angeordneten Typenhebel, die Tasten und Knöpfe gaben dem Ding etwas Einschüchterndes, kalt und hart und außerirdisch, und er merkte, dass er noch nicht fit genug war, um gleich mit dem Schreiben loszulegen. Er brauchte noch ein paar Tassen Kaffee und ein Päckchen Zigaretten und zum Mittag vielleicht einen Brandy, bevor er eine Aufgabe in Angriff nehmen konnte, die ein voll funktionstüchtiges Gehirn erforderte. Den Rest des Vormittags würde er mit etwas verbringen, was fast so gut war wie Arbeit. Er stand auf und ging zum Posteingangskorb, in dem die Leserbriefe lagen, schnappte sich so viele wie möglich, drückte sie an die Brust und kehrte zu seinem Platz zurück.
Er stieß auf die üblichen Briefe von aufgebrachten Bewohnern, von Leuten, die sich beschwerten, von Besserwissern und von denen, die die Leserbriefseite benutzten, um miteinander zu streiten. Er wählte einige längere Hetzschriften zum Abdruck aus, denn die füllten die Seite schneller, dann wandte er sich den Briefen derer zu, die behaupteten, den Axeman gesehen zu haben. Seit es vor einigen Monaten die ersten Morde gegeben hatte, wurde die Redaktion überschwemmt von Briefen besorgter Bürger, die schworen, ihn auf dem Weg zu der einen oder anderen Bluttat gesehen zu haben. Riley seufzte und fragte sich, warum sich die Leute mit so etwas an die Zeitung wandten und nicht an die Polizei. Er zündete sich eine Zigarette an und griff nach dem letzten Brief im Stapel. Der Umschlag sah ungewöhnlich aus, dünn wie Reispapier, ohne Absender, die Redaktionsanschrift der Zeitung in krakeliger Schrift mit einer fleckigen rostfarbenen Flüssigkeit hingekritzelt, von der er hoffte, dass es Tinte war. Er zog an seiner Zigarette und schob den Fingernagel unter die Lasche, um ihn zu öffnen.
Hölle, 6. Mai 1919
Hochverehrter Sterblicher,
man hat mich nicht erwischt, und man wird mich auch nicht erwischen. Niemand hat mich je gesehen, denn ich bin unsichtbar, flüchtig wie der Äther, der Eure Erde umgibt. Ich bin kein Menschenwesen, sondern ein Geist und ein Dämon aus der heißesten aller Höllen. Ich bin der, den Ihr Bürger von New Orleans und Eure dumme Polizei den Axeman nennt.
Wenn es mir genehm ist, komme ich und fordere weitere Opfer. Ich allein weiß, wer sie sein werden. Ich werde keine Spuren hinterlassen, nur meine blutige Axt, beschmiert mit dem Blut und der Gehirnmasse derer, die ich in den Orkus geschickt habe, um mir dort Gesellschaft zu leisten.
Wenn Du möchtest, richte der Polizei aus, dass sie darauf achtgeben soll, mich nicht zu erzürnen. Natürlich bin ich ein vernünftiger Geist. Ich nehme keinen Anstoß daran, wie sie bislang ihre Ermittlungen geführt haben. Ja, sie waren so vollkommen dumm, dass sie nicht nur mich amüsiert haben, sondern auch Seine Satanische Majestät Franz Josef, etc. Aber sag ihnen, sie sollen achtgeben. Sie sollen nicht versuchen herauszufinden, wer ich bin, denn es wäre besser, sie wären nie geboren worden, als den Zorn des Axeman auf sich zu ziehen. Ich glaube nicht, dass diese Warnung nötig ist, denn ich bin überzeugt, dass die Polizei stets einen Bogen um mich machen wird, genau wie bisher. Sie sind klug und wissen sich von allen Gefahren fernzuhalten.
Ihr Bürger von New Orleans betrachtet mich zweifellos als einen abscheulichen Mörder, und das bin ich auch, aber wenn mir der Sinn danach stünde, könnte ich noch viel schlimmer sein. Wenn ich es wollte, könnte ich Eurer Stadt jede Nacht einen Besuch abstatten und nach Belieben Tausende der Besten unter Euch abschlachten, denn ich stehe in intimer Beziehung zum Todesengel.
Also, um genau zu sein, werde ich New Orleans in der nächsten Dienstagnacht um 00:15 Uhr (irdischer Zeit) beehren. Doch in meiner unendlichen Gnade möchte ich Euch Menschen einen kleinen Vorschlag machen. Er lautet wie folgt:
Ich bin ein großer Liebhaber der Jazzmusik, und ich schwöre bei allen Teufeln der Unterwelt, dass jeder verschont werden soll, in dessen Haus zum oben genannten Zeitpunkt eine Jazzband spielt. Wenn überall Jazz gespielt wird, nun, dann umso besser für Euch Menschen. Eines ist sicher, und zwar, dass einige von Euch, die in jener Dienstagnacht nicht jazzen (falls es welche gibt), die Axt zu spüren bekommen werden.
Mich friert, und ich sehne mich nach der Wärme meines heimatlichen Tartarus, und so wird es Zeit, meine Ausführungen zu beschließen und Euer irdisches Heim zu verlassen. In der Hoffnung, dass Du dies veröffentlichst, dass es Dir wohl gehen wird, war und werde ich immer der schlimmste Geist sein, der je existiert hat, sowohl in Wirklichkeit als auch im Reich der Fantasie.
Der Axeman
Riley nahm einen Zug von seiner Zigarette, legte den Brief weg und überlegte, ob er tatsächlich vom Axeman stammte, und wenn nicht, wer zum Teufel sonst so etwas an die Zeitung schickte. Echt oder nicht, es wäre eine Schande, den Brief nicht abzudrucken. Grinsend stand Riley auf, und seine Kollegen wandten sich um und blickten ihm hinterher, als er zum Büro des Chefredakteurs ging. Er verschwendete keinen Gedanken daran, ob er es den Behörden melden sollte, bevor es in Druck ging – in solchen Fällen war es besser, sich hinterher zu entschuldigen, als vorher um Erlaubnis zu bitten. Sie würden den Brief abdrucken, und die Stadt würde ihn lesen, und Chaos würde ausbrechen, und es würde womöglich die fantastischste Nacht werden, die New Orleans je erlebt hatte.
Teil 1
1
Ein Monat zuvor
Im Westen des French Quarter, im Uptown-Slum, den die Einwohner von New Orleans als „Battlefield“ bezeichneten, durchschritt eine schwarze Beerdigungsprozession das granitgraue Schimmern eines nebligen Tagesanbruchs. Die Trauernden, die dunkle Anzüge und Schleier trugen und die Köpfe gesenkt hielten, waren kaum mehr als Schatten, die sich zwischen den Nebelschwaden bewegten, was ihrer Prozession etwas Gespenstisches gab, als wäre die ganze Parade in den Hades gewandert.
Die Beerdigung hatte kurz nach dem Einsetzen der Dämmerung begonnen, als der Sarg aus dem Trauerhaus getragen und auf den Leichenwagen gestellt worden war und die Trauernden sich auf der Straße versammelt hatten. Kaum war alles gerichtet, hatte der Marshal eine schrille, nachklingende Pfeife geblasen, und die fünf Blaskapellen, die man für den Tag angeheuert hatte, stimmten eine langsame, beklemmende Version von Nearer, my God, to Thee an.
Der Marshal, ein majestätischer alter Mann mit ernstem Gesicht in Zylinder, Gehrock und hellgelben Handschuhen, drehte sich auf dem Absatz um und führte den Trauerzug durch die mit struppigem Gras bewachsenen, staubigen Straßen. Direkt hinter ihm kam der Leichenwagen, von Pferden gezogen und mit Satin behängt, schwarze Federbüschel flatterten im Wind. Dann folgten die trauernden Angehörigen, die in Taschentücher weinten, und im Anschluss die fünf Blasorchester, alle Musiker in Zylinder und Frack, die Jacken mit Pailletten und Quasten geschmückt. Hinter ihnen endete der Zug in einem Gedränge aus Bekannten und Nachbarn, Trauernden und den sogenannten „Secondlinern“ – zerlumpten Straßenkindern, die nichts Besseres zu tun hatten, als den ganzen Tag den Paraden durch die Stadt zu folgen, selbst wenn das bedeutete, dass sie sich, wie von einer Sirene gelockt, zu einem der vielen Friedhöfe führen ließen.
Der Mann, der beerdigt wurde, war Mitglied mehrerer schwarzer Clubs gewesen – des Zulu Aid and Pleasure Club, der Odd Fellows, der Diamond Swells, der Young Men Twenties und der Merry-go-Rounds –, und auf dem Weg zum Friedhof machte die Prozession an den Versammlungssälen aller Vereinigungen halt, damit die Clubmitglieder Abschied von ihrem Bruder nehmen konnten. Erst danach bewegte sich der Trauerzug zum Friedhof, und mit jedem Schritt wurden die Lieder schwermütiger. Sobald der Leichenwagen den Friedhof erreichte, verstummten alle Instrumente, bis auf die Snare Drum, die einen traurigen, einsamen Rhythmus schlug, die Trommelstöcke mit einem Taschentuch gedämpft, um das Timbre einer militärischen Kesselpauke nachzuahmen. Und als die Prozession schließlich das Grab erreichte, verstummte auch die Trommel, und für einen kurzen Augenblick herrschte vollkommene Stille.
Dann begann der Prediger mit der Begräbniszeremonie, intonierte gegen den pfeifenden Wind, und als er geendet hatte, warf die Familie Erde ins Grab, einer nach dem anderen, ein Vorgang mit einem ganz eigenen Rhythmus und Beat. Und nachdem der letzte Trauernde eine Handvoll Erde geworfen hatte und die Klumpen auf den Sarg gefallen und an den Seiten hinuntergerieselt waren, wandte sich die Menge erwartungsvoll dem Marshal zu, der zitternd ein paar Schritte abseits auf einem holprigen Streifen Erde stand und dessen Hosenaufschläge im Wind flatterten.
Der alte Mann begegnete ihren eindringlichen Blicken mit großen, trüben Augen, und nach einigen langen Sekunden windumtoster Stille nickte er, hob die Hand an die Brust und drehte seine Schärpe um, sodass sie ihre Festtagsseite zeigte, knallbunte Farben, ein afrikanisches Karomuster in Rot, Gold und Grün, das durch den Nebel leuchtete. Fast im selben Augenblick verwandelte sich die Beerdigungsgesellschaft, als hätte ein Geist die Kontrolle über die Menschenmenge übernommen. Die Clubmitglieder drehten ihre Mitgliedsabzeichen um, die Bandmitglieder taten dasselbe mit ihren Jacken, hier und da war ein Lächeln zu sehen, der Marshal blies seine Pfeife, und ehe sich’s jemand versah, spielten die Bands Tanzmusik – ein derbes, lautes und ironisches Stück: Oh Didn’t He Ramble. Die Bläser schmetterten, die Secondliner tanzten zwischen den Gräbern, und die Clubmitglieder öffneten Bourbonflaschen und brachten einen Toast auf den Verstorbenen aus. Eine Karnevalsatmosphäre erfasste die Parade und trug sie mit sich, als sie sich über den Friedhof zurück auf die Straße schlängelte, wo sich noch mehr Menschen dem Spaß anschlossen und sich eine stetig wachsende Menge von Feiernden aufmachte zum Leichenschmaus.
Als die Beerdigungsprozession in ihrem wohleinstudierten Ritual aus Musik und Bewegung durch die Stadt zog, war unter den Zuschauern auch eine neunzehnjährige zierliche junge Frau in einem roten Sommerkleid, die auf den Namen Ida Davis hörte. Sie hatte kein Problem gehabt, die Beerdigung zu finden – in New Orleans, einer flachen, aus Holz erbauten Stadt mit niedrigen Gebäuden, offenen Flächen, Flüssen und Seen, konnte sich der Schall ungehindert ausbreiten. Ihr Vater, der auch Musiker war, hatte sich oft über das Phänomen geäußert: Es sei fast, als wäre die Stadt als Instrument für die Verbreitung von Musik erbaut worden. Wenn eine Band spielte – und die Bands in New Orleans waren noch dazu besonders laut –, hörte man es in der ganzen Stadt.
So war sie einfach ihren Ohren gefolgt, bis sie auf den Trauerzug gestoßen war, und jetzt beobachtete sie das Treiben mit einem missbilligenden Stirnrunzeln. Nicht dass sie auf die betrunkenen Trauernden oder die Schnorrer oder gar die zerlumpten Straßenkinder in der Secondline herabgesehen hätte. Es war eher die Ironie des Ganzen, die ihr Missfallen erregte. In Louisiana war es Schwarzen selten erlaubt, ihre Kultur offen zum Ausdruck zu bringen, und eine Beerdigung bot die rare Gelegenheit zur öffentlichen Entfaltung. Es war der einzige Anlass, bei dem die Unterdrückten mit Pomp behandelt wurden, und darüber runzelte sie die Stirn: dass man einem Schwarzen nur dann mit Würde begegnete, wenn er tot war und er nichts mehr davon hatte.
Sie trat vom Bürgersteig, schob sich an den Reihen der Trauernden vorbei und blickte in die Gesichter der Musiker. Sie suchte ihren besten – womöglich ihren einzigen – Freund, einen jungen Hornisten am zweiten Kornett, der die Aussprache seines Namens noch nicht in die französische Form Louey geändert hatte, sondern Ida und allen anderen in Battlefield als Lil’ Lewis Armstrong bekannt war.
Sie entdeckte ihn bald am Kopfende der Prozession, wo er eine flotte Interpretation von High Society mitspielte. Lewis bemerkte sie und hob die Augenbrauen; dann blies er, ohne Rhythmus oder Tonart zu wechseln, auf dem Kornett zum Gruß einen komplizierten Tusch. In der Menge jubelten einige trunken, und Lewis reichte sein Kornett einem der Secondliner, einem hoch aufgeschossenen barfüßigen Jungen in einem verschlissenen weißen Hemd.
Lewis löste sich aus der Gruppe der Musiker und ging zu Ida, wobei ihn seine zu enge Smokinghose beim Gehen behinderte. Lewis war fast neunzehn, er hatte dunkle Haut und ein pausbäckiges Gesicht, das wie geschaffen war für sein charakteristisches Grinsen. Ida war in fast jeder Hinsicht genau das Gegenteil – schlank und bedächtig, die Haut einen Hauch dunkler als Milch und ein mandelförmiges Gesicht, nach dem sich die Leute umdrehten. Sie war auch ein wenig schüchtern – was daher rührte, dass sie so hellhäutig war, dass sie leicht als Weiße durchging. Das bescherte ihr in Battlefield nicht viele Freunde.
Lewis tippte an seinen Hut und lächelte. „Hey, Ida“, sagte er, „alles klar?“
Seine Stimme war weich und tief, rau von Tabak und Schnaps, und Ida war überrascht, darin nicht die geringste Spur von Verlegenheit oder Neugier zu vernehmen. Sie hatte ihn seit Monaten nicht besucht, und jetzt war sie ausgerechnet in Battlefield aufgetaucht, unangekündigt und beschämt.
„Ja“, sagte sie und lächelte matt. Sie war hergekommen, um ihn um einen Gefallen zu bitten. Er sollte ihr bei einer Recherche helfen. Doch als sie jetzt vor ihm stand, wusste sie nicht recht, wie sie ihre Bitte vorbringen sollte. Es war so lange her, seit sie ihn das letzte Mal gesehen hatte, und es war schwer, sich über den Lärm der Bands hinweg zu verständigen, die auf das heisere Crescendo ihrer immer wilder werdenden Interpretation von High Society zusteuerten.
Lewis schaute sie neugierig an, er ahnte offensichtlich, dass etwas im Busch war.
„Wenn du reden willst“, sagte er, „können wir uns beim Leichenschmaus treffen.“
Ida hatte eigentlich gehofft, sich vor dem Leichenschmaus drücken zu können.
„Klar“, antwortete sie laut über die Musik hinweg. „Wo findet der statt?“
Lewis grinste sie an, ein Funkeln in den Augen. „Folge einfach der Band“, sagte er mit einem Achselzucken, und bevor Ida sich’s versah, mussten sie beide kichern. Er verabschiedete sich, indem er an seinen Hut tippte, und ging zurück zu den Feiernden. Die Band stimmte gerade die ersten Takte von The Beer Barrel Polka an, und Ida sah zu, wie der Secondliner Lewis sein Kornett zurückgab. Dann nahm ihr Freund seinen Platz wieder ein und verschmolz mit der dunklen Parade, die sich trunken die Straße hinaufwälzte und mit ihrer Musik und ihrem Lärm wieder im Nebel verschwand.
2
Ein schwarzer Landaulett-Polizeiwagen jagte durch die nebligen Straßen von Little Italy, während der Fahrer, um bloß keinen Unfall zu bauen, wild auf die Hupe drückte. Er schlitterte an Marktständen, Bauernkarren und verdutzten Fußgängern vorbei und holperte in den engen Straßen hier und da über Bordsteine und Gehwege. An der Kreuzung Upperline und Magnolia Street lenkte er den Wagen um eine spitze Ecke und kam einen halben Block vor einem Lebensmittelladen mit quietschenden Bremsen zum Stehen. Mit einem erleichterten Seufzer sank Detective Lieutenant Michael Talbot auf die Rückbank.
„Toller Fahrstil, Rez.“
„Danke“, antwortete der Fahrer, dem Talbots sarkastischer Unterton entgangen war. Durch die Glasscheibe, die die beiden Männer trennte, beobachtete Michael, wie er eine Taschenuhr aufklappte und nach der Zeit sah.
„Sieben Minuten und fünfundzwanzig Sekunden“, sagte der Fahrer, ein rundlicher, dunkelhäutiger Mann namens Perez. „Das ist bestimmt ’n Rekord“, fügte er hinzu und schenkte Michael im Rückspiegel ein Lächeln. Michael erwiderte es matt, denn ihm war immer noch ein wenig übel.
Perez kramte auf dem Armaturenbrett nach einem Notizblock und schrieb mit einem Bleistiftstummel die Zeit auf. Die Polizei von New Orleans hatte vor nur wenigen Monaten ihre ersten motorisierten Einsatzwagen bekommen, und die Fahrer in den verschiedenen Polizeibezirken hatten, wenn Michael es richtig mitbekommen hatte, eine Art Wette darüber abgeschlossen, wie schnell sie ihre jeweiligen Routen zurücklegen konnten. Drei der neuen Automobile waren bereits zu Schrott gefahren worden, eines von Perez.
Michael gab seinem Magen eine Minute, um sich zu beruhigen, dann verrenkte er den Rücken, um aus dem Heckfenster zu schauen. Sein Blick fiel auf den ärmlichen Lebensmittelladen an der Ecke, ein Stück die Straße hinunter. Ein typischer Laden italienischer Einwanderer, wie es sie in der ganzen Stadt gab – einstöckig, vorne das Geschäft, hinten die Wohnung, dahinter ein Hof für die Lieferungen, und über der ganzen Bruchbude ein schaukelndes Blechschild, das stolz den Namen des Besitzers verkündete. Michael rieb sich seufzend das Gesicht, strich mit den Fingern über die Pockennarben auf seinen Wangen.
Vor dem Laden, zwischen der Kutsche der Polizei und der des Leichenbeschauers, hatte sich eine Menschenmenge versammelt – Italiener aus dem Viertel, die von einer Gruppe Streifenbeamter halbherzig zurückgehalten wurden. Michael sah, dass es nicht die üblichen Gaffer waren, die sich immer an Schauplätzen grässlicher Verbrechen einfanden – Passanten, Nachbarn, Reporter und die, die immer an den Straßenecken herumhingen, weil sie nichts Besseres zu tun hatten. Die Menschen hier hatten sich nicht aus makabrer Neugier versammelt. Sie waren gekommen, weil sie Angst hatten, und bei ihrem Anblick wurde es Michael eng ums Herz. Wie er die menschliche Natur kannte, brauchte es nicht viel, damit ein ängstlicher Mob gewalttätig wurde.
„Auf in die tobende Menge“, murmelte er leise.
„Wie bitte?“, fragte Perez mit gerunzelter Stirn, sah von seinem Notizblock auf und blickte in den Rückspiegel. Doch Michael hatte bereits die Tür geöffnet, setzte seinen Homburg auf und trat hinaus auf die Straße.
Er beschloss, um die Polizeiabsperrung herum zu gehen, weil er hoffte, unbemerkt zu bleiben, aber Michaels Statur war außergewöhnlich und leicht auszumachen. Er war einen Kopf größer als die meisten anderen Männer und hatte schlaksige, ungelenke Gliedmaßen und ein Gesicht, das von Pocken rot und narbig war. Als er sich dem Kordon näherte, zog er den Homburg tief ins Gesicht, doch ein Reporter mit glänzenden Knopfaugen drehte sich genau im falschen Moment in seine Richtung. Michael sah, dass er einen Kollegen anstieß und ihm etwas zuflüsterte, und im nächsten Augenblick explodierte die Menschenmenge. Kameras schwenkten auf ihn, und zahllose Blitzlichter zuckten auf, ließen puffend kleine Rußwolken aufsteigen, die sich mit dem Nebel vermischten. Die Zeitungsmänner riefen seinen Namen und bellten Fragen. Wütende italienische Sätze flogen ihm um die Ohren. Er ging einfach weiter, schob sich durch die Menge, und mit ein wenig Schieben und Drängeln gelangte er zum Kordon und hindurch auf die andere Seite. Er nickte einigen Streifenbeamten, die er erkannte, kurz zu, verdrießliche Männer mit versteinerten Mienen, von denen keiner seinen Gruß erwiderte. Ein junger ernster Streifenpolizist in gestärkter blauer Uniform kam die Stufen vom Eingang herunter, um ihn zu begrüßen.
„Morgen, Sir. Die Opfer sind dort drinnen“, sagte er, ein Grünschnabel namens Dawson, frisch aus dem Krieg zurückgekehrt und begierig, sich zu bewähren. Mit einem Lächeln zeigte er auf die Ladenfront, eine Geste, die, wie Michael fand, etwas von einem Oberkellner hatte. Er nickte zum Dank, und Dawson führte ihn die Stufen hinauf in den düsteren Lebensmittelladen.
Das Ladenlokal war ringsum von ordentlichen Kiefernregalen gesäumt, vollgestellt mit Fisch- und Fleischkonserven und allerlei italienischen Delikatessen, von denen Michael noch nie gehört hatte. An einer Wand stand ein hoher Stapel Fässchen mit Olivenöl, und an den Dachbalken hingen wie Girlanden Sträußchen aus getrockneten Oreganozweigen, was dem Raum in Michaels Augen etwas Höhlenartiges verlieh.
Im hinteren Teil des Ladens befanden sich eine Glastheke mit Brot und stinkendem Käse und eine Wurstschneidemaschine, deren Kurbel und rundes Schneideblatt schimmerten. Auf dem Schlitten lag noch eine Schweinshaxe. Daneben stand die Registrierkasse, die, wie Michael erwartet hatte, unberührt war. Dahinter führte eine Tür zur Wohnung. Sie näherten sich ihr, und Dawson hob noch einmal die Hand. Michael, der nicht wusste, was er von dem Jungen halten sollte, nickte und lächelte. Er nahm seinen Homburg ab und trat durch die Tür.
Das vollgestopfte Wohnzimmer wurde von einer schmierigen Lampe beleuchtet. Mehrere Beamte waren darin bei der Arbeit, und so wirkte es noch kleiner. Zwei Streifenpolizisten waren mit der Inventarisierung beschäftigt, ein Leichenbeschauer beugte sich über eines der Opfer, und ein Fotograf, ein Franzose mit einem Porträtstudio in Milneburg, bereitete gerade eine neue Zelluloidrolle für seine Kamera vor.
Michael inspizierte das Zimmer – ein dunkler Holztisch und eine Anrichte nahmen den meisten Raum ein, ein Fenster blickte auf die Außenwand des Nachbarhauses, und eine Tür führte in die Küche. Kein Möbelstück war verrückt oder umgeworfen, und an einem Ende des Tisches lag eine Bibel. Die Wände waren mit einer Blumentapete verziert, vergilbt, alt und stockfleckig. Fotografien ernster alter Sizilianer wetteiferten mit einer Sammlung billiger religiöser Bilder – Kruzifixe, Madonnen, Postkarten von Kathedralen und Pilgerorten – um Platz an der Wand. Im Durchgang zur Küche lagen in einer dunklen, teils schon geronnenen Blutlache zwei Tote auf dem Linoleum.
Michael kniete sich neben die Opfer. Die Frau war klein und mollig und hatte faltige Haut und graues Haar. Getrocknetes Blut hatte ihr Nachthemd an den Speckrollen um ihre Taille festgeklebt und zeichnete ihre kurvige Gestalt nach. Ihr Gesicht konnte Michael nicht erkennen, es war mit einem scharfen Gegenstand so rabiat traktiert worden, dass es weniger einem menschlichen Kopf ähnelte als einem Krater. Um die Lippen summte aufgeregt eine Handvoll Fliegen.
Der Mann war am Fenster zusammengebrochen. Der Arzt, der die Leiche noch untersuchte, versperrte Michael größtenteils die Sicht, doch er erkannte, dass der Mann ähnliche Verletzungen aufwies wie seine Frau. Sein rechter Arm war ausgestreckt und zeigte auf die Anrichte, über deren untere Schubladen sich fingerbreite blutige Linien zogen.
Michael schüttelte den Kopf und warf einen letzten, betrübten Blick auf die beiden Toten. Er hatte gelernt, dass es das Beste war, nicht zu viel über die Grausamkeiten nachzudenken, mit denen er in seinem Beruf konfrontiert war. Also bekreuzigte er sich nur, stand auf und streckte die Knie durch, um die Spannung daraus zu vertreiben. Hinter ihm machte der Fotograf eine Aufnahme, und mit einem Knall durchbrach der Blitz die Stille.
Michael wischte das Blut von den Sohlen seiner Florsheim-Schuhe an einem Perserteppich ab, der ohnehin schon ruiniert war, und machte einen Schritt über die Leiche der Frau hinweg, um in die Küche zu gelangen. An einem Schrank lehnte eine Axt mit grob behauenem Stiel. Auf dem blutbesudelten Axtblatt bemerkte Michael Knochensplitter. Im Spülbecken waren noch mehr Blut und ein paar Dreckklumpen. Die Tür von der Küche in den Hof war von außen aufgebrochen worden, der Rahmen um das Schloss vollkommen zersplittert. Michael ging hinaus, und die morgendliche Kälte schlug ihm ins Gesicht. Auf allen drei Seiten versperrten hohe Holzzäune die Sicht. Eine gruselige Stille lag über dem Hof. Neben der Tür stand ein schiefer Brennholzstapel, und dahinter erstreckte sich eine kahle Fläche, auf der sich nur Unkraut und rostiger Schrott fanden. Michael sah sich einen Augenblick um, dann kehrte er in die feuchte Wärme des Wohnzimmers zurück.
„Dawson! Was haben wir bis jetzt?“ Er zog einen Stuhl unter dem Tisch heraus, setzte sich und bedeutete dem jungen Polizisten, es ihm nachzutun. Dawson nahm Platz und las aus einem mit Glanzleder bezogenen Notizbuch vor. „Die Opfer sind Mr und Mrs Joseph Maggio, achtundfünfzig beziehungsweise einundfünfzig Jahre alt. Einwanderer aus Sizilien. Besitzen den Laden seit einigen Jahren. Nachbarn sagen, sie seien von Gretna hergezogen. Ich habe bei der Polizeidirektion angerufen, sie sind beide noch nie mit dem Gesetz in Konflikt gekommen.“
Michael nickte. Mr und Mrs Maggio passten ins Profil – sizilianische Ladenbesitzer ohne kriminelle Verbindungen, scheinbar willkürlich ausgewählt. Bei den vorherigen Überfällen hatte sich der Mörder, von der Presse „Axeman“ getauft, in der Nacht Zugang zu den Wohnungen und Häusern seiner Opfer verschafft und sie, wie der Name schon sagte, mit einer Axt getötet. Dabei hatte er offensichtlich großes Vergnügen empfunden und nicht das geringste Interesse an Raub oder sexuellen Übergriffen erkennen lassen. Abgesehen von den Maggios hatte der Axeman bereits drei Familien heimgesucht und unter anderem ein Kleinkind und dessen Mutter ermordet. Und jedes Mal hatte er mehr Gewalt angewendet, grauenvoller und rasender.
„Die Nachbarn haben nichts Ungewöhnliches bemerkt“, fuhr Dawson fort. „Niemand ist gekommen oder gegangen, es gab kein Geschrei oder Gebrüll, keinen Lärm, der auf einen Einbruch hingedeutet hätte.“
„Wie hat er sich Zugang verschafft?“
„Bis jetzt gibt es keinen Hinweis darauf, wie er rein- und wieder rausgekommen ist. Und nun kommt das Beste, Sir: Als die Leichen entdeckt wurden, war das Zimmer von innen abgeschlossen.“
Der Mörder hatte die Gewohnheit, Räume so zurückzulassen. Entweder verschwand er durch die Fenster, die hinter ihm zufielen, oder er schloss von außen mit einem Dietrich ab, wenn er fertig war. Diese Erklärungen hatten die Presse nicht daran gehindert, den Axeman als eine Art übernatürliches Wesen darzustellen, das die Fähigkeit besaß, durch Wände zu gehen. New Orleans war schon in guten Zeiten ein Ort, an dem der Aberglaube blühte, und jetzt fühlte sich ein beträchtlicher Teil der Stadt erst recht von irgendeinem Dämonen bedroht.
„Wer hat die Tür eingetreten?“, fragte Michael, der sich an die Szene hinter dem Haus erinnerte.
„Das war …“ Dawson blätterte in seinem Notizbuch. „Streifenbeamter D. Hancock, Sir. Die Nichte der Frau hat die Toten entdeckt. Sie hat im Laden ausgeholfen. Als sie heute Morgen kam, hat ihr niemand aufgemacht, deswegen ist sie ums Haus gegangen. Hat die Leiche der Frau durchs Fenster erspäht. Hancock war als Erster am Tatort.“
„Tarotkarten?“, fragte Michael.
Dawson nickte, nahm zwei blutverschmierte Karten von der Anrichte und reichte sie ihm. Michael musterte sie – die Gerechtigkeit und das Gericht. Wie die, die sie bei den vorherigen Opfern gefunden hatten, waren sie teuer gefertigt, handbemalt, größer als normale Spielkarten und in grellen Rot- und Lilatönen koloriert, die Umrisse in schwarzer und goldener Tusche. Die Gerechtigkeit zeigte einen Mann in einer Robe, der auf einem Thron saß, in der einen Hand ein Schwert, in der anderen die Waage. Das Gericht zeigte einen Engel, der hoch über einer höllischen, kargen Landschaft flog, während eine Gruppe nackter Sünder ihn vom Boden aus anflehte. Die Rückseite wies das für Spielkarten typische kunstvolle monochrome Muster auf, doch auf diesen beiden waren winzige Tiere in das Muster verwoben. Die Tiere schienen einander zuzurufen, gegen ihr geometrisches Gefängnis anzuschreien.
„Wo wurden sie gefunden?“, fragte er, indem er Dawson die Karten zurückgab.
„In den Köpfen der Opfer, Sir“, sagte Dawson verlegen. „Sie wurden in die Wunden geschoben.“
Michael nickte. Er wusste, dass die Mafia bei Hinrichtungen manchmal Tarotkarten hinterließ, Visitenkarten, um den Leuten klarzumachen, was denjenigen drohte, die nicht spurten. Doch Michael wusste auch, dass die Mafia keine Großmütter und Kinder umbrachte. Und wenn diese Tat eine Hinrichtung war, was hatte ein gottesfürchtiges älteres Ehepaar getan, um sie zu verdienen?
Die meisten Morde wurden von Menschen begangen, die den Opfern bekannt waren, und die verschiedenen Gemeinschaften in New Orleans blieben für sich. Wenn ein Sizilianer umgebracht wurde, war der Täter mit allergrößter Wahrscheinlichkeit ein anderer Sizilianer. Und da die Opfer alle Ladenbesitzer waren und sizilianische Ladenbesitzer unvermeidlich mit der Mafia zu tun hatten, zeigte alles in eine Richtung – Die Familie. Doch die Grausamkeit, mit der die Taten verübt worden waren, und die Tarotkarten, die man mit Voodoo in Verbindung brachte, hatten die halbe Stadt davon überzeugt, der Axeman wäre ein Schwarzer – auch wenn bisher kein einziger Mensch den Mörder tatsächlich gesehen hatte. In ganz New Orleans wurden farbige Männer vom Mob durch die Straßen gejagt. Es war nur eine Frage der Zeit, bis es zu einem Lynchmord kam.
Der Axeman fachte Misstrauen an in einer Stadt, die ohnehin schon voller Misstrauen war. Alle Gemeinschaften in New Orleans schotteten sich von ihren Nachbarn ab. Die farbigen Kreolen im Norden, die Iren im Süden, die Schwarzen im Westen, die Italiener in Little Italy, dazwischen überall verstreut wie Bauern auf einem Schachbrett kleine Enklaven anderer Gruppen – Chinesen, Griechen, Deutsche, Juden. Nur mitten im Stadtzentrum, im French Quarter, in Storyville und im Geschäftsviertel, vermischten sie sich. Eine solche Absonderung führte zu Misstrauen, und das Misstrauen verstärkte wiederum die Absonderung. Nun hielt dieser Axeman eine Flamme unter das Ganze, und die Menschen rieben sich aneinander, bis die Funken flogen. Und Michael war der Mann, den die Stadt damit betraut hatte, alldem ein Ende zu bereiten.
Aus dem Hof drang das Hämmern eines Spechts ins Zimmer. Im selben Augenblick erhob sich der Arzt mit einem Stöhnen. Er war ein wohlbeleibter alter Mann mit rostfarbener Haut. Ein kunstvoller weißer Schnurrbart zierte seine Oberlippe, im viktorianischen Stil zu einem Walrossschnauzer frisiert.
„Die Knie sind auch nicht mehr das, was sie mal waren“, sagte er mit rauer Zigarrenraucherstimme. Er trat an den Tisch, ließ sich zu Michael und Dawson auf einen Stuhl fallen und kramte in seinen Taschen nach einem Päckchen Fonsecas. Er bot Michael eine Zigarre an, doch der winkte ab.
„Ich habe meine eigenen“, sagte er, holte ein silbernes Zigarettenetui aus seiner Tasche, klappte es auf und nahm eine Virginia Bright heraus. Der Arzt riss ein Streichholz an, und die beiden Männer teilten es sich.
„Dieselbe alte Geschichte“, seufzte der Arzt, schüttelte die Flamme aus und warf das Streichholz auf den Tisch. „Die Opfer wurden nach der bekannten Methode getötet. Den Todeszeitpunkt schätze ich auf zwischen elf und eins letzte Nacht. Kein Hinweis auf eine Vergewaltigung. Mehr kann ich im Augenblick noch nicht sagen.“ Der Arzt zuckte mit den Achseln und nahm einen kräftigen Zug an seiner Zigarre. „Was meinen Sie?“, fragte er Michael und hob die Augenbrauen. Diesen erwartungsvollen Blick hatte Michael seit Beginn der Mordserie schon öfter gesehen. Er musterte die beiden Toten, die auf dem Boden lagen, kaum einen Meter von ihm entfernt.
„Ich meine, gegen elf oder zwölf Uhr letzte Nacht haben sich die Maggios hier in ihrem Wohnzimmer aufgehalten. Die Frau hat da drüben gesessen und in der Heiligen Schrift gelesen.“ Michael zeigte auf die Bibel am hinteren Ende des Tisches. „Was der Mann gemacht hat, kann ich nicht sagen. Vielleicht hat sie ihm vorgelesen. Jedenfalls hat er hier gesessen, in der Nähe der Anrichte. Der Mörder ist durch die Hintertür ins Haus gekommen, denn die Haustür liegt an einer Hauptstraße, und von hinten musste er nur über den Zaun klettern. Er hat das Schloss der Küchentür geknackt. Der Gartenzaun ist so hoch, dass er sich dabei Zeit lassen konnte. Die Axt hat er sich vom Brennholzhaufen genommen, denn ich habe dort nirgendwo eine Axt gesehen, und der Mörder wäre ein Narr gewesen, eine Waffe mit sich herumzutragen, wenn er wusste, dass hier eine bereitlag. Die Frau hört ein Geräusch, da ist der Axeman auch schon im Wohnzimmer. Sie steht auf, weil sie am nächsten zur Küche sitzt. Sehen Sie, wie sie am Boden liegt?“ Er zeigte auf die Tote. „Der Mörder greift sie zuerst an. Der Mann sieht, was passiert, und will etwas aus der Anrichte holen, vielleicht eine Waffe, aus einer der unteren Schubladen. Aber er ist nicht schnell genug. Er versucht weiter, die Schublade zu öffnen, während der Mörder auf ihn einschlägt, deswegen das Blut an der Anrichte. Der Axeman lässt sich Zeit, seine Opfer zu verstümmeln. Dann geht er in die Küche und beseitigt die Spuren. Die Axt lässt er da. Ich schätze, er hat sich das Blut von den Händen, Kleidern und Stiefeln gewaschen, denn im Spülbecken sind Blut und Erde. Er geht raus und schließt die Tür von außen mit einem Dietrich ab. Doch das sind nur Vermutungen, denn Streifenpolizist D. Hancock hat bei seinem eiligen Eindringen ins Haus einen entscheidenden Hinweis zerstört. Der Mörder verlässt das Haus, ohne dass irgendetwas an ihm auf seine Tat hinweist. Nicht einmal ein Blutfleck unter seinem Stiefel. So in etwa.“
Michael zog an seiner Zigarette und blickte wieder auf die beiden Toten. „Was ich noch nicht verstehe“, sagte er langsam, „ist, wie der Mörder von der Frau zu dem Mann kommt, ohne dass einer von den beiden einen Schrei ausstößt.“
„Vielleicht hat er die Frau bewusstlos geschlagen“, warf Dawson ein, „und hat dann die Axt quer durchs Zimmer nach dem Mann geworfen, also wie die Indianer.“ Dawson mimte, was er für den weit ausholenden Wurf eines Apachen hielt, um zu demonstrieren, was er meinte.
Michael und der Arzt sahen einander an. „Vielleicht“, sagte Michael. „Aber was auch immer er gemacht hat, er war schnell.“
Er wandte sich den beiden Polizisten zu, die eigentlich mit der Untersuchung des Zimmers beschäftigt waren, aber innegehalten hatten, um Michaels Theorie zu lauschen.
„Haben Sie schon die Anrichte überprüft?“, fragte er sie.
„Nein, Sir“, antwortete einer der Männer.
„Dann schauen wir doch mal, was Mr Maggio herausholen wollte.“
Er trat vor die Anrichte und öffnete die unterste Schublade, in der zwei ordentliche Stapel Leintücher lagen. Er runzelte die Stirn, kramte unter den Stapeln herum und zog einen Schuhkarton heraus. Als er ihn öffnete, quollen ihm Papiere entgegen – Rechnungen, Quittungen, die Einbürgerungspapiere des Ehepaars und mehrere Bündel neuer Fünf-Dollar-Scheine.
„Er wollte sich wohl freikaufen“, sagte der Arzt.
Nachdenklich blätterte Michael in einem der Geldbündel. Das Siegel der US-Staatskasse war in Rot gedruckt, was ausschließlich Federal-Reserve-Scheinen vorbehalten war, und die waren seit fast fünf Jahren nicht mehr ausgegeben worden.
„Diese Scheine sind unbenutzt“, stellte Michael fest. „Glatt wie an dem Tag, an dem sie gedruckt wurden.“
„Na und?“, erwiderte der Arzt mit einem Achselzucken.
„Entweder hat Maggio die vor fünf Jahren von der Bank bekommen, und sie waren seither hier versteckt, oder es sind Blüten.“
Michael nahm den Schuhkarton aus der Schublade und reichte ihn Dawson.
„Setzen Sie sich mit dem Bureau of Engraving and Printing in Verbindung, und überprüfen Sie die Seriennummern. Niemand bewahrt so viel Geld fünf Jahre lang in einer Schublade auf. Besonders nicht in New Orleans.“
Dawson nahm den Schuhkarton und nickte. Michael verlor sich einen Augenblick lang in Gedanken, und in der Stille drang wieder das Hämmern des Spechts herein.
„Was ist mit der Schmiererei?“, fragte der Arzt.
„Welcher Schmiererei?“
Dawson führte Michael in den Hof hinterm Haus und seitlich um das Gebäude herum. In dreißig Zentimeter großen krakeligen braunen Buchstaben standen auf der Außenwand des Ladens die Worte:
WENN ICH FERTIG BIN, WIRD MRS TENEBRE GENAUSO DASITZEN WIE MRS MAGGIO.
Michael starrte darauf und schüttelte den Kopf. War der Axeman eigens hier stehen geblieben, um ihnen eine Nachricht zu hinterlassen? Wollte er ihnen sagen, wer als Nächstes auf seiner Liste stand? Provozierte er die Polizei, um sich über sie lustig zu machen, oder ging es ihm vielmehr darum, zukünftige Opfer in Angst und Schrecken zu versetzen?
„Der Franzose soll ein paar Fotos davon machen“, sagte Michael zu Dawson, wobei er auf die Schmiererei deutete, „und dann hängen Sie was drüber, bevor es einem von den Eseln da draußen zu Gesicht kommt. Dann gehen Sie zurück aufs Revier und suchen sämtliche Personen mit dem Namen Tenebre in der Stadt, Männer und Frauen. Ich will die Liste heute Nachmittag auf meinem Schreibtisch haben.“
Dawson tippte an seinen Hut und eilte davon. Michael blieb noch einen Augenblick stehen, die Hände in den Hüften, dann drehte er sich um und inspizierte erneut den Hof. Überall war Unrat verstreut: Konservendosen, Zeitungen, zerbrochene Latten von Packkisten, und in einer Ecke rostete ein Grill vor sich hin, verbogen und unbenutzt. Ein Teppich aus Unkraut und Sträuchern war im ganzen Hof gewachsen und hatte den Boden verschluckt. Der Anblick hatte etwas Trauriges und Verlorenes. Den Maggios war es nicht gelungen, sich von dem Schmutz der Straßen abzuschirmen. Er dachte kurz an sein eigenes Haus, an die Menschenmenge vor dem Laden, an das Gewicht der Erwartungen der ganzen Stadt auf seinen Schultern. Zwei weitere Leichen und die dreißig Zentimeter hohe Botschaft des Mörders, dass es bald ein weiteres Opfer geben werde. Michael schüttelte den Kopf, bekreuzigte sich noch einmal und ging wieder hinein.
3
Westlich von New Orleans, am Rand einer ländlich geprägten Kleinstadt namens Boutte, stand inmitten von trockenen, staubigen Höfen und mehreren Stacheldrahtzäunen eine Handvoll scheunenartiger Gebäude. Diese aus dicken Balken gefertigten Verschläge mit den schwarz übermalten Fensterscheiben dienten dem Staat Louisiana als Zwischenstation für Häftlinge, die überstellt wurden. Die Gefangenenbaracken befanden sich in der Mitte der Anlage, und als die Tür eines der Gebäude aufschwang, hallte ein lautes Dröhnen über das Gewirr aus Hütten, Einfriedungen und Zäunen.
Zwei Männer traten hinaus in den kühlen Morgen und schlurften im Gänsemarsch in die Ecke des Hofes. Der Kies unter ihren Schuhen knirschte im Rhythmus ihrer Schritte. Der erste Mann war ein Inhaftierter auf dem Weg in die Freiheit; er hatte in der Nacht zuvor seine fünfjährige Haftstrafe abgesessen. Seine Hände steckten vor dem Körper in Handschellen, und er trug einen zerknitterten, mottenzerfressenen blauen Baumwollanzug. Er war am Vortag bei Sonnenuntergang mit dem Gefangenentransportwagen hier angekommen, der zwischen Boutte und Angola, dem Staatlichen Zuchthaus von Louisiana gut zweihundert Kilometer nordwestlich, hin und her fuhr.
Der Gefangene hatte die Nacht in der eisigen Baracke verbracht und trotz der Kälte gut geschlafen, denn er war müde gewesen von der Fahrt. Der Wagen hatte von der isolierten Biegung des Mississippi, in der Angola lag, weit oben, an der Grenze zum Nachbarstaat, über einen Tag bis hierher gebraucht. Gefangene wurden niemals nach Einbruch der Dunkelheit transportiert, und die Aufsichtsbehörde nutzte die Zwischenstation, um Rast zu machen – diese war das allerletzte Glied in der Kette stacheldrahtbewehrter Zwischenstationen, die bis hinunter nach New Orleans reichte.
Einige Minuten nach Tagesanbruch war der Gefangene vom Stoß eines Schlagstocks in den Bauch geweckt worden, und jetzt ging er unter Bewachung an dem Besitzer des Schlagstocks vorbei, einem ominösen Mann in einer königsblauen Aufseheruniform, der ihn mit zusammengekniffenen Augen anstarrte. Nachdem er vier Höfe durchquert und viermal an den Toren gewartet hatte, bis diese von den Wachen aufgeschlossen worden waren, erreichten sie schließlich das Eingangstor zum Gelände.
„Patterson!“, rief der Aufseher.
In der Tür eines Wachhäuschens tauchte ein zahnloser Strich von einem Mann mit einer Schrotflinte über der Schulter auf und grinste sie an. Er schlenderte aus der Hütte, trat an die Querstangen, die das Eingangstor sicherten, und schloss die Schlösser daran auf. Dann hievte er die Querstangen zur Seite und öffnete das Tor, das mit der Unterkante über den holprigen, lehmigen Weg schleifte.
Der Wärter tippte dem Gefangenen mit dem Schlagstock an die Schulter, und dieser drehte sich zu ihm um. Luca D’Andrea war ein schmächtiger, dunkelhaariger Mann Anfang fünfzig mit einem gut aussehenden, wenn auch eingefallenen Gesicht, in dem unter einer weichen, sorgenvollen Stirn braune Augen funkelten. Die Schlüssel klimperten, als der Wärter die Handschellen öffnete, und Luca rieb sich die Handgelenke. Dann nickte er, wie um sich bei seinem Aufseher zu bedanken, und trat durch das Tor hinaus auf die Straße.
Boutte war nichts Besonderes. Der Weg war ausgefahren und staubig, und auf beiden Seiten erstreckte sich bis zum Horizont ödes Buschland, bis auf ein paar vereinzelte verkrüppelte Bäume. Wenn es einen Punkt gab, der Lucas Übergang vom Gefangenen zum freien Menschen markierte, dann war es dieser, doch er empfand keine Freude und kein Freiheitsgefühl, nur eine schwere, ängstliche Unsicherheit – dasselbe Grauen, das ihn auch schon in den Monaten vor seiner Freilassung gequält hatte.
In den Jahren seiner Gefangenschaft hatte er zwei ordentliche Mahlzeiten am Tag bekommen, einen Platz, um seinen Kopf niederzulegen, und so viel Arbeit, dass er nicht allzu viel über die traurigen Wendungen grübeln konnte, die sein Leben genommen hatte. Von der Morgendämmerung bis zum Abend hatte er sechs Tage die Woche auf der Gefängnisplantage gearbeitet, die so groß war wie Manhattan, für den Profit der Gefängnisleitung. Angola hatte seinen Namen von der Plantage, auf der die Haftanstalt errichtet worden war, und die Plantage war nach dem Heimatland der Sklaven benannt worden, die das Land einst urbar gemacht hatten. Das führte dazu, dass die Insassen darüber sinnierten, dass der Name Angola angesichts von knallharten Sklaventreibern, Fesseln und Ketten nicht der einzige Teil der Sklavenvergangenheit war, der bis in die Gegenwart fortbestand.
Doch im Unterschied zu den meisten seiner Mitgefangenen hatte Luca die Arbeit nicht ungern gemacht. Er hatte draußen auf den Feldern eine Gelassenheit verspürt, die er bis dahin nicht gekannt hatte, er hatte seinen Platz in der Welt akzeptiert, und das hatte ihn beruhigt. Aber jetzt hatte er keine Arbeit mehr, die ihn daran hinderte, über die Erinnerungen zu grübeln, die er lieber vergessen würde, und seine Tage erstreckten sich so leer in die Zukunft wie das Buschland vor ihm.
Er spähte die Straße hinunter. Am Horizont war New Orleans gerade eben so zu erkennen; die Silhouette der Stadt tanzte in dem flirrenden Nebel, der am Boden waberte. Er fand, es habe etwas vage Weibliches, wie das Bild sich im Dunst bewegte, wie ein Showgirl in einer Bar.
„Es ist ein langer Weg nach Big Easy“, sagte eine sarkastische, näselnde Stimme hinter ihm.
Luca drehte sich um, und sein Blick fiel auf einen dünnen Mann mit dunklem Teint, der mit verschränkten Armen am Zaun lehnte und eine billige Zigarette rauchte. John Riley, ein ebenso vertrautes wie unwillkommenes Gesicht. Während Lucas Prozess hatte Rileys Zeitung eine Reihe von Enthüllungen über ihn veröffentlicht und in den von Riley verfassten Leitartikeln die öffentliche Empörung angeheizt. Der Reporter lächelte ihn an, fischte in seiner Tasche nach einem Etui aus angelaufenem Messing und bot Luca eine Zigarette an. Luca betrachtete den Inhalt des Etuis und wählte eine aus. Riley riss ein Streichholz für ihn an.
Luca musterte Rileys Gesicht und bemerkte, dass er alt geworden war. Der Journalist hatte immer schon dunkle Ringe um die Augen gehabt, doch jetzt waren sie um einiges markanter und tiefer eingegraben, dazu eingefallene Wangen. Die Haut spannte so über den Wangenknochen, dass sie fast aussah wie mumifiziert. Riley, fand Luca, verströmte eine Aura von Verfall.
„Sie wirken nicht besonders glücklich, D’Andrea“, sagte Riley mit seinem vornehmen Stakkato. „In Ermangelung eines Willkommenskomitees aus Familie und Freunden sollten Sie sich eigentlich freuen, mich zu sehen.“
Der Reporter grinste, wobei er gelbe Zähne entblößte, und Luca nahm einen langen Zug an seiner Zigarette. Riley trug einen cremefarbenen Blazer und einen steifen Strohhut mit einem roten Seidenband. An jedem anderen hätte so eine Kleidung an Ivy League, Ruderclubs und Familien mit starkem Unterkiefer aus dem Nordosten erinnert. Doch an Rileys abgezehrter Gestalt mit den hängenden Schultern sah sie vulgär aus.
„Ein Wagen holt mich ab“, fuhr Riley fort. „Ich kann Sie mitnehmen, wenn Sie wollen.“
Luca musterte den Reporter von der Seite. Einer wie Riley tat einem keinen Gefallen, ohne im Gegenzug etwas dafür zu erwarten, und Luca war nicht in der Position, einen Handel abzuschließen oder einen Pakt einzugehen.
„Ich dachte, ich geh zu Fuß“, sagte Luca, der sich darauf gefreut hatte, so lange, wie er wollte, geradeaus zu gehen, ohne dass er Ketten um die Knöchel spürte oder Stacheldraht ihm den Weg versperrte oder Bewaffnete neben ihm hergingen.
„Nach New Orleans sind es über dreißig Kilometer“, wandte Riley mit einem Stirnrunzeln ein.
Luca zuckte mit den Achseln. „Was wollen Sie?“
Der Reporter hielt inne. „Sie wissen doch, wie das ist“, sagte er in wehleidigem Ton. „Ich hatte wirklich nicht vor, herzukommen und Ihnen Ihren großen Augenblick zu versauen, aber mein Herausgeber hat mich gebeten, ein paar Zitate zu besorgen“, erklärte er und warf die Hände in die Luft, wie um die Launen des Schicksals zu beklagen.
„Immer noch nicht befördert worden?“, fragte Luca ausdruckslos, und Riley stieß ein kurzes, gekünsteltes Lachen aus, das eher nach einem Ächzen klang.
„Danke für die Zigarette“, sagte Luca. Er steckte sie sich zwischen die Lippen, schob die Hände in die Taschen und schlug den Weg Richtung New Orleans ein.
„Himmel, Luca. Ich habe extra den weiten Weg hier raus gemacht“, keuchte Riley, während er hinter ihm her hastete. „Kommen Sie schon, Sie haben immer guten Stoff für die Zeitung geliefert“, flehte er.
„Ich habe nur guten Stoff geliefert, weil Sie mich reingeritten haben“, versetzte Luca.
Riley zog eine Grimasse und ließ seinen Blick über Lucas Gesicht schweifen. „Ich muss sagen, Kumpel, Sie sehen gut aus“, sagte er. „Die meisten Männer altern in Angola doppelt so schnell. Sie sehen genauso aus wie am Tag Ihrer Verurteilung.“
„Scheren Sie sich zum Teufel.“ Luca zog noch einmal an seiner Zigarette.
Er war nicht davon ausgegangen, dass seine Rückkehr nach New Orleans leicht werden würde. Er wusste, dass die Stadt kein Paradies war, sie war gewalttätig und unversöhnlich, überfüllt mit Kriminellen und Einwanderergemeinden, die einander mit Feindseligkeit und Misstrauen begegneten. Aber die Stadt besaß auch eine betörende Energie, einen strahlenden, opulenten Charme. Bei aller Rassentrennung und allem Schlechten, den schäbigen Straßen und dem verblassten Glanz ließ man sich von New Orleans doch leicht verzaubern. Und so hatte Luca die ganze Zeit in Angola unwillkürlich das Gefühl gehabt, bei seiner Rückkehr in diese Stadt würde er eine bessere Welt betreten. Der Schmutz des Gefängnislebens würde von ihm abfließen, ähnlich wie das Fruchtwasser bei der Geburt. Als er jetzt den Blick auf Riley richtete, fragte er sich allerdings, ob er nicht bloß einen Schmutz gegen einen anderen tauschte.
„Wie wäre es damit?“, meinte Riley. „Was halten Sie davon, an diesem Tag des Neuanfangs eine neue Seite aufzuschlagen? Noch einmal ganz von vorn anzufangen?“
Luca wollte Riley schon den nächsten Fluch um die Ohren hauen, aber dann blieb er stehen und seufzte. Etwas an der Aussicht auf einen Neuanfang rührte an sein Gewissen. Wenn er Riley gab, was er wollte, ließ der ihn vielleicht endlich in Ruhe.
„Was wollen Sie denn wissen?“, fragte Luca, und Riley lächelte wieder.
„Nur das Übliche“, sagte der Reporter. „Wie war Ihre Zeit in Angola? Wie ist es, aus den Sträflingsklamotten raus zu sein? Was halten Sie von den staatlichen Haftanstalten, jetzt, da Sie eine von innen kennengelernt haben?“
Luca sah Riley an. „Sie sind bestimmt nicht hier rausgekommen, um mich das zu fragen“, antwortete er. „Nicht einmal die Gefängnisverwaltung von Louisiana schert sich um den Zustand ihrer Haftanstalten. Da geben Ihre Leser gewiss nichts darauf.“
Riley verzog das Gesicht. „Immer noch blitzgescheit, was, Luca? Wissen Sie, bei manchen Männern ist das Hirn nur noch Brei, wenn sie rauskommen. Aber nicht bei Ihnen.“ Riley tippte an seinen Hut und bedachte Luca mit einem Grinsen. „Was sagen Sie zu den Axeman-Morden?“
Luca runzelte die Stirn und sah ihn mit zusammengekniffenen Augen an. „Was für Axeman-Morde?“, fragte er, und Riley nickte wissend.
„Dann haben Sie während Ihres Aufenthaltes auf Staatskosten nichts davon mitbekommen? Ein verrückter Zulu läuft durch die Stadt und bringt italienische Lebensmittelhändler um. Sechs Wochen sind seit den ersten Morden vergangen, und Ihr alter Kumpel Talbot, der die Ermittlungen leitet, kommt keinen Schritt voran. Ja, er hat’s ziemlich versaut, und die Leute werden allmählich richtig wütend.“
Luca bemerkte, dass ein leichter Wind den Staub auf der Straße nach New Orleans aufwirbelte. So ändern sich die Zeiten, dachte er. Jetzt würden sie Michaels Namen durch den Dreck ziehen. Luca hatte versucht, Schritt zu halten mit den Veränderungen in der Stadt. Wenn neue Insassen nach Angola kamen, brachten sie Neuigkeiten aus der Welt draußen mit, und Luca hatte aufmerksam hingehört, was auf dem Gefängnishof die Runde machte. Er hatte vom Großen Krieg gehört, von dem gewaltigen Hurrikan, von der Spanischen Grippe und von der Schließung von Storyville. Er hatte sogar von der neuartigen Musik gehört, die, wenn man den schwarzen Insassen glauben konnte, die Stadt überschwemmte. Er wusste, dass der achtzehnte Zusatzartikel verabschiedet worden war und die Prohibition kurz bevorstand, und er fragte sich, was dann aus New Orleans, diesem Pulverfass voller widerstreitender Interessen, werden würde. Aber zwischen diesen ganzen Neuigkeiten über Umbrüche und Zwistigkeiten hatte Luca nichts über das Treiben der Polizei gehört und auch nichts über seinen ehemaligen Protegé.
„Was geht das mich an?“, fragte er.
„Na, Sie haben auch so Ihre Geschichte mit Talbot, und da haben der Chef und ich gehofft, in dieser Stunde der Not könnten Sie uns ein wenig Schadenfreude zeigen. Ich meine, er ist schließlich nur befördert worden, weil er Sie verpfiffen hat. Wenn er der Aufgabe nicht gewachsen ist, ist es doch irgendwie witzig, dass Sie genau dann entlassen werden, wenn es den Leuten allmählich auffällt.“
Riley atmete tief durch, das Sprechen fiel ihm schwer, wo er ja rauchte und obendrein noch mit Lucas forschen Schritten mithalten musste.
„Von wegen: die Rache des kleinen Mannes oder so“, keuchte er. „Das ist zumindest das, was der Herausgeber gern hätte. Einen Seitenhieb.“
Er sah Luca von der Seite an und wartete auf eine Antwort. Luca schwieg jedoch, den Blick auf den Horizont gerichtet, auf die ferne Silhouette von New Orleans im Nebel. Er versuchte noch einmal, das tanzende Showgirl in dem Bild auszumachen, aber er sah nur Nebelschwaden, Sonnenstrahlen und Tau.
„Es schert keinen Menschen, was ich denke“, sagte er. „Die Leute glauben, was sie glauben wollen. Das habe ich aus dem Prozess gelernt.“
Riley nickte, und sie gingen weiter nebeneinanderher, ohne zu reden. Über den Feldern zu beiden Seiten der Straße stieg ein Krähenschwarm auf und fegte wieder herab. Die Vögel stießen durchdringende, freche Schreie aus.
„Wollen Sie gar nichts sagen?“, fragte Riley nach einer Weile, und jetzt war sein Tonfall weicher, fast flehend. „Immerhin haben Sie wegen Talbot die letzten sechs Jahre in einer Zelle verbracht. Ich meine, eigentlich war er doch mal Ihr Schützling.“
Luca unternahm den heroischen Versuch, sich nicht die Stimmung verderben zu lassen, und bemühte sich, nicht an den Verrat zu denken. Er blieb stehen und wandte sich Riley zu, woraufhin dieser instinktiv einen Schritt nach hinten machte.
„Fünf Jahre“, erwiderte Luca ruhig. „Eines haben sie mir wegen guter Führung erlassen.“ Er nahm einen letzten Zug an der Zigarette, schnippte sie auf die Straße und trat sie mit dem Stiefel aus. „Michael hat das Richtige getan“, fuhr er fort. „Ich trage es ihm nicht nach. Ich möchte einfach noch einmal neu anfangen. Keine Fehden, kein Leben in der Vergangenheit. Ich will jetzt nur nach New Orleans, etwas essen, was nicht halb verfault ist und voller Kakerlaken, mir ’nen Drink kaufen und vielleicht auch ’ne Frau. Schreiben Sie das in Ihrer Zeitung.“
Luca drehte sich um und marschierte die Straße hinunter, und Riley sah ihm mit verdutzter Miene nach.
„Aber Luca, haben Sie das nicht gehört?“, schrie er ihm hinterher. „Sie können sich keine Frau mehr kaufen! Wegen der Navy wurden die Bordelle verboten!“
Luca achtete nicht auf ihn und ging weiter auf der langen, staubigen Straße nach New Orleans.
„Ray Celestin schreibt so lebendig, dass man leicht in die Geschichte hinein-, aber nur schwer wieder herausfindet.“
„Dieser Krimi hat es in sich!“
„Ein spannungsgeladener Roman, bei dem bis zur letzten Seite die besondere Atmosphäre des Ortes und der Zeit zu spüren sind - und dem Leser von Zeit zu Zeit die Luft wegbleiben dürfte.“
„Jazz, Alkohol, Korruption, die Mafia und Mord – alles vereint in einem spannungsgeladenen Krimi, wie ich ihn lange nicht mehr gelesen habe.“
„Das Buch war eine super Abwechslung zu den üblichen Kriminalfällen mit wunderbaren Charakteren und einem interessanten Verlauf. Von meiner Seite eine klare Leseempfehlung.“
„Ein grandioses Buch. Der Autor führte mich in die Jahre des Jazz zurück und lies mich eine Geschichte erleben, die ich so noch nicht gelesen habe.“
„Celestin wechselt äußerst elegant und erstaunlich bündig zwischen den Erzählsträngen hin und her, ohne dass es je aufgesetzt oder wie erzwungene Spannungsmache wirkt. Findet so nicht nur zu einem, sondern gar drei furiosen Schlussakkorden, die jeder für sich stimmig sind. Und hat noch Platz für einen pointierten Epilog.“
„Dem Autor Ray Celestin ist ein wirklich brillanter Debütroman gelungen. Er ist nicht nur spannend, sondern auch wegen seines Einfallsreichtums, seiner zauberhaften Detailliertheit und der einzigartigen Mixtur aus fiktiver Geschichte und realen Fakten eine fesselnde Lektüre.“
„Ein vielversprechendes Debüt, spannend, atmosphärisch dicht, mit ungewöhnlichen ›Helden‹ und einem Hauch von Ironie. Sehr lesenswert. Gerne mehr davon.“
„Ein Debüt, das überzeugt und begeistert.“
„Ein sehr atmosphärischer Roman, der das Leben zu Beginn der Roaring Twenties in New Orleans sehr gut wiederspiegelt (…).“
„Gespenstisch gut ist Ray Celestins Debüt.“
„Basierend auf einer wahren Geschichte erzählt der Brite Ray Celestin in ›Höllenjazz‹ nicht nur einen packenden Thriller, sondern auch von der einzigartigen Magie des Jazz.“
„›Höllenjazz aus New Orleans‹ ist ein spannender und unterhaltsamer Roman (…) eine perfekte Mischung aus realen Fakten und Fiktion.“
„Ein unterhaltsamer Krimi voller trickreicher Wendungen.“
„Eine gute Story mit viel Stimmung, viel Gefühl für New Orleans, viel Gefühl für den Jazz und das Leben zur damaligen Zeit.“
„Großartiger Debütroman eines Jazzliebhabers mit fundierten Kenntnissen des historischen New Orleans“
„Zu lesen wie drei Ermittler mit ganz unterschiedlichen Ansätzen zum selben Ergebnis kommen, ist spannend bis zum Schluss. Vor allem ihre privaten Hintergründe geben ihnen einen unverwechselbaren Charakter.“
„Die Atmosphäre der Stadt zu jener Zeit wurde gelungen eingefangen und ich fand es spannend, in diese Zeit einzutauchen. Die Ermittlungen sind komplex und versorgen den Leser stückweise mit neuen Informationen.“
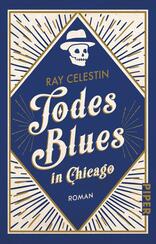
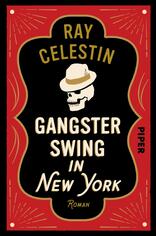











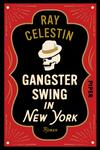

DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.