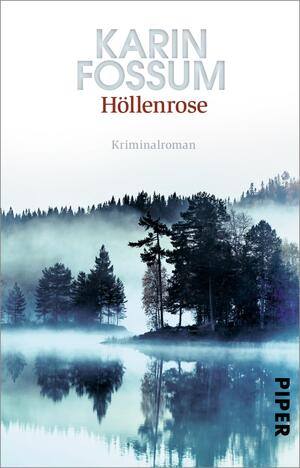
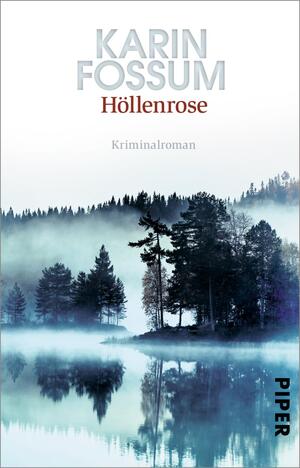
Höllenrose (Konrad Sejer 12) Höllenrose (Konrad Sejer 12) - eBook-Ausgabe
Kriminalroman
„Empathie für die Verlorenen und das Höllenfeuer der Verlassenheit treiben diesen spannenden Krimi an.“ - Büchermagazin
Höllenrose (Konrad Sejer 12) — Inhalt
Als Kommissar Konrad Sejer zu einem Campingwagen am Waldrand gerufen wird, erwartet ihn dort der wohl erschütterndste Fall seiner Karriere. Im Inneren des alten Caravans befinden sich die brutal zugerichteten Leichen einer jungen Frau und eines kleinen Jungen. Wer würde einer wehrlosen Mutter und ihrem Kind so etwas antun? Ein blutiger Schuhabdruck ist alles, was auf die Identität des Täters hindeutet. Kommissar Sejer macht sich auf eine fast aussichtslose Suche nach dem Mörder. Was er dabei enthüllt, ist das herzzerreißende Schicksal einer verlorenen Seele.
Leseprobe zu „Höllenrose (Konrad Sejer 12)“
Frauen und Kinder glühten, die Männer wussten es besser und blieben im Schatten, den Hut tief ins Gesicht gezogen. Auf einem Feld in der Nähe des Hofes Skarven, in einer kleinen Talsenke mit einem schwarzen Fichtenwäldchen, stand ein alter Wohnwagen der Marke Fendt. Um die Fenster herum zeichnete sich Rost ab, hinter einer Fensterscheibe eine zerfetzte Gardine, einige Insekten hatten sich fangen lassen und hingen zwischen dichten feinen Fäden und weißen Spitzen tot im Netz aus Nylon. Gleich hinter der Tür lag ein Kind, vielleicht vier, fünf Jahre alt. [...]
Frauen und Kinder glühten, die Männer wussten es besser und blieben im Schatten, den Hut tief ins Gesicht gezogen. Auf einem Feld in der Nähe des Hofes Skarven, in einer kleinen Talsenke mit einem schwarzen Fichtenwäldchen, stand ein alter Wohnwagen der Marke Fendt. Um die Fenster herum zeichnete sich Rost ab, hinter einer Fensterscheibe eine zerfetzte Gardine, einige Insekten hatten sich fangen lassen und hingen zwischen dichten feinen Fäden und weißen Spitzen tot im Netz aus Nylon. Gleich hinter der Tür lag ein Kind, vielleicht vier, fünf Jahre alt. Auf einer schmalen Sitzbank unter dem Fenster eine Frau. Im Mundwinkel hatte sie eine große Wunde, von der aus Blut über ihr Kinn gelaufen war. Der Hauptkommissar stand mit hämmerndem Herzen in der Tür.
Der Wagen war in schlechtem Zustand, konnten sie wirklich hier gelebt haben, Mutter und Kind? Nein, das glaubte er nicht. Vielleicht hatten sie hier nur spielen wollen. Waren querfeldein gewandert und hatten die rostige kleine Behausung entdeckt. Heute Nacht schlafen wir in einem Wohnwagen!
Im Westen lag Geirastadir, im Osten lag Haugane, aber hier, in diesem schwarzen Gehölz, lagen Mutter und Kind. Sejer ging hinein. Das Adrenalin hatte ihm den Mund ausgetrocknet. Er stieg über den Kinderkörper hinweg, vermied es, ins Blut zu treten, entdeckte vor der Bank auf dem Boden ein Messer. Ein Messer mit Holzgriff und Nieten und einer langen, schmalen Klinge, ein Messer, mit dem Fleisch oder Fisch filetiert werden. Auf der blanken Klinge Ränder aus Blut, das Blut war darübergeströmt, und es roch faulig. Auf der Bank eine Brieftasche, sie war rot und hatte viele Fächer. Ein Rucksack und eine halb gegessene Pizza, einige Kleidungsstücke in einem Regal. In der Brieftasche tausend Kronen in bar. Also kein Raubmord, dachte er, aber damit hatte er auch nicht gerechnet. Es gibt immer eine Beziehung, dachte er dann, einen Beweggrund, ein Motiv. Oder einen Keim aus einer lange zurückliegenden Zeit. Der Mensch, der die Mutter und das Kind getötet hatte, wusste, wer die Opfer waren. Und wo sie waren. Er hatte Jagd auf sie gemacht, war über Wiesen und Felder geschlichen und hatte ihr Versteck gefunden. Falls es ein Versteck gewesen war. Es war ein armseliger Ort, um gefunden zu werden, ein stinkender Unterschlupf, schmutzig und feucht. Regen war durch das Dach gedrungen, tote Insekten lagen herum. Das Kind trug einen Trainingsanzug in den norwegischen Nationalfarben, Rot, Weiß und Blau, es war unmöglich zu sehen, ob es sich um einen Jungen oder ein Mädchen handelte. Es lag mit ausgestreckten Armen auf dem Boden auf dem Rücken, es schien bei der Tür niedergeschlagen worden zu sein. Einige blonde Locken klebten ihm an der Stirn. Der Kopf war in den Nacken gekippt, die Kehle dünn und weiß. Sejer öffnete die Brieftasche, die er soeben gefunden hatte, zog einen Führerschein heraus. Bonnie Hayden, so hieß also die Mutter. Das Kind war noch namenlos.
„Nein“, sagte er zu den anderen, die hereinwollten. „Nichts anfassen. Das hier ist erst vor kurzer Zeit passiert, alles ist noch ganz frisch. Ruft Snorrason in der Rechtsmedizin an und sagt ihm, er soll sofort herkommen.“
Er musste wieder hinaus und frische Luft schnappen, er blieb eine Weile im Gras stehen und atmete durch. Er registrierte einige Dinge kristallklar: dass die Vögel noch immer sangen, dass die Fichten in ihren schwarzen Kleidern in der Brise wogten, dass eine Amsel draußen auf dem Feld einen Wurm gefunden hatte und daran zerrte und zog. Ein Großteil der Umgebung wurde gerade abgesperrt. Das Plastikband flatterte in der Brise wie bunte Geschenkschleifen.
Die Männer folgten dem trockenen Fußweg in Richtung Geirastadir. Ihr Gespräch bestand aus kurzen, leisen Kommentaren. Hier war er vermutlich entlanggegangen, hier war er nach seiner Untat davongerannt.
„Sie müssen sich gegenseitig beim Sterben gesehen haben“, sagte Sejer zu seinem jüngeren Kollegen.
Er wusste nicht, was schlimmer wäre. Wenn das Kind den Tod der Mutter miterlebt hätte oder wenn die Mutter zur Zeugin beim Tod ihres Kindes geworden wäre. Das Allerallerschlimmste hatte diese beiden getroffen. Ein Teufel war über die Felder gekommen und hatte sie mit dem Messer erstochen. Die Morde hatten auch etwas Methodisches, etwas Gewolltes. Ich kann nur beten, dass es schnell gegangen ist, dachte Sejer. Er wechselte einige Worte mit dem Bauern, der die Toten gefunden hatte. Der Mann stand verängstigt in gebührender Entfernung, ging weder vor noch zurück, wollte nicht nach Hause, wollte nicht hierbleiben. Ihm gehörte der Wohnwagen, der wurde seit vielen Jahren nicht mehr benutzt, hatte nur zwischen den Fichten gestanden und vor sich hin gerostet.
„Wir kommen noch auf Sie zurück“, sagte Konrad Sejer. „Haben Sie in den letzten Tagen hier in der Umgebung irgendjemanden gesehen? Der hier nicht hingehört?“
Der Bauer verneinte. „Ich habe keine Menschenseele gesehen. Ich habe Polen, die auf dem Hof arbeiten“, fügte er hinzu. „Sie wussten von der Frau mit dem Kind, dass die im Wagen wohnten. Aber das war nur für eine Nacht, sie sind gestern gekommen. Ich kann nicht glauben, dass einer von den Polen mit der Sache zu tun hat. Wenn es so wäre, würde ich nicht drüber wegkommen, das sind doch meine Leute.“
„Auf dem Boden im Wagen liegt ein Messer“, sagte Sejer. „Haben Sie das gesehen?“
Der Bauer holte tief Luft.
„Bitte, schauen Sie es sich genauer an. Ob es Ihnen bekannt vorkommt.“
„Muss ich da wieder rein?“
Das widerstrebte dem Mann offensichtlich.
„Ja.“
Er ging die beiden Stufen hoch und starrte hinein.
„Das ist nicht von uns. Kann ich jetzt gehen?“
„Ja, wir kommen gleich nach. Sprechen Sie nicht mit der Presse.“
Sejer wollte schon wieder zurück in den Wagen, um dort seine Untersuchungen fortzusetzen, aber dann fiel sein Blick auf etwas im Gras neben der schmalen Tür. Eine umgekippte Kuchenform. Der Kuchen war herausgefallen und auf den Boden gerutscht. Er war unberührt. Sejer staunte über diesen Fund und vergewisserte sich, dass er umgehend fotografiert werden würde. Die fetten Krähen würden sich sicher in kurzer Zeit darauf stürzen und ihn verzehren, wenn die Polizei ihn nicht mitnahm. Die Techniker machten ihre Bilder. Krümmten sich in dem engen Wagen zusammen, gingen in die Hocke. Der Linoleumboden wies mehrere blutige Abdrücke einer großen Schuhsohle auf, die meisten waren schwach oder unvollständig, aber einer war deutlich. Sejer ging vorsichtig zwischen den beiden Toten hindurch. Der strenge Geruch nach Fleisch und Blut stach ihm in die Nase. Zugleich war sein Gehirn glasklar. Durch das Fenster sah er das dichte Gebüsch mit den reifen Himbeeren.
Kurz vor Weihnachten schneite es endlich.
„Musst du wirklich noch weg?“, fragte Eddie. „Das ist doch ein Sturm! Im Radio haben sie gesagt, es ist glatt, schwierige Verkehrsverhältnisse, haben sie gesagt, und allen wird geraten, zu Hause zu bleiben. Schau dir doch bloß mal den Schnee an. Man sieht ja fast nichts.“
Mass legte ihm eine Hand auf den Arm, ihre Stimme war ruhig und entschlossen.
„Eddie“, sagte sie freundlich. „Ich habe doch Spikereifen. Und ich fahre so vorsichtig wie irgend möglich, Ehrenwort. Ich will schließlich unversehrt zu dir nach Hause zurückkommen. Aber ich muss noch mal zum Laden, wir brauchen doch etwas zu essen. Oder wolltest du vielleicht fasten?“
Bei der Vorstellung, nichts zu essen zu haben, schüttelte Eddie seinen schweren Kopf.
„Du kannst zusammen mit Shiba hier zu Hause warten“, sagte sie. „Was möchtest du aus dem Laden? Du hast doch bestimmt Hunger.“
Eddie Malthe wischte sich mit dem Handrücken den Rotz ab. Er hatte die Figur einer riesigen Birne, seine Waden waren dürr, die Füße in den dicken Stiefeln, die er immer trug, waren hinten bei den Hacken schmal, dann wurden sie bei den Zehen um einiges breiter. Er hatte Füße wie eine fette Gans. Seine Fäuste waren groß und weiß, die Finger kurz und dick.
„Zimthörnchen“, sagte er entschieden.
„Alles klar, Zimthörnchen“, sagte die Mutter, „jetzt fahre ich. Sei lieb zu Shiba, zieh sie nicht am Schwanz. Ich weiß, dass du das machst, wenn du allein zu Hause bist.“
„Auf keinen Fall“, sagte Eddie, „großes Ehrenwort.“ Und dabei freute er sich schon darauf, genau das zu tun. Wenn er Shiba am Schwanz zog, fing sie immer an zu winseln, während sie mit den langen Krallen über den Boden kratzte, um sich loszureißen.
„Denk an den Sicherheitsgurt“, mahnte er.
Die Mutter schob die Arme in ihren Mantel.
„Nicht dein Handy vergessen“, fügte er hinzu. „Ruf an, wenn du von der Straße abkommst, alarmier den Notruf. Jedenfalls, wenn du noch bei Bewusstsein bist.“
„Eddie“, sagte sie, „jetzt hör aber auf. So, setz dich brav aufs Sofa, in einer Dreiviertelstunde bin ich wieder zurück, das ist doch nicht schlimm.“
Eddie sah seine Mutter lange an. „Wenn du weg bist, wird es im ganzen Haus kalt“, klagte er. „Du weißt doch, wie das ist. Vergiss die Zimthörnchen nicht. Wenn die keine Hörnchen haben, musst du Kekse kaufen. Kekse von Pepita, mit Zitrone.“
Er starrte aus waidwunden Augen durch das Fenster. Die Scheiben waren blank geputzt, die Mutter hielt Ordnung. Er sah, wie der Wagen im Rückwärtsgang aus der Garage kam und dann auf die Hauptstraße abbog. Es schneite immer weiter, der Schnee wurde vom Sturm mitgerissen, weiter unten auf der Straße türmten sich hohe Schneewehen auf. In Gedanken betete er, dass alles gut ausgehen möge. Dass die Mutter unversehrt nach Hause kommen würde, mit Milch und süßem Gebäck. Der Hund lag vor dem gusseisernen Ofen und schlief mit dem Kopf auf den Pfoten. Eddie ging hinüber und zog Shiba am Schwanz, wie das seine Art war. Sie fing an zu winseln, rappelte sich auf und lief durch das Zimmer, suchte Zuflucht in der Küche. Eddie setzte sich aufs Sofa, griff nach der Tageszeitung und schlug sie auf der vorletzten Seite beim Kreuzworträtsel auf. Er schaffte die Kreuzworträtsel immer. An seinem Verstand war ja wohl nichts auszusetzen. Er holte sich einen Bleistift und fing an zu lesen. Waagerecht, „habsüchtig“ mit sechs Buchstaben. Er schrieb das Wort „gierig“ in die sechs Kästchen.
Der Hund lag bewegungslos in einer Ecke in der Küche, im Ofen bullerte es. Shiba war ein acht Jahre alter Labrador mit ziemlichem Übergewicht, und sie hatte nicht mehr lange zu leben, das hatte die Mutter gesagt. Ihr Körper war voller Knubbel, er konnte sie durch das gelbliche Fell ertasten, aber sie hatten keine Versicherung und konnten es sich nicht leisten, den Hund operieren zu lassen.
„Das Leben muss eben seinen Gang gehen“, sagte die Mutter oft. „Nichts ist von Dauer.“
„Das weiß ich“, erwiderte Eddie darauf. Und dann dachte er an den Tod der Mutter, denn auch sie würde ja eines Tages sterben. Und obwohl sie erst sechsundfünfzig war und er selbst einundzwanzig, war es doch so beängstigend für ihn, an das Ende zu denken, dass ihm heiß wurde und er sich schrecklich aufregte. Oft musste er sich die Hand aufs Herz legen, um es zur Ruhe zu bringen. „Altes Wort für Roma“, las er dann, und den dritten Buchstaben bekam er von „gierig“, es war ein „g“. „Zigeuner“, schrieb er. Er nahm immer zuerst die leichten Wörter. Danach sah er auf die tickende Wanduhr. In zwanzig Minuten würde seine Mutter mit den Zimthörnchen wieder da sein. Schon jetzt spürte er den Geschmack im Mund. Wenn sie nur welche hatten! Wenn die nur frisch und lecker waren! „Himmelsrichtung“ mit sechs Buchstaben, das konnte „Norden“ sein. Oder „Westen“. Und in jedem Fall hatte er dann auch das nächste Wort, nämlich „kreisförmig“, mit vier Buchstaben. Das musste „rund“ sein. Bald war er bei den schwierigen Wörtern angelangt und gönnte sich eine Pause. Ging ans Fenster und starrte ins Schneegestöber hinaus, und dabei betete er zu Jesus Christus, wo immer der sich gerade aufhalten mochte. Mach, dass Mama das Schneegestöber überlebt. Denn hier sitze ich allein und warte auf Plätzchen. Es gibt doch nur uns beide. Du musst auf uns aufpassen.
Er ging hinüber zu Shiba in die Küche, riss sie am Schwanz und lachte schallend, als die Hündin aufsprang und ins Wohnzimmer floh. Dort kroch sie unter das Sofa und blieb keuchend liegen.
„Du feige Töle“, sagte er und lachte. „Wieso wehrst du dich nicht? Hast du keine Zähne im Maul?“
Dann setzte er sich wieder an das Kreuzworträtsel, lutschte am Bleistift. Das Wort für „Abschluss“ machte ihm arg zu schaffen, es hatte vier Buchstaben.
Eine Dreiviertelstunde war vergangen, und die Mutter war noch immer nicht wieder da. Besorgt griff er zum Telefon und gab mit seinen fetten Fingern ihre Nummer ein. Aber er bekam nur eine Stimme, die sagte: „Dieser Anschluss ist derzeit nicht zu erreichen.“ Wieder ging er ans Fenster und starrte hinaus ins Schneegestöber, es war dicht und weiß, die Sonne war nur ein bleicher, bescheidener Schimmer. Er wusste, dass die Mutter ihn später zum Schneeschippen hinausschicken würde, und wenn er etwas verabscheute, dann Schneeschippen. Sicherheitshalber rief er noch einmal an, bekam aber weiterhin diese fremde Stimme, die sagte, die Mutter sei nicht zu erreichen. Mehr als fünfzig Minuten waren bereits vergangen. Jetzt ist es passiert, dachte er verzweifelt. Jetzt sitzt sie mit der Nase im Airbag fest. Einen Moment lang spielte er mit dem Gedanken, seine Jacke überzustreifen und an der Straße entlangzulaufen, um die Mutter zu suchen. Aber dann, während er noch am Fenster stand, während er vor Angst die Fäuste ballte, sah er ihr Auto vorfahren. Die Scheinwerfer leuchteten ihm entgegen, und er stürzte hinaus in den Flur und dann weiter die Treppe hinunter.
„Du hast eine Dreiviertelstunde gesagt“, klagte er. „Ich hatte solche Angst.“
„Also bitte, Eddie“, erwiderte sie. „Nun tu mal nicht so dramatisch. Ich kann beim Fahren ja nicht telefonieren, und ich war schon fast zu Hause.“
„Hatten sie Hörnchen?“
„Ja“, sagte sie. „Das hatten sie, ich habe zwei Tüten gekauft. Schau mal, hier sind sie, jetzt kannst du es dir gemütlich machen. Stell die Milch kalt, ich will den Schnee von der Treppe fegen. Nachher, wenn du die Hörnchen gegessen hast, musst du unten Schnee schippen.“
Sie zählte sieben Hörnchen ab und legte sie auf einen Teller.
„Heute Abend bekommst du den Rest. Wir wollen doch ehrlich sein, du bist ganz schön dick. Ich weiß, du bist ein großer Junge, aber hundertdreißig Kilo ist zu viel, nur damit du’s weißt. Übergewicht ist gefährlich. Eddie. Milch und Kuchen lagern sich wie Lehm in den Adern ab. Und dann reißt sich irgendwann ein dicker Klumpen los und wird ins Herz geschwemmt. Oder auch ins Gehirn, und dann kannst du nie mehr ein Kreuzworträtsel lösen.“
„Aber dann krieg ich die letzten Hörnchen heute Abend, nicht wahr?“, bettelte er.
„Ja“, sagte sie. „Versprochen. Aber du weißt, ich muss eben streng sein. Irgendjemand muss bei dir Ordnung halten, da sind wir uns doch einig.“
„Wir müssen ins Einkaufszentrum“, sagte er. „Ich brauche was zum Anziehen. Ich will den Pullover, den ich in der Zeitung gesehen habe. I Love New York.“
In der Nacht träumte er von Küken. Gelb, flaumig und weich wuselten sie auf ihren dünnen Beinchen herum. Er hob sie auf und ließ sie in einen Kochtopf mit Knoblauch und Butter fallen. Er träumte, dass sie dort blubberten, während sie zugleich piepsten und in dem kochenden Wasser zappelten. Als der Traum zu Ende war, fuhr er aus dem Schlaf hoch und lauschte dann zum Zimmer seiner Mutter hinüber. Manchmal sprach sie im Schlaf, manchmal stöhnte sie, aber meistens war es dort die ganze Nacht hindurch still. Er mochte es nicht, wenn seine Mutter schlief. Wenn sie nicht da war und auf ihn aufpasste, wenn sie nicht antwortete, wenn er sie ansprach, sondern nur dort lag und in der Dunkelheit atmete, außerhalb seiner Reichweite.
Immer wurde er zuerst wach, und dann lag er da und horchte auf seine Mutter, ob sie vielleicht wach sei. Er blieb ganz ruhig liegen, bis er die Toilettenspülung hörte, dann wälzte er sich aus dem Bett und ging ins Wohnzimmer, riss den Vorhang zur Seite und starrte hinaus auf den neuen Tag, der ihm zuteilgeworden war. Danach ging er in die Küche und steckte eine Hand in seine Unterhose und die andere in die Brottrommel. Er schnitt sich zwei Scheiben Brot ab und bestrich sie dick mit Butter, dann griff er nach der Zuckerschale. Wischte einige Krümel von der glatten Wachstuchdecke.
Bald kam die Mutter aus dem Badezimmer und sah ihn mit Brot und Zucker dort sitzen. Es war immer dieselbe Leier: „Wie oft muss ich dir noch sagen, dass du dir vor dem Essen die Hände waschen sollst, du warst bestimmt noch nicht im Badezimmer. Mit diesen Händen hast du doch alles Mögliche angefasst.“
Eddie dachte sich seinen Teil. Er wusste, dass sie oft mit einer Hand zwischen den schweißnassen Oberschenkeln schlief, und manchmal, nachts, konnte er sie stöhnen hören. Ich bin, verdammt noch mal, kein Idiot, sagte er zu sich selbst. Und obwohl die Mutter ihn ins Badezimmer scheuchte, um sich die Hände zu waschen, fühlte er sich obenauf. Die Mutter schaute aus dem Fenster in das wilde Schneegestöber.
„Wir nehmen heute den Bus“, sagte sie und sah ihren Sohn an. „Das geht genauso gut. Und wir müssen jetzt wirklich mit dir zum Friseur, du siehst aus wie ein Mädchen.“
Eddie schnaubte. Er war eins neunzig groß und hatte eine Stimme wie ein Reibeisen. Er sah absolut nicht aus wie ein Mädchen, wie konnte sie so etwas sagen? Aber seine Haare lockten sich im Nacken, dick und braun und weich, und er fand es schrecklich, wenn die Schere an seinen Ohren kreischte.
Bald saß sie neben ihm im Bus, die Hände um die braune Handtasche gefaltet.
„Wir gehen zu Dressman“, entschied sie. „Da haben sie extra large. Du darfst dir keinen Zucker mehr aufs Brot streuen, davon kannst du Diabetes kriegen.“
Darauf erwiderte er nichts. Er saß auf seinem Sitz neben ihr und nahm den Seifengeruch wahr. Er saß gern so im Bus und wurde hin und her geschaukelt, ihm gefielen das leise, verschlafene Brummen des Motors, der Geruch der neuen Sitze aus rotem Plüsch. Der Geruch fremder Menschen, mit denen er nichts zu tun haben musste.
Dressman lag im ersten Stock des Einkaufszentrums, und sie fuhren mit der Rolltreppe nach oben. Vor dem Laden gab es Gestelle mit Waren, einiges war alt und heruntergesetzt.
„Ich brauche eine Hose und einen Pullover“, sagte er laut und deutlich zu der jungen Frau, die ihnen behilflich sein wollte. „Die Hose soll schwarz sein. Sie soll viele Taschen haben, vorn und hinten an den Beinen. Keine Jeans, es muss ein anderer Stoff sein. Steife Kleider sind scheußlich. Sie muss extra large sein, ich bin ein großer Junge.“
Sie lächelte und zeigte weiße Zähne. Ihre Haut war dunkel wie Schokolade, und ihre Haare waren schwarz.
„Du bist keine Norwegerin“, erklärte Eddie.
„Bin ich wohl“, entgegnete sie eifrig. „Mein Vater ist Äthiopier, aber ich bin in Norwegen geboren und aufgewachsen. Schauen Sie mal, hier habe ich eine Hose mit vielen Taschen. Sechs vorn und zwei hinten, das ist ja wohl nicht schlecht?“
„Die ist nicht schwarz“, sagte Eddie unzufrieden.
„Nein, aber eine andere habe ich nicht. In Ihrer Größe. Wenn die Taschen so wichtig sind. Ich hätte noch andere schwarze Hosen, aber nur Jeans. Und Sie haben ja gerade gesagt, dass Sie keine wollen.“
„Na gut“, sagte Eddie. „Dann ist heute der Tag, an dem ich mit einer dunkelblauen Hose nach Hause komme. Komisch, dass man sich nicht mal einen bescheidenen Wunsch erfüllen kann. Und ich brauche einen Pullover“, fügte er hinzu, „und der soll auch schwarz sein. Warst du schon mal in Äthiopien, um nach deinen Wurzeln zu suchen?“, fragte er neugierig.
Die Mutter griff verärgert ein. „Jetzt nerv hier nicht rum. Mach, dass du in die Umkleidekabine kommst, du musst die Hose anprobieren. Ich such solange einen Pullover. Frag die Leute nicht, wo sie herkommen, das geht dich nichts an. Fändest du es gut, wenn alle wissen wollten, woher du stammst?“
„Ja, das fände ich gut“, erwiderte er.
Er riss den Vorhang zur Seite und betrat die enge Umkleidekabine, streifte die alte Hose herunter und zog die neue an. Die Mutter brachte einen Pullover, sie hatte den mit New York gefunden, aber den wollte er nicht anprobieren, er konnte sehen, dass er passte. Mass bezahlte siebenhundertzwanzig Kronen, und Eddie trug die Tüte aus dem Laden.
Sie standen im Café Christiania im ersten Stock vor dem Tresen.
„Du kannst ein Butterbrot haben“, sagte Mass, „und ein Stück Kuchen. Ich nehme Waffeln mit Marmelade. Eddie, du darfst Ausländer nicht fragen, woher sie kommen.“
„Äthiopien ist doch gut“, meinte er. „Da braucht man sich nicht zu schämen.“
Sie setzten sich an einen Fenstertisch. Eddie zerquetschte seine Cremeschnitte auf dem Teller, versuchte, den Deckel in kleine Stücke zu teilen.
„Weißt du noch, wie wir von Las Palmas gekommen sind?“, fragte er. „Weißt du noch, der Neger, der am Flughafen auf der Rolltreppe gefallen ist? Der hat sich beide Beine gebrochen. An mehreren Stellen. So was Schreckliches hatte ich noch nie gesehen.“
„Du darfst nicht Neger sagen“, sagte Mass. „Warum denkst du jetzt an ihn?“
„Weil wir auch mit der Rolltreppe fahren müssen. Sei vorsichtig. Ich nehm die Tüten.“
Er leckte sich die Lippen.
„Heute Abend kommt diese Sendung im Fernsehen, die, wo sie nach vermissten Verwandten suchen. Die will ich unbedingt sehen“, sagte er dann. „Du weißt, dass ich total neugierig auf die Großeltern bin. Und überhaupt auf alle Verwandten von Papa. Woher sie gekommen sind und wie ihr Leben war. Und was sie gemacht haben.“
Mass trank einen Schluck Kaffee.
„Die sind doch tot“, wandte sie ein. „Da spielt das ja wohl keine Rolle. Jetzt gibt es nur noch dich und mich, und ich finde, wir haben es gut.“
Sie nahm einen Bissen von ihrer Waffel.
„Ich finde, du solltest dir eine Freundin suchen“, sagte sie dann. „Ich werde schließlich nicht immer hier sein.“
Eddie machte ein beleidigtes Gesicht.
„Was soll ich mit einer Frau?“, fragte er. „Ich hab doch dich. Warst du traurig, als Papa abgehauen ist?“
„Nein“, sagte sie, „eigentlich nicht, ich war darauf vorbereitet. Er war ein Schürzenjäger, Eddie, nur damit das gesagt ist. Ich habe dir doch erzählt, dass er sich eine andere gesucht hatte, und sie war natürlich viel jünger als ich, so sind die Männer eben. Aber dann wurde er krank, er ist schon zweiundneunzig gestorben, also hatte sie nicht viel von ihm. Ich weiß gar nicht, ob sie Kinder hatten. Aber über all das haben wir schon so oft gesprochen, Eddie, ich habe nichts mehr zu sagen.“
„Das hört sich an, als wäre dir alles nur recht so gewesen.“ Eddie klang verletzt. „Hast du überhaupt nicht an mich gedacht?“
„Natürlich habe ich das. Aber du solltest doch nicht bei einem Vater aufwachsen, der uns gar nicht wollte.“
Später an diesem Nachmittag saß Eddie mit der Zeitung auf dem Sofa. Er las gern die Todesanzeigen, ließ sie sich fast schon schmatzend auf der Zunge zergehen, viele alte Damen starben, sie schmeckten nach Kampfer. Einige waren süß wie Karamell, das waren die kleinen Kinder. Andere Todesfälle brannten wie türkischer Pfeffer. Das war dann vielleicht Mord oder Selbstmord, und viele verloren den Kampf gegen den Krebs. Er versank vollständig in seinen Gedanken. Danach machte er sich über das Kreuzworträtsel her. „Corona“. Fünf Buchstaben, der letzte war ein „s“. Er wusste, dass „Corona“ eine Biersorte war, er wusste, dass eine Stadt so hieß. Und es hatte natürlich etwas mit der Sonne zu tun. Er stand auf und suchte im Internet und erfuhr zu seiner großen Überraschung, dass es auch ein Virus war. Was ich alles kann, dachte Eddie zufrieden. Ich hab den Durchblick.
Das Kind schlief neben ihr, eine feuchte Locke war ihm in die Stirn gefallen. Viereinhalb Jahre alt, mit wilden blonden Locken und kleinen weißen Händen mit Fingernägeln wie Perlmutt.
„Simon“, flüsterte sie leise. „Bist du wach? Ein neuer Tag hat begonnen, wir müssen aufstehen.“
Das Kind drehte sich im Bett um, rollte sich auf die Seite und wollte weiterschlafen.
„Dann stehe ich ohne dich auf“, sagte sie resigniert und setzte einen Fuß auf den Boden. „Und dann koche ich dir deinen Brei. Haferbrei mit Butter und Rosinen und Zucker und Zimt.“
Das Kind ließ einen Seufzer hören, als ob die Mitteilung über den warmen Brei in seinen Schlaf gedrungen wäre. Sie küsste ihn auf die Wange und stellte fest, dass die zart und flaumig war. Dann zog sie einen warmen Pullover an, ging über den kalten Boden in die Küche. Sie goss Milch in einen Kochtopf, gab Haferflocken und einen Teelöffel Zimt hinein. Es folgte eine Handvoll Sultaninen. Danach ging sie hinüber und hob das Kind aus dem Bett. Simon klimperte verschlafen mit den Wimpern und legte ihr die Arme um den Hals. Er wog fast nichts, er war ein schmächtiger Junge. Sie trug ihn ins Badezimmer und half ihm beim Anziehen, während er sich auf das Waschbecken stützte. Danach kletterte er auf seinen Hochstuhl am Küchentisch.
Genau wie an allen anderen Tagen war er jetzt bockig: „Ich will nicht in den Kindergarten!“, schrie er und schlug mit dem Löffel auf den Tisch, dass der Brei nur so hochspritzte.
Bonnie hätte weinen mögen.
„Aber das ist doch immer so nett da“, sagte sie eifrig. „Vielleicht kannst du mit Märta spielen. Vielleicht bekommt ihr Kakao mit Marshmallows.“ Sie streichelte seine Wange.
Er schlug noch immer mit dem Löffel auf den Tisch. Er wollte nur bei seiner Mutter sein, und am liebsten wäre er ins warme Bett und unter die warme Decke zurückgekrochen. Bonnie zuckerte seinen Brei und goss noch einmal Milch darüber.
„Heute Nachmittag bin ich ja wieder hier“, sagte sie, „dann machen wir es uns gemütlich. Wir können uns aus zwei Stühlen und der Sofadecke ein Zelt bauen, und ich bringe dir das Essen, das wird doch lustig.“
Jedes Kind hatte sein eigenes Symbol, und Simon hatte an seinem Platz eine Schnecke. Die Schnecke trug ihr Häuschen auf dem Rücken, die Fühler waren aufgerichtet wie Antennen. Er ließ sich auf die Bank aus Kiefernholz fallen, während seine Mutter ihm Jacke und Mütze und Schal und Fäustlinge und die warmen Stiefel auszog. Er war ein wenig in sich zusammengesunken, hatte keine Kraft mehr zum Widerspruch, er wusste, dass seine Mutter losmusste. Jetzt nahm sie ihn an der Hand und brachte ihn zu den anderen Kindern, die wild durcheinanderliefen. Das ist nicht richtig, dachte Bonnie, ihn anderen zu überlassen. Den ganzen Tag weg zu sein. Er und ich müssten rund um die Uhr zusammen sein können. Das Kind dicht an ihren Körper geschmiegt, das Kind in Reichweite, damit sie ihn sofort trösten könnte, wenn etwas passierte. Armselige drei Stunden hatten sie abends zusammen. Ihr schlechtes Gewissen machte ihr zu schaffen, aber sie musste arbeiten. Sie war bei einem Heimpflegedienst angestellt, putzte und wusch für ältere Leute und kümmerte sich ums Essen. An diesem Tag musste sie als Erstes zu Erna, und die war eine Zumutung.
„Guten Morgen, Simon“, sagte Kaja, die Kindergartenleiterin. „Was würdest du heute gern machen?“
Er hatte keine Antwort. Der kleine Junge war es nicht gewohnt, dass seine Wünsche erfüllt wurden, er trottete langsam durch den Raum und setzte sich auf das große Sofa in der Ecke, nahm sich ein Bilderbuch. Fing mit dünnen Fingern an zu blättern. Er konnte einige Wörter lesen, das hatte seine Mutter ihm beigebracht, „Eis“ und „Affe“ und seinen eigenen Namen. Nun sah er den Rücken der Mutter durch die Tür verschwinden, und gleich darauf lief er zum Fenster. Sah die Hecklichter ihres Autos in der Auffahrt und auf der Straße. Jetzt musste er neun Stunden warten. Er blätterte langsam durch das Buch.
Kaja setzte sich neben ihn.
„Heute hast du Küchendienst“, sagte sie lächelnd. „Das wird doch nett. Wir werden Brötchen backen. Du darfst wieder den Teig kneten.“
Auch darauf erwiderte Simon nichts. Der Anblick des unglücklichen kleinen Wichtes von nur viereinhalb Jahren brach Kaja fast das Herz. Niemand dürfte ein weinendes Kind verlassen müssen, fand sie, und sie hatte Mitleid mit Bonnie Hayden. Dann versuchte sie, an das Gute zu denken. Dass er niemals hungern oder frieren musste, dass er ein Kind war, das von ganzem Herzen geliebt wurde, denn das galt ja nicht für alle.
Bonnie blieb in ihrem Auto sitzen, um sich zu fassen. Es war jeden Morgen der gleiche Schmerz, das gleiche schwarze Gewissen, und sie versuchte, alles zu unterdrücken. Fuhr durch das Tor, auf dem Weg zu Erna, die ungeheuer anspruchsvoll war, weshalb es Bonnie vor diesem Besuch grauste. Sie verfluchte ihr Leben, weil es so armselig war, jeden Morgen dieser Kampf mit dem weinenden Kind. Kein Geld und die Verzweiflung darüber, mit dem Kind allein zu sein. Andere waren so viel fröhlicher als sie, sie waren immer obenauf, hatten Pläne und Träume für sich und ihre Kinder. Sie dachte oft über Simon nach, dass er vielleicht nie zurechtkommen, dass er immer den Kürzeren ziehen und am Rand stehen würde. Das Leben bestand aus einer endlosen Reihe von Verpflichtungen und Forderungen. Er musste den Kindergarten schaffen, er musste Freunde finden. Sich mit dem Personal und den anderen vertragen. Danach würde er es in der Schule schaffen, etwas leisten und Beziehungen aufbauen müssen. Irgendwann würde er erwachsen sein und sich Arbeit suchen, am besten eine gut bezahlte, die Sicherheit bot. Am schönsten wäre es, wenn er eine Frau fände und sie Kinder bekämen. Und wenn sie keine Kinder bekämen, würden sie das erklären müssen. Nein, wir wollen keine, oder: Wir können keine bekommen. Und wenn sie dann doch Kinder bekämen, würden auch die sich wieder der endlosen Reihe von gesellschaftlichen Verpflichtungen und Forderungen stellen müssen. Mein kleiner Simon, dachte sie mit brennenden Augen, wie soll das gehen? Der Wagen schlingerte, als sie in den vierten Gang schaltete, und im Auspuffrohr war ein Loch. Der Wagen könnte jederzeit seinen Geist aufgeben, und sie würde sich keinen neuen kaufen können. Und wenn sie kein Auto hätte, könnte sie nicht mehr für den Pflegedienst arbeiten. Ihr Herz schlug ihr bei diesem Gedanken bis zum Hals. Sie biss die Zähne zusammen und gab Gas. Sie wusste, dass Erna am Fenster saß und mit Adlerblick nach ihr Ausschau hielt.
Ernas Profil war wie in Stein gehauen, als sie am Fenster wartete. Bonnie sah den scharfen Nasenrücken durch die Glasscheibe. Wie immer ließ sie sich mit dem Öffnen Zeit, ließ Bonnie nur überaus gnädig eintreten. Sie musste sich auf diese Weise aufspielen. Sowie Bonnie im Haus stand, nahm sie den Geruch eines alten Menschen wahr, der sich nicht mehr selbst rein halten konnte.
„Heute ist es kalt“, klagte Erna. „Sie müssen einheizen. Ich habe schrecklich kalte Füße, wie ist das bei Ihnen?“
„Danke der Nachfrage“, sagte Bonnie, „Simon war richtig blau gefroren, als wir zum Kindergarten gefahren sind.“
„Dass ihr jungen Mütter heute eure Kinder allein lasst“, sagte Erna streng. „Wir haben das nicht getan, wir waren immer bei ihnen. Warum haben Sie sich in diese Lage gebracht, dass Ihnen ein Mann fehlt? Hat er vielleicht nicht bekommen, was er brauchte? Sie wissen doch, wie die Männer sind.“
„Aber er hat mich ja verlassen“, antwortete Bonnie verzweifelt. „Das habe ich doch schon erklärt. Er hat eine andere kennengelernt, die viel jünger war, ich konnte nichts dagegen tun. Sie hätten ihn mal sehen sollen, er war wie besessen. Und ich will keinen neuen, jetzt reicht es mir.“
Sie wandte sich ab und ging in Ernas Schlafzimmer. In der Ecke stand ein Korb mit einzelnen Socken. Bonnie wurde bei dem bloßen Anblick schon müde. Sie blieb eine Weile vor dem Bett stehen und ließ den Kopf hängen. Wenn sie sich doch einfach auf die weiche Matratze fallen lassen könnte! Ihr Kopf schmerzte vor Müdigkeit, und sie konnte die Vorstellung nicht ertragen, jetzt putzen zu müssen, aber trotzdem drehte sie sich mit dem Sockenkorb in den Armen um. Auf dem Weg hinaus schaute sie zufällig an der Wand hoch und sah das Foto an, das immer schon dort gehangen hatte. Es zeigte Erna als Konfirmandin in bodenlangem Kleid. Immer wenn Bonnie dieses Bild ansah, staunte sie. Konnte das denn wirklich Erna sein? Es war nicht zu fassen, denn das hier war ein schönes Mädchen mit strahlendem Lächeln. Sie ging wieder ins Wohnzimmer, holte tief Luft und legte los. Erna saß mit einer Decke über den Knien im Ohrensessel und beobachtete sie mit ihren Adleraugen, der scharfe Blick stach Bonnie in den Rücken. Sie zog eine Socke aus dem Korb und bückte sich, hob den schweren eichenen Couchtisch an und streifte eine Socke über das Tischbein. Dann machte sie das beim zweiten, beim dritten und beim vierten. Anschließend nahm sie sich die Sessel vor, auch die waren bleischwer. Am anderen Ende von Ernas Wohnzimmer stand ein riesiger Esstisch mit sechs Stühlen, ebenfalls aus massiver Eiche. Bald trugen alle Möbel hier weiße Tennissocken mit roten und blauen Streifen. Nun holte Bonnie den schweren alten Staubsauger aus der Abstellkammer. Das Holz der Möbel war geschützt vor dem Mundstück des Staubsaugers und vor dem Besen, die sonst dagegenstoßen und Kratzer hinterlassen könnten. Erna hatte Angst vor Abnutzung, die Prozedur mit den Socken war ein festes Ritual. Die ganze Zeit ließ sie Bonnie nicht aus den Augen. Die Hände lagen wie Krallen in ihrem Schoß, und das magere Gesicht zuckte hin und her wie der Kopf eines Raubvogels.
„Wir machen heute die Fenster“, erklärte sie. „Die haben Flecken. Lernen Sie denn nie, den Abzieher zu benutzen, ohne noch mehr Schlieren zu hinterlassen?“
Bonnie antwortete laut durch das Dröhnen des Staubsaugers: „Es ist zu kalt, Erna“, sagte sie müde.
Aber Erna wusste Rat.
„Dann gießen Sie ein wenig Brennspiritus ins Putzwasser“, ordnete sie an. „Die Flasche steht im Küchenschrank.“
Bonnie brachte es nicht über sich zu antworten. Sie bugsierte das Mundstück des Staubsaugers zwischen die Tischbeine und hatte furchtbare Angst, dem edlen Holz zu nahe zu kommen. Dann würde Erna einen Wutausbruch bekommen, im Büro anrufen und behaupten, Bonnie passe nicht auf und nehme keine Rücksicht. Nicht, dass sie damit bei Ragnhild vom Heimpflegedienst auf offene Ohren gestoßen wäre, aber es wäre dennoch schrecklich gewesen. Erna hatte das Radio laufen, Bonnie konnte die Nachrichten hören. Ein Sachbearbeiter im Osloer Arbeitsamt war tätlich bedroht worden.
„Das war sicher ein Ausländer“, meinte Erna. „Vermutlich ein Afrikaner. Mit denen ist doch kein Auskommen, die kommen nur zum Schmarotzen her.“
Bonnie richtete sich auf, um ihren Rücken auszuruhen. Sie war selbst beim Arbeitsamt gewesen und hatte sich eine Nummer gezogen, als sie keine Anstellung gehabt und Sozialhilfe gebraucht hatte. Sie hatte gesehen, dass viele Ausländer dort warteten, und sie hatte bittere Gedanken gedacht, auf die sie nicht gerade stolz war. Sie beugte sich wieder über den Staubsauger. Simon, wo bist du jetzt? Sitzt du in dem Häuschen in der Spielecke oder mit einem Buch auf dem Sofa? Oder vielleicht bist du draußen mit den anderen und fährst Schlitten? Nicht weinen, ich komme bald, ich muss nur putzen. Jeden Tag muss ich putzen. Und vielleicht, wenn ich hart arbeite und spare, so gut ich nur kann, können wir mit dem Flugzeug verreisen. Ans Mittelmeer. Und dann kannst du im warmen Wasser planschen und im Pulversand spielen.
„Ich hoffe, der Afrikaner wird nach Hause geschickt“, verkündete Erna in ihrem Ohrensessel.
„Wenn er Afrikaner ist“, sagte Bonnie. „Auch Norweger bedrohen andere, wenn ihnen nichts Besseres einfällt.“
Sie versetzte eine Stehlampe und einen Korb voller Zeitungen, und ab und zu lugte sie zu den Fenstern hinüber, die waren spiegelblank. Brennspiritus ins Wasser, ja, das würde ihr wohl nicht erspart bleiben. Sie müsste auf einer Trittleiter im Schnee stehen, um von außen an die Fenster zu gelangen. Sie stellte den Staubsauger zurück in die Abstellkammer, knallte die Tür zu und setzte sich in einen Sessel, wollte kurz verschnaufen. Aus dem Radio waren brausende Orgelklänge zu hören. Erna hatte die Augen geschlossen.
Jetzt die Böden. Bonnie stand auf, um den Eimer zu holen, füllte ihn mit heißem Wasser, aber nicht so heiß, dass es dem Glanz des Eichenparketts schaden würde. Das nahm Erna genau. Danach nahm sie sich Küche und Schlafzimmer vor, am Ende das Bad. Die Fugen zwischen den weißen Fliesen waren grau geworden, und Erna hatte vorgeschlagen, sie könnte sie mit der Zahnbürste sauber schrubben.
Bonnie schüttelte Läufer aus. Sie wusch Kleider und bezog das Bett neu. Danach setzte sie sich an den Küchentisch und putzte einen fünfarmigen Leuchter aus Silber, den Erna einmal in Ägypten gekauft hatte. An sich sollte sie solche Arbeiten überhaupt nicht übernehmen, aber es war ihr eine willkommene Aufgabe, eine Abwechslung. Sie konnte ganz ruhig sitzen und ihren Rücken ausruhen. Aber danach musste sie draußen im Schnee vor den großen Fenstern balancieren, während Erna drinnen stand und alles genau beobachtete. Der Abzieher durfte keine Streifen hinterlassen, dann wäre Bonnie verloren. Ihre Hände in den Gummihandschuhen waren eisig, und ihre Ohren ebenso. Danach trug sie die Trittleiter wieder ins Haus und stellte sie zurück. Sie goss Blumen und wischte Staub, brachte die alten Zeitungen zum Altpapier, wechselte in der Küche eine Glühbirne aus, steckte fünf weiße Kerzen in den Leuchter. Danach sah sie die Lebensmittel im Kühlschrank durch. Vieles hatte das Verfallsdatum überschritten, wie Milch und Aufschnitt. Endlich ließ sie sich auf einen Stuhl sinken. Die halbe Arbeit dieses Tages war vorüber, jetzt kam Marie an die Reihe. Da ging alles viel leichter, Marie hatte eine kleine Wohnung in einer Wohnanlage für Senioren. Erna erhob sich nun aus ihrem Ohrensessel und schlurfte in Richtung Schlafzimmer davon. Bonnie wartete und dachte dabei an Marie. Nach einer Weile kehrte Erna mit einem Schuhkarton zurück.
„Das können Sie haben, das habe ich aufbewahrt“, sagte sie mit schroffer Stimme. „Die liegen hier seit Jahren, ich bekomme sie nämlich immer zu Weihnachten. Und so etwas kann ich eben nicht mehr brauchen.“
Bonnie sah den Karton an. Ein Bindfaden hielt den Deckel fest, und der Karton war ziemlich leicht. Sie hatte von Erna noch nie etwas bekommen, Erna war schrecklich geizig. Zur Not schob sie einige Brotkrümel zusammen und fütterte damit die Vögel. Aber Bonnie bedankte sich herzlich für das Geschenk, ging damit zur Tür und verabschiedete sich.
Marie saß auf einem Stuhl und ließ sich von Bonnie duschen.
Sie trug einen Plastikkittel über der Kleidung, wurde aber dennoch triefnass, das passierte jedes Mal. Das Schwierigste war, die Wassertemperatur richtig einzustellen, denn Marie war so empfindlich, Bonnie musste zuerst behutsam ihre Füße duschen. Mal war es zu heiß, mal war es zu kalt, aber am Ende konnten sie sich dann einigen. Danach, wenn der magere Leib abgetrocknet war und Marie auf der Bettkante saß, wurde sie von Bonnie mit Feuchtigkeitslotion eingecremt. Die alte Haut war so trocken, dass sie sich schuppte. Während Bonnie die alte Frau massierte, saß Marie ganz still da und dachte über die Schlechtigkeit der Menschen nach, wie es ihre Gewohnheit war. Ein Mann hatte seine Frau mit einem Strick erwürgt. Er hatte sie in eine Decke gewickelt und in sein Auto gelegt, danach hatte er sie zu einem Steinbruch gebracht und sie hineingeworfen.
„Glaubst du, der kommt her?“, fragte Marie ängstlich.
Bonnie musste lächeln. Sie war bei Maries Füßen angekommen, die waren klein wie Kinderfüße.
„Nein, meine Liebe, warum sollte er? Die hatten sich sicher gestritten“, meinte sie. „Und du streitest dich doch nie. Und außerdem kommt er für viele Jahre ins Gefängnis.“
„Aber er kommt doch wieder raus“, entgegnete Marie. „Und dann sucht er sich bestimmt eine Neue. Ich werde die Tür nicht öffnen. Klingel dreimal kurz, wenn du kommst, damit ich weiß, dass du es bist.“
*
Simon saß am Fenster und hielt nach ihr Ausschau.
Bonnie parkte vor dem Kindergarten und war glücklich, denn jetzt hatten sie und er den ganzen Abend und die Nacht für sich. Alles, was er tagsüber nicht bekommen hatte, sollte er jetzt haben, sie hatte eine Flasche Malzbier und eine Packung Dinosaurierkekse gekauft. Er kam angerannt, als sie die Tür öffnete, seine Wangen waren rot, er war lange draußen an der kalten Luft gewesen. Er setzte sich sofort auf seinen Platz unter der Schnecke, und sie half ihm beim Anziehen.
„Jetzt fahren wir nach Hause und bauen uns ein Zelt. Ein ganz großes bauen wir uns, wir nehmen Laken und Decken, und ich hab viele Wäscheklammern zum Befestigen.“
Simon stieg hinten ins Auto ein, und sie schnallte ihn an.
„Ich soll von Marie grüßen“, sagte Bonnie fröhlich. „Sie kann sich nie merken, wie alt du bist, sie glaubt, du gehst schon in die Schule.“
„Was hast du in dem Karton?“, fragte er neugierig. Bonnie hatte den Schuhkarton mit dem Bindfaden im Auto auf die Rückbank gestellt. Sie stieg ein und ließ den Motor an, wie immer musste der Opel einige Male husten, ehe er ansprang.
„Keine Ahnung“, sagte sie. „Den hab ich von Erna bekommen. Was glaubst du, was drin ist, wollen wir raten?“
Simon streckte die Hand nach dem Karton aus und stellte ihn sich auf den Schoß. Schüttelte ihn einige Male, aber es war nichts zu hören.
„Sind das keine Schuhe?“, fragte er erstaunt.
Bonnie musste lachen.
„Nein“, sagte sie und sah ihn im Rückspiegel an. „Ernas Schuhe kann ich nicht anziehen, sie hat so große Füße.“
Sie überlegte kurz und fuhr dann los, nachdem sie zuerst in beiden Richtungen nachgesehen hatte, ob die Bahn frei war.
„Ich habe mich schon gefragt, ob es eine Blumenvase sein könnte“, sagte sie, „oder ein paar Kaffeetassen, die sie nicht braucht. Sie meinte, sie hat es zu Weihnachten bekommen und braucht es nicht. Dass sie zu alt dafür ist.“
„Wird man zu alt für Kaffeetassen?“, fragte Simon verwundert.
„Nein, natürlich nicht, das war gerade dumm von mir. Vielleicht sind es Pralinen, die bekommen alte Damen oft zu Weihnachten. Und dann sind sie sicher verschimmelt, und wir können sie nicht essen.“
„Und sie kriegen Pantoffeln“, bemerkte Simon altklug. „Oma hat mehrere Paar, und die hat sie von uns.“
„Vielleicht ist es eine kleine Handtasche“, sagte Bonnie nach einer Weile. „Das wäre schön. Erna geht ja nie mehr aus. Und da hat sie gedacht, ich könnte die Tasche besser brauchen als sie.“
Simon beugte sich vor und packte ihre Rücklehne. „Du gehst auch nicht aus“, sagte er.
Bonnie sah ihn wieder im Rückspiegel an. „Nein, das tu ich nie. Ich will viel lieber mit dir zusammen sein.“
Als sie nach Hause gekommen waren und sich im Flur die dicken Sachen ausgezogen hatten, fragte Bonnie, ob sie zuerst essen oder den Schuhkarton aufmachen sollten.
Simon musste überlegen. „Was gibt es denn?“, fragte er neugierig.
„Nudeln“, antwortete Bonnie. „Mit Tomatensoße.“ Simon setzte sich aufs Sofa und zog die Knie ans Kinn, und Bonnie stellte den Schuhkarton auf den Tisch. Wieder hob Simon ihn hoch und schüttelte ihn.
„Ich frag mich, ob das vielleicht eine Lampe ist“, sagte er nachdenklich.
„Dann aber eine kleine“, sagte Bonnie. „Nein, eher ist es eine Taschenlampe. Die kann Erna sicher nicht brauchen. Oder vielleicht doch, falls es mal einen Stromausfall gibt, muss sie ja den Sicherungskasten finden können. Ich stelle mir vor, wie sie durch das Haus stolpert und gegen ihre Möbelmonster stößt, wie sie die Lampen umstößt und die Vorhänge herunterreißt.“
Simon lachte glucksend. „Erst die Nudeln, dann wird das Geheimnis noch größer. Wer zuerst in der Küche ist!“
In der Eile riss er den Hocker um, den er brauchte, um auf die Anrichte schauen zu können. Er sah gern zu, wenn seine Mutter kochte, liebte ihre dünnen, ringlosen Finger.
„Das ist schön“, sagte sie, „dann kannst du das lernen. Irgendwann bist du erwachsen, und dann musst du dir eine eigene Wohnung suchen und selbst kochen.“
Simon schüttelte energisch den Kopf. „Nein, ich will immer bei dir wohnen, ich will nicht wegziehen.“
Bonnie ließ Wasser in den Kochtopf laufen und stellte ihn auf die Platte. Nach einer Weile fing es an zu rauschen, und sie öffnete die Tüten mit Nudeln und Tomatenpüree. Simon bekam trockene Nudeln zum Spielen. Er legte sie in einer langen Reihe auf den Tisch, wie zu einer Perlenkette. Sie fragte, was sie ihm im Bett vorlesen solle. „Die wilden Kerle“, antwortete er sofort.
„Aber das haben wir doch gestern erst gelesen.“
„Ja, aber ich will die Geschichte noch ganz oft hören.“
Bonnie stellte das Essen auf den Tisch, und Simon setzte sich dazu. Immer wieder schielte er zum Wohnzimmer hinüber, zu dem Karton, der mit seinem dünnen Bindfaden so verheißungsvoll dort stand. Simon aß in aller Eile, dann half er seiner Mutter beim Abräumen, sie spülte die Teller mit heißem Wasser ab und stellte sie aufeinander. Am Ende wischte sie den Tisch ab und ging ins Wohnzimmer. Bonnie setzte ihm den Karton auf den Schoß, Simon mühte sich mit dem Bindfaden ab. Erna hatte einen bombenfesten Knoten gemacht, aber Bonnie half ihm nicht, das musste er allein schaffen. So ließ sich der kostbare Augenblick noch ein wenig in die Länge ziehen.
„Vielleicht ist es Geld“, sagte er hoffnungsvoll. Denn er wusste, dass seine Mutter davon nie genug hatte.
„Geldscheine wiegen doch nichts“, sagte Bonnie. „Das hier ist schwerer.“
„Aber Münzen“, schlug Simon vor, „Zehnkronenstücke.“
„Nein, das hätten wir gehört, die würden ja klappern. Außerdem ist Erna geizig.“
Jetzt war auch Bonnie ungeduldig, es kam sehr selten vor, dass jemand ihr etwas schenkte. Simon hatte den Doppelknoten endlich lösen können. Er warf den Bindfaden auf den Boden und saß eine Weile mit der Zungenspitze im Mundwinkel da.
„Sollen wir eine Fanfare blasen?“, fragte Bonnie. „Dann kannst du den Deckel abnehmen.“
Sie hielt sich die Hände wie einen Trichter vor den Mund. Dann stieß sie eine lange jubelnde Fanfare aus, und Simon hob endlich den Deckel von der Schachtel. Eine Weile starrten sie hinein. Simon machte ein enttäuschtes Gesicht.
„Das ist ja bloß Zeitungspapier“, sagte er und warf den Deckel auf das Sofa.
„Das bedeutet, dass es etwas Zerbrechliches ist“, sagte Bonnie. „Du musst auspacken. Sei vorsichtig.“
Simon nahm ein kleines Päckchen heraus. Er sah sofort, dass es noch mehrere davon gab, und jetzt war seine Neugier endgültig geweckt.
„Das ist sicher Nippes“, meinte Bonnie. „Davon hat sie jede Menge.“
„Nippes?“
„Zierrat, Figuren und so was.“
Vorsichtig öffnete er das Päckchen, er mühte sich ein wenig ab, denn er war zu eifrig, aber dann hielt er eine kleine Flasche in der Hand.
„Parfüm!“, rief Bonnie. „Das hab ich mir immer gewünscht, aber ich kann es mir ja nicht leisten.“
Simon bewunderte das Fläschchen. Seine Mutter war froh, und da war er auch froh. Sie nahm ihm den Flakon aus der Hand und drehte den Verschluss ab, hielt ihn ihm unter die Nase.
„Oscar de la Renta“, sagte sie, „das ist sehr teuer.“
„Wer ist Oscar?“, fragte Simon.
„Oscar, das ist der, der das Parfüm gemacht hat.“
„Aber warum ist das so teuer?“
„Parfüm wird aus Blumen hergestellt“, erklärte Bonnie. „Und für eine kleine Flasche sind sehr viele Blumen nötig. Stell dir vor, wie Oscar durch seinen Garten geht und einen großen Korb mit Blumen füllt.“
„Pflückt er sie selbst?“
Bonnie musste lachen. „Nein, das Parfüm wird in einer Fabrik gemacht. Du musst noch ein Päckchen öffnen, da sind ja noch mehr.“
Sie stellte das Fläschchen auf den Tisch, und da funkelte der goldene Verschluss im Schein der Lampe. Simon packte noch ein Päckchen aus. Das Papier fiel auf den Boden vor dem Sofa, aufräumen könnten sie später noch.
„Gucci“, sagte Bonnie begeistert. „Komm, auch daran müssen wir riechen.“
Sie ließ Simon zuerst schnuppern, danach nahm sie ihm das Parfüm weg und roch selbst. Dieser Flakon war anders, aber ebenfalls sehr schön, und sie stellte ihn neben den von Oscar de la Renta. Das dritte Fläschchen war geformt wie ein Frauenkörper. Dort, wo der Kopf hätte sein sollen, saß der Verschluss, und daran rochen sie nun nacheinander. Das vierte war kugelrund, vielleicht so groß wie ein Tennisball, und dann war nur noch eines übrig. Der Flakon war schlicht und viereckig, langweilig, fand Simon, er mochte die anderen Fläschchen lieber.
Aber Bonnie schlug vor Begeisterung die Hände zusammen. „So was hab ich ja noch nie gesehen!“, sagte sie. »Das hier ist das allerfeinste, das ist Chanel N° 5.«
„Sind da viele Blumen drin?“, fragte Simon.
„Ja, ganz viele. Ich kann dir sagen, Simon, das ist das berühmteste Parfüm auf der ganzen Welt.“
Plötzlich schlug sie die Hände vors Gesicht und fing an zu schluchzen. Simon war völlig erschrocken. Er nahm ihr das Fläschchen aus der Hand und stellte es neben die anderen. Er begriff nicht, warum seine Mutter weinte, sie war doch eben noch so froh gewesen. Sie wischte sich die Tränen ab und streichelte seine Wange.
„Weißt du, ich bin einfach so gerührt“, sagte sie. „Das habe ich doch von Erna bekommen, das hätte ich nie von ihr gedacht.“
Sie drehte und wendete die Fläschchen.
„Morgen bekommst du auch ein Geschenk, dann gehen wir ins Spielzeuggeschäft.“
Simon klatschte in die Hände. „Aber können wir uns das denn leisten?“, fragte er verwundert.
»Ja, morgen können wir uns das leisten. Ich habe ein Geschenk bekommen, dann musst du auch eins haben. Und jetzt nehme ich mir einen Tropfen Chanel N° 5.«
Sie drehte den viereckigen Verschluss von dem Flakon und feuchtete sich den Zeigefinger an, tupfte damit auf ihr linkes Handgelenk.
„Warum machst du dir das auf den Arm?“
Bonnie stellte das Parfüm weg und erklärte: „Weil die Haut da so dünn ist. Und unter der Haut gibt es eine dicke Ader, deshalb ist die Haut gerade da so warm. Und wenn Parfüm warm wird, riecht es besonders stark. Komm, Simon, jetzt bauen wir ein großes Zelt.“
Vier Stühle und vier Laken später hatte Simon mitten im Wohnzimmer ein prachtvolles Zelt. Er zog einige Kissen vom Sofa und kroch hinein. Bonnie kniete nieder und kam dann hinterher. Dann saßen sie eine Weile schweigend da.
„Ich gehe jetzt Die wilden Kerle holen“, sagte sie, „du wartest hier. Und wir brauchen eine Taschenlampe.“
Sie fand das Buch im Regal und ging wieder ins Zelt, suchte sich ein Kissen aus.
„Können wir auch mal ein echtes Zelt haben und im Wald schlafen?“, fragte Simon hoffnungsvoll.
„Ja, versprochen“, sagte sie. „Aber es dauert noch eine Weile. Hier, du musst die Taschenlampe halten.“
Sie las die ganzen wilden Kerle vor. Ihre Stimme hob und senkte sich, und Simon sah die entsetzlichen Ungeheuer deutlich vor sich. Er fand es wie immer wunderbar, es war ja nur ein Märchen, das gut ausging, und der kleine Max kam immer unversehrt nach Hause zurück.
„Ich will heute Nacht hier schlafen“, sagte er plötzlich. „Ich will im Zelt schlafen.“
„Aber der Boden ist steinhart, das ist doch furchtbar unbequem, oder?“
Simon ließ sich nicht von der Idee abbringen. Nach dem Abendessen ging er ins Badezimmer und putzte sich die Zähne besonders sorgfältig. Bonnie holte seine Bettdecke und sein Kopfkissen, und in einem Schrank fand sie die Kissen für die Gartenmöbel, dann kroch sie zurück ins Zelt und baute für Simon ein einfaches Bett. Er sagte Gute Nacht und kroch hinein, legte sich auf die Seite und schob eine Hand unter die Wange. Sie konnte durch die Laken die Taschenlampe leuchten sehen. Sie selbst setzte sich in einen Sessel vor dem Fernseher, um sich die Nachrichten anzusehen. Sie wusste, dass er nicht schlief, aber sie ließ sich nichts anmerken. Wir schaffen das schon, sagte sie sich zum Trost, ich muss mich bei Erna bedanken. Vermutlich wird sie nur schnauben, aber so ist sie eben.
Um zehn schaltete sie den Fernseher aus. Simon hatte die Taschenlampe ausgeknipst, und sie blieb noch eine Weile sitzen und lauschte. Sie dachte, dass er dort drinnen lag und den Atem anhielt, während er ebenfalls lauschte. Dann erhob sie sich und löschte die Lampen, dachte zugleich, dass es jetzt im Zelt stockfinster sei. Aber er hatte doch dort übernachten wollen, in der warmen Höhle mit den vielen Kissen. Sie ging ins Schlafzimmer und ließ die Tür offen stehen, blieb lange liegen und lauschte, denn sie wusste, dass er bald kommen würde. Und dann würde er nicht in sein eigenes Zimmer gehen. Er würde zu ihr kommen, wenn sie glaubte, er sei eingeschlafen, und sie würde die Decke für ihn zurückschlagen und ihn ins Bett lassen.














DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.