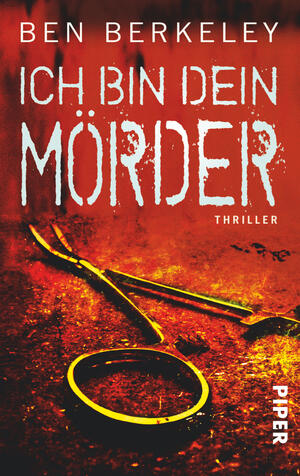
Ich bin dein Mörder (Sam Burke und Klara Swell 2) - eBook-Ausgabe
Thriller
„Ein Thriller, den man kaum aus den Händen legen kann und unbedingt gelesen haben sollte!“ - krimis.com
Ich bin dein Mörder (Sam Burke und Klara Swell 2) — Inhalt
Nie wieder FBI. nie wieder Mord. Sam Burke hat mit seinem Job als Agent abgeschlossen, von jetzt an zählen nur noch seine Psychologie-Professur und sein privates Glück mit Klara. Doch dann erhält er einen anonymen Brief, der ihn zum Handeln zwingt. "Lieber Sam, " steht dort. "Ich habe in den letzten 18 Jahren 24 Frauen getötet. Und ihr habt sie einfach alle begraben. Wieso suchst du mich nicht?"
Leseprobe zu „Ich bin dein Mörder (Sam Burke und Klara Swell 2)“
Lieber Sam,
werden wir das, was wir sind? Oder sind wir das, was aus uns geworden ist? Ich persönlich muss daran glauben, dass die Erste ein Unfall war und dass es nicht meine Entscheidung war, dass alles so gekommen ist. Vielmehr hat mich aus heiterem Himmel ein Schicksal ereilt, das jeden anderen hätte treffen können. Und so war dieser erste Mord auch keineswegs unausweichlich. Im Gegenteil. Tatsächlich hätte der Flügelschlag eines Schmetterlings ausgereicht, alles zu verändern. Dann hätte ich mein Leben nicht dem Tod widmen müssen. Ja, ich betrachte [...]
Lieber Sam,
werden wir das, was wir sind? Oder sind wir das, was aus uns geworden ist? Ich persönlich muss daran glauben, dass die Erste ein Unfall war und dass es nicht meine Entscheidung war, dass alles so gekommen ist. Vielmehr hat mich aus heiterem Himmel ein Schicksal ereilt, das jeden anderen hätte treffen können. Und so war dieser erste Mord auch keineswegs unausweichlich. Im Gegenteil. Tatsächlich hätte der Flügelschlag eines Schmetterlings ausgereicht, alles zu verändern. Dann hätte ich mein Leben nicht dem Tod widmen müssen. Ja, ich betrachte alles, was danach kam, tatsächlich als Notwendigkeit. Zumindest seit jenem schicksalhaften Moment im Jahr 1994 gab es für mein Leben kein Zurück mehr. Seit diesem Tag treibt mein Leben mit mir auf den Tod zu, in mehrfacher Hinsicht. Nicht nur mein eigener Tod ist unausweichlich, sondern auch der vieler anderer, die meinen Weg kreuzen. Zwölf Tode insgesamt, um genau zu sein. Aber ich greife vor. Beizeiten wirst du alles erfahren, was du wissen musst. Aber ich möchte uns die Gelegenheit geben, einander kennenzulernen, und dafür darf ich dir nicht alles auf einmal verraten. Es würde dich und mich überfordern. Möglicherweise möchte ich, dass du mich verstehst, obwohl das natürlich unmöglich ist. Vielleicht ist das aber auch nicht so wichtig, vielleicht zählt nur, was wir glauben.
Ich schreibe diese Zeilen nicht grundlos in einer Kirche, was dir ob ihres Inhalts seltsam vorkommen mag. Aber verrate mir etwas über dich: Wann warst du zum letzten Mal in einer Kirche? Hast den Duft von Weihrauch und kaltem Stein eingeatmet? Roch es nach Leben oder roch es nach Tod? Hast du die kunstvollen Schnitzereien betrachtet, die auf den ersten Blick wirken, als huldigten sie dem Leben, und doch zeigen sie nichts als den Tod? Oder hast du nur gehofft, dass das kirchliche Zeremoniell, das dir fremd geworden ist in deinem Alltag, möglichst schnell vorübergehen möge? Betrachte die Figuren einmal genauer: Sie sollen uns erklären, was unser Innerstes zusammenhält. Hörst du noch den Chor aus dem Seitenschiff? Leise und doch kraftvoll? Sie besingen den ewigen Kreislauf. Der Tod ist das Einzige, was unser Leben zusammenhält. Darf ich deshalb nicht hier sein? Weil ich sein Bote bin? Sollte ich deshalb etwa gar nicht erst sein? Ich bin nicht im tieferen Sinn religiös, aber mir gefällt die Nähe zum Tod, die ich in Kirchen deutlicher spüre als auf jedem Friedhof, sei er jüdisch, muslimisch oder christlich. Vermutlich liegt das daran, dass der Tod hier auf die Hoffnung trifft. Du wirst dich mittlerweile fragen, warum ich dir diesen Brief schreibe. Möglicherweise möchte ich alldem ein Ende setzen, dem, wohin sich mein Leben gewandt hat. Aber eigentlich glaube ich das nicht. Wahrscheinlicher ist, dass ich möchte, dass die Gesellschaft eine faire Chance bekommt. Eine faire Chance gegen das vorzugehen, was aus mir geworden ist. Gegen jemanden, dessen Leben dem Tod gewidmet ist. Denn eines habe ich mich während der vergangenen fünfundzwanzig Jahre immer wieder gefragt: Warum sucht Ihr mich nicht? Ich habe so viele Frauen umgebracht, und Ihr habt sie einfach vergessen. Warum suchst du mich nicht, Sam? Ich sehe, wie eine der gespendeten Kerzen erlischt, genau in diesem Moment. Ich muss gehen. Das nächste Mal erzähle ich dir von Betty.
Tom
Kapitel 1
Sing Sing Correctional Facility, Ossining, New York
Freitag, 8. Juni
Sam stellte die lederne Aktentasche auf den ausgeblichenen Linoleumboden des Beobachtungsraums, direkt unter das Fenster mit der verspiegelten Scheibe. Er warf der Tasche einen kurzen Blick zu, oder besser, ihrem Inhalt. Denn auf den Unterlagen zum ›Praxisseminar Gewaltverbrecher II‹ lag der Brief, der heute Morgen zwischen seinen Rechnungen gesteckt hatte. Unscheinbar. Weißer Umschlag, ein gedruckter Adressaufkleber. Kein Absender. Er schluckte. Ein ganz normaler Brief? Im Gegenteil. Er wusste nicht, was er davon halten sollte. Vermutlich ein Spinner. Egal. Und doch schien ihn der Brief aus seiner Aktentasche heraus anzustarren.
Dreißig Augenpaare blickten erwartungsvoll, abwechselnd auf ihn und auf die verspiegelte Scheibe, doch das Verhörzimmer auf der anderen Seite des Fensters war leer. Noch stand Sam im Besucherraum vor seinen Studenten, aber das würde sich in Kürze ändern. Er blickte in das Befragungszimmer, das ihm vertraut vorkam: in seiner Mitte eine weitere Glasscheibe. Überall Trennwände. Zwischen dem Draußen und dem Drinnen, zwischen dem Guten und dem Bösen. Eine schmale Resopalplatte auf jeder Seite, an der Wand zwei Telefone, eines für ihn und eines für den Insassen. Mit dem Boden verschraubte Metallstühle mit Plastiklehnen, hart und unbequem, warteten auf ihn und den Verhörten. Supermax. Höchste Sicherheitsstufe. Mehrfachmörder, Vergewaltiger, Terroristen. Die dreißig Augenpaare gehörten Studenten der Forensischen Psychologie, Harvard. Die Besten ihres Jahrgangs. Sie waren die Zukunft des NCAVC, des National Center for the Analysis of Violent Crime, neben der Antiterroreinheit eine der profiliertesten Abteilungen des FBI. Und was für die achtzehn Frauen und zwölf Männer die Zukunft bedeutete, gehörte für Sam zur Vergangenheit. Er war früher einer der leitenden Ermittler am NCAVC gewesen. Aber jetzt hatte für ihn und Klara ein neues Leben begonnen. Keine Serienmörder mehr, keine Verstümmler, keine Sadisten. Und wenn, dann ausschließlich zu Forschungszwecken. Nur noch Theorie – wenn es sein Lehrplan erforderte. Erlaubt waren nach dem Versprechen, dass er sich selbst und Klara gegeben hatte, nur solche Psychopathen, die in den sichersten Gefängnissen des Landes einsaßen. Wie heute. Wo ihn eine zentimeterdicke Scheibe Plexiglas von dem Bösen trennte. Von Karel Maria Snow. Einem zwanzigfachen Mörder.
„Ihr alle habt die Akte zu Mr Snow gelesen, nehme ich an?“ Keine ernsthafte Frage. Einer der Vorteile, in Harvard zu lehren, war, dass man sich um die Motivation seiner Studenten nicht zu sorgen brauchte. Allgemeines Nicken.
„Ich habe Sie den weiten Weg fahren lassen, weil ich Ihnen etwas zeigen will, das man mit keiner Vorlesung, keinem Skript, keinem Buch demonstrieren kann: das pure, schiere Böse.“
Das pure, schiere Böse. Deswegen waren sie gekommen. Deswegen galt sein Seminar als eines der beliebtesten des zweiten Jahrs. Live! Und in Farbe! Die Faszination des Unvorstellbaren. Und trotzdem waren sie nicht vorbereitet. Niemand war auf eine schwarze Seele wie die von Snow vorbereitet. Auch er nicht.
„Es gibt drei wichtige Dinge, die Sie von Snow lernen können. Und ich rate Ihnen, diese drei Dinge niemals zu vergessen.“
Einige zückten einen Stift, was sich als überflüssig herausstellen würde. Wer Snow gesehen hatte, würde es nicht vergessen. Niemals. Deshalb fuhr er mit ihnen den weiten Weg von Boston bis ins nördliche New York.
„Erstens: Serienmörder entsprechen möglicherweise nicht im Mindesten dem Bild, das Sie von ihnen haben mögen. Und hüten Sie sich Ihr gesamtes restliches Leben vor jedem diesbezüglichen Stereotyp. Keiner ist wie der andere. Und deshalb kann der Nächste genau der sein, von dem Sie es am wenigsten erwarten.“
Einige Stifte kritzelten seine Worte auf Papier. Sam lächelte. Ein wenig. Dann fiel ihm der Brief in seiner Tasche wieder ein, und das Lächeln gefror zu einer Maske.
„Zweitens: Verabschieden Sie sich von der Annahme, Sie könnten sie fassen, indem Sie denken wie sie. Ein reines Klischee. Natürlich erstellen wir Psychogramme von ihnen, aber wir können uns nicht in ihre Gehirne hineinversetzen, weil sie anders funktionieren als unsere. Wenn Sie ein Profil erstellen, müssen Sie entweder aus dem Erfahrungsschatz der Vergangenheit schöpfen, was in manchen Fällen funktionieren wird und in anderen weniger gut. Und wenn es keine Präzedenzen gibt, dann müssen Sie versuchen, Ihr Gehirn auszuschalten. Denken Sie stattdessen wie ein Tier. Werden Sie zum Löwen, dessen Instinkte für die Jagd ausgebildet sind. Oder zur Zecke, die nichts riechen kann außer Schweiß und dahinter um das Blut weiß, das sie zum Leben braucht. Sie müssen lernen, Ihre Urinstinkte zu wecken. Sonst bleiben Ihre Profile leere Blaupausen, die nicht die Seele des Täters einfangen. Und Snow werden Sie dann niemals verstehen.“
Längeres Gekritzel. Sam war bewusst, dass der zweite Aspekt etwas abstrakt klang, aber Snow würde sich seinen Studenten ins Gehirn brennen, wenn er von seinem Ersatzteillager erzählte.
„Und drittens: Vergessen Sie Hollywood. American Psycho, Hannibal Lecter, Bone Collector. Sind das realistische Figuren für einen Serienmörder? Der hochintelligente Serienmörder, der mit uns ein Spielchen spielt?“
Ein Stich fuhr ihm in die Magengegend. „Warum suchst du mich nicht, Sam?“ Er warf einen flüchtigen Blick auf den Koffer und hoffte, dass sein Unbehagen den Studenten nicht auffiel.
Die Frage stand immer noch im Raum. Und wie es zu erwarten war, erntete er Kopfschütteln. Natürlich nicht! Wie hätte er denken können, dass sie sich von Hollywood verführen lassen würden?
„Doch, meine Damen und Herren angehende forensische Psychologen, die ihr noch einen weiten Weg vor euch habt. Doch, das sind sie.“
Weiter im Text, Sam.
„Sie sind durchaus realistisch, die meisten von ihnen basieren auf Vorbildern, die es tatsächlich gab. Aber es ist höchst unwahrscheinlich, dass Sie in Ihrer Laufbahn auf einen solchen Täter treffen werden. Denn glücklicherweise sind die allermeisten Serienmörder eher unterdurchschnittlich intelligent, wie Sie gleich an Mr Snow live studieren können. Glücklicherweise für uns, weil wir sie dadurch schnappen können. Den Opfern dürfte es ja gleichgültig sein.“
Der Galgenhumor, der unter Ermittlern sehr verbreitet ist, brachte ihm ein paar vorsichtige Lacher ein, die ersten, seit sie das Gefängnis betreten hatten. Die klinische Atmosphäre, die Wachleute mit den großen Tasern und die zuschlagenden Gitter ließen keinen Platz für Heiterkeit.
Snow hatte einen Intelligenzquotienten von 82. Er hatte seinen Opfern die Organe entnommen, weil er glaubte, ein Ersatzteillager für sich anlegen zu müssen. Dass er niemals einen Arzt finden würde, der ihm seine Organe einpflanzen würde, oder die Frage nach der passenden Blutgruppe war ihm nie in den Sinn gekommen. Oder dass eine Leber kaum in einer einfachen Essiglösung erhalten werden könnte. Intelligente Serienmörder sind selten, wiederholte Sam noch einmal – nur für sich selbst und an den Brief gerichtet. Der absolute Ausnahmefall. Die Dunkelziffer. Das einzig Unrealistische an Hannibal Lecter war, dass der Film mit ihm hinter Gittern beginnt. Hätte es Hannibal Lecter wirklich gegeben, den mordenden Psychologieprofessor, das Genie im Teufelsgewand: Es wäre nicht sehr realistisch, dass das FBI ihn je gefasst hätte. Zu jeder Zeit laufen zwischen vierzig und achtzig Serienmörder frei herum, denen es gelungen ist, ihre Mordserien erfolgreich zu verschleiern. Psychologie besteht zu 60 Prozent aus Statistik. Das ist die Realität. Die Ausnahme, aber auch die gehört zur Realität. Noch nicht für die Studenten im zweiten Jahr, aber für dich, Sam. „Nicht nur mein eigener Tod ist unausweichlich, sondern auch der vieler anderer, die meinen Weg kreuzen.“ Er spürte Stiche im Magen. Der Brief. Die ganz seltene Ausnahme?
Hinter sich hörte er ein scharrendes Geräusch aus dem Lautsprecher, der das Verhör mit Snow übertragen sollte. Er kam. Showtime. Vergiss den Brief, Sam. Das ist bestimmt nur ein Spinner, der deinen Namen letztes Jahr in den Zeitungen gelesen hat. Dunkelziffer. Und wenn nicht? Später, Sam. Seine Studenten hatten jetzt nur noch Augen für das Spektakel, das auf der anderen Seite der Scheibe beginnen sollte. Ein Wärter öffnete die Tür, und Snows massige Gestalt betrat den Raum. Er blickte gleichgültig auf die Fesseln zwischen seinen Füßen. Snow würde die Studenten nicht enttäuschen. Der Wärter, der den Gefangenen durchaus sanft auf den Stuhl drückte, nickte dem Spiegel zu. Die meisten der Angestellten im Hochsicherheitstrakt kannten Sam, er hatte für das FBI die Anklage gegen Karel Snow mit vorbereitet. Sam erwiderte den Gruß, obwohl ihn der Beamte natürlich nicht sehen konnte. Ein zweiter Wärter fixierte Snows Fußfesseln am Stuhl. Eine weitere Kette führte zwischen seinen Beinen nach oben und war mit den Handschellen verbunden. Sie war so kurz, dass er seine Arme maximal bis zum Herzen heben konnte. Niemand ging mit Snow ein Risiko ein. Karel ließ alles über sich ergehen. Karel wusste, dass er die Hauptrolle spielte. Snow war immer bereit für die Show.
„Eines noch“, mahnte Sam die gereckten Hälse. Dreißig Augenpaare konzentrierten sich wieder auf ihn. „Egal, wie freundlich er aussieht, egal, wie wenig clever er sein mag, egal, wie überlegen Sie sich ihm gegenüber fühlen hinter der Scheibe. Vergessen Sie niemals: Karel Snow ist ein sehr gefährlicher Mann.“
–––––
Als ihr Tross über den Parkplatz der Sing Sing Correctional Facility lief, schwiegen die Studenten. Zu frisch war der Eindruck des Mannes, der aussah wie ein Tankwart oder der Hausmeister einer Highschool, der seelenruhig erklärte, wie er versucht hatte, ein Organ, das er nicht mehr brauchte, weil er ein schöneres gefunden hatte, auf einem Flohmarkt zu verkaufen. Der dabei ohne jede Regung sprach, mit wulstigen Lippen, keuchend, wegen seiner 140 Kilogramm, die ihn nur noch harmloser aussehen ließen. Dessen Augen beim Gedanken an seine Organsammlung nervös in ihren Höhlen umherwanderten. Der manchmal spuckte, wenn er erzählte, wie schwierig es war, die Organe sauber mit dem Küchenmesser seiner Mutter zu entfernen. Und wie sich das Blut über den Küchenboden ergoss wie ein Eimer roter Farbe.
Als sie den Bus erreichten, der sie zurück nach Cambridge bringen sollte, hörte Sam ein vertrautes Wummern. Ein großer V8-Motor. Tief, grimmig und wenig kompromissbereit. Nicht der gemütliche Reisebus. 444 PS. Der ›Boss‹. Es kam von einem nicht einsehbaren Parkplatz. Er grinste. Für einen kurzen Moment dachte er an seine Studenten, die nun alleine nach Boston zurückfahren würden. Die jetzt ohne seine Hilfe mit Snow fertigwerden mussten. Aber früher oder später mussten sie es lernen. Menschen wie Karel Snow waren ihr Beruf. Den Sam aufgegeben hatte. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere, als einer der profiliertesten Serienmörderjäger des FBI hatte er hingeschmissen. Für die Frau, die mit dem Boss hinter dem Bus auf ihn wartete. Klara ›Sissi‹ Swell. Die so zerbrechlich aussah wie die österreichische Kaiserin. Keine 1,68 groß. Lockige Haare, mehr Muskeln, als man so einem zierlichen Körper zugetraut hätte. Allerdings deutlich älter, als man die Kaiserin in Erinnerung hatte. Und der Boss passte auch nicht wirklich zum Image einer Prinzessin. Er verabschiedete sich von seinen Studenten und lief um den Bus herum. Er freute sich, sie zu sehen. Wie jeden Tag, wenn er nicht in Boston sein musste, sondern in ihrer gemeinsamen Wohnung in New York. Er pendelte jetzt seit etwas über einem Jahr, einen Ruf von Harvard lehnte man schließlich nicht ab. Natürlich nicht. Als er die Front des Busses umkurvt hatte, blendete ihn die Sonne. Seine Augen brauchten einen kleinen Moment, um sich auf das gleißende Licht einzustellen, aber dann sah er sie an der riesigen Motorhaube lehnend. Spöttisch grinsend, wie immer. Lederjacke, Sonnenbrille, Jeans, Bikerboots. Dazu mehr Rennmaschine als Auto. Ford Mustang Boss 302. Das neueste Modell. Ein vollkommener Überfluss an Leistung. Es sah aus wie ein Spielzeugauto. Wenig kaiserlike, aber er musste zugeben, es passte zu ihr. Klara liebte schnelle Autos. Und er liebte nun mal Klara. Sie stellte sich auf die Zehenspitzen, als er sie umarmte. Er schob eine goldblonde Locke hinter ihr rechtes Ohr: „Du holst mich ab?“
„Wenn du schon einmal in New York bist. Außerdem war ich gerade in der Gegend, bei einem furchtbar langweiligen Kunden.“
Eine kurze Pause. Dann der Nachsatz: „Wie ich das ständige Rumgegurke hasse.“
Sam schwieg. Seit sie beide ihre Jobs beim FBI aufgegeben hatten, war ihre Arbeit als Privatdetektiv ein ständiges Streitthema. Scheinbar konnte sie sich nur schwer damit abfinden, nicht mehr im Rampenlicht zu stehen. Das hatte er ihr allerdings nur einmal und nie wieder in dieser Deutlichkeit gesagt. Statt darauf einzugehen, begnügte sich Sam mit Small Talk. Klara gab Gas, und er wurde tiefer in seinen Sitz gedrückt. Als sie auf den Highway fuhren, schnallte Sam sich an. Man konnte ja nie wissen. Mitten in einem selbst für Klaras Verhältnisse halsbrecherischen Überholmanöver, bei dem der Boss um ein Haar den rechten Außenspiegel eingebüßt hätte, fragte sie beiläufig und mit leicht ätzendem Unterton: „Und, Schatz? Wie war dein Tag?“ Zum ersten Mal seitdem sie mit Snow fertig waren, dachte Sam wieder an den Brief in seiner Tasche auf dem Rücksitz. An IHN. Was, wenn ihn sein Gefühl nicht täuschte? Was, wenn der Brief authentisch war? Klara durfte auf keinen Fall von dem Brief erfahren. Er würde nach dem Wochenende entscheiden, wie er damit umgehen sollte.
„Die Studenten waren so schockiert, wie ich mir das erhofft hatte. Ansonsten war Boston langweilig wie immer“, log Sam.
Kapitel 2
Manhattan, New York
Montag, 11. Juni
Adrian von Bingen starrte ins Leere und lauschte dem Summen der Klimaanlage, die sich mit dem heißesten Sommer seit vierzig Jahren redlich abmühte und den Kampf nicht gewinnen konnte. Auf dem Schreibtisch in der kleinen Kammer neben seiner Restaurantküche, die er als Büro bezeichnete, stapelten sich Rechnungen von vier Monaten. Als hoffnungslos betrachtete er das Schlamassel jedoch nicht – zumindest öffnete er die Briefumschläge noch. Pia hatte ihn gewarnt, dass zwölf Plätze für ein Restaurant einfach nicht ausreichten, egal, wie gut er kochte. Welch eine Ironie: Gäste mussten Monate im Voraus reservieren, die Restaurantkritiker beschwerten sich unisono über den winzigen Gastraum, aber über den Service in Wohnzimmeratmosphäre oder seine Kochkünste mokierte sich niemand, im Gegenteil. Kaufen konnte er sich von den positiven Rezensionen allerdings auch nichts, und die für nächste Woche geplante Stiftungsgründung fiel natürlich ins Wasser. Pia und ihr Chef, der Anwalt Thibault Stein, hatten die Verträge über Wochen ausgearbeitet. Alle standen in den Startlöchern, nur er nicht. Was zum einen am Restaurant lag und zum anderen daran, dass er sich weigerte, seine Eltern um das Startkapital zu bitten. Seit er mit Pia zusammen war, lief es besser zwischen ihm und seinem Vater. Oder zumindest nicht mehr unterirdisch schlecht. Aber das Geld für die Stiftung würde er trotzdem alleine besorgen. Ich muss das einfach schaffen, sinnierte er und nahm eine zwei Monate alte Rechnung seines Bäckers zur Hand, als sich ein riesiger Styroporkarton durch die Tür schob. Außer zwei kleinen fleckigen Händen war nichts Menschliches zu erkennen, als sich das Ungetüm wie von selbst auf den Papierstapel fallen ließ. Der Turm geriet ob des unachtsam platzierten Neulings ins Rutschen und wäre direkt in seinem Schoß gelandet, wenn er nicht eingegriffen und das wackelige Konstrukt mit der zweimal gefalteten Bäckerrechnung stabilisiert hätte.
„Shushu, was soll das?“ Jeder nannte den winzigen Chinesen so, obwohl er Xˇu Shu hieß und ein „Mister“ vor seinen Unternehmensnamen gesetzt hatte: Mister Xˇu Shu Fish Co. Einer der zuverlässigsten und besten Fischlieferanten der Stadt. Und für alle eben Shushu, was ausgesprochen wie Schuh-Schuh klang.
„Der feine Herr zahlt seine Rechnungen nicht“, beschwerte sich Shushu hinter seinem Karton. Er klang verärgert. Aber er lieferte noch, das war eine gute Nachricht. Adrian roch die vertraute Meeresbrise allerfrischester Angelware aus dem Atlantik. Premium-Qualität. Die ihren Preis hatte. Aber Shushus Fische waren jeden Preis wert.
„Shushu, kein Problem.“ Adrian stemmte sich aus dem verbogenen Schreibtischstuhl, dessen eine Lehne nur noch wackelig an der Seite herunterhing, und griff in die Hosentasche seiner Jeans. Er ging um die Styroporbox herum und öffnete sie, beugte sich über das Eis, unter dem die bestellten Flundern und der Thunfisch schlummerten. Er inhalierte tief, um Shushu gegenüber seine Bewunderung für dessen Handwerk zum Ausdruck zu bringen. Ein äußerst wichtiger Aspekt, wenn seine Strategie aufgehen sollte. In der engen Tasche seiner Jeans zählte er fünf Scheine von einem Bündel der gestrigen Tageseinnahmen. Links Zwanziger, rechts Hunderter. Er zog die linke Hand aus der Tasche und zerknüllte die Scheine ein wenig, damit sie nach mehr aussahen, und drückte Shushu den viel zu kleinen Betrag in die Hand. „Toller Fisch, Shushu. Du bist der Beste.“
Shushu starrte auf das Bündel in der Hand. „Ich habe Sie gegoogelt, Sie sind ein Baron oder so etwas. Ich dachte immer, die haben Geld wie Heu.“
Adrian fragte sich zum wiederholten Mal, ob er trotz oder wegen seines Titels ständig pleite war. „Nix mehr da, Shushu. Seit hundert Jahren heißt so ein Titel nichts, gar nichts mehr.“
Die Augen des Chinesen finden an zu leuchten: „Hattet ihr eine Revolution?“
„Na ja, das leider gerade nicht“, antwortete Adrian wahrheitsgemäß. „Aber so etwas Ähnliches.“ Historische Akkuratesse brachte ihn sicherlich nicht weiter. Shushu nickte. „Okay, zahlst du den Rest nächstes Mal.“ Adrian blickte versöhnlich. Er hörte die kurzen Schritte durch sein Restaurant eilen, packte sich die Styroporkiste und trug sie in die Küche. Es war noch keiner da, sein Spüler war wieder zu spät. Aber Adrian hatte noch einen Termin, den er auf keinen Fall versäumen wollte, obwohl er nicht gerade angenehm auszugehen drohte: Er würde Pia und Thibault Stein erklären, dass sie das Stiftungsprojekt vorerst auf Eis legen müssten.
Beim Rausgehen schnappte er sich die Bäckereirechnung, einen Stift und Klebeband. Auf der Rückseite des Umschlags notierte er einen Hinweis für seine Lieferanten, alles beim Nachbarn, einem furchtbar bunten Esoterikladen, abzugeben, dessen Besitzer einen großen Bart und viel Zeit hatte und in dem es stark nach Patschuli roch. Aber ein paar Stunden würden seine kostbaren Lebensmittel schon nicht kontaminieren. Obwohl man bei kalifornischen Hippie-Räucherstäbchen nie wissen konnte, dachte Adrian und zog das weiße Hemd aus der Jeans. Hier draußen, auf der Straße, brauchte er jede Luftzirkulation, die er kriegen konnte. Langsam lief er die Driggs hinunter Richtung U-Bahn. Wenigstens arbeitete er nicht zwischen den Wolkenkratzern in Midtown, sondern im eher beschaulichen Williamsburg, wo der mäßige Verkehr den Smog auf einem erträglichen Niveau hielt und wenigstens dann und wann ein Baum etwas Schatten spendete. Und die Straßen einspurig waren und der Hudson die Hektik in den Finanzhaifischbecken von Lower Manhattan hielt, wo sie hingehörte. Außerdem hätte er sich woanders ein eigenes Restaurant ohnehin nicht leisten können. Was für ein Glück, dass ich nicht zum Problemewälzen neige, dachte Adrian noch, als ein schwarzes Auto neben ihm plötzlich langsamer wurde und hupte. Eine dieser Limousinen, die man bestellen konnte wie in anderen Ländern ein Taxi, das erkannte er am Nummernschild. Der Fahrer stieg aus, ein Mexikaner mit Anzug und dunkler Krawatte.
„Mr von Bingen, Sir?“, fragte er. „Zu Thibault Godfrey Steins Kanzlei?“
Einen kurzen Moment war er überrascht, dann nickte er. Wahrscheinlich lief im Inneren des Wagens die Klimaanlage auf vollen Touren. Die U-Bahn nach Manhattan würde einem Höllentrip gleichkommen mit ihren Stahlkolossen in den endlosen Röhren. Luftfeuchtigkeit wie im ecuadorianischen Dschungel. Den Mann schickte der Himmel.
„Mr Stein sagt, Sie seien bald Stiftungsvorstand und als solcher privilegiert.“ Er hielt ihm sogar den Schlag auf. Wenn der wüsste, dachte Adrian ein wenig verbittert. Aber nur ein wenig. Eine Welle kühler Luft wehte ihm entgegen.
„Wie überaus aufmerksam“, murmelte Adrian und glitt auf den Rücksitz. Der Mexikaner ließ die Tür ins Schloss fallen und lief um die Motorhaube herum. Adrian konnte nur hoffen, dass Stein die Limousine vorab bezahlt hatte. Der Fahrer fuhr los und fädelte auf die Brooklyn Bridge ein, die sie nach Manhattan bringen würde, wo die Kanzlei lag. Adrian seufzte und fischte das Telefon aus der Brusttasche seines Hemds, um Pia wenigstens eine halbe Stunde vorab zu informieren, dass es endgültig nichts werden würde mit der Stiftung. Die Bilanz des Restaurants der letzten sechs Monate, die er gerade heute Morgen erst gemacht hatte, ließ keinen anderen Schluss zu. Ja, natürlich habe ich es vor mir hergeschoben, weil ich wusste, dass es nicht gut aussieht, dachte Adrian verärgert über sich selbst, als er die Nummer wählte. Ja, ich bin ein Feigling. Ein Wegläufer. Aber ich werde es trotzdem schaffen, wartet es nur ab. Er hielt das Handy ans Ohr und räusperte sich. Aber nichts geschah. Das Handy funktionierte nicht. Er warf einen Blick auf die Anzeige: Kein Empfang. Mitten in New York? Mitten auf der Straße? Verfluchtes AT&T. Er probierte es noch einmal. Immer noch nicht. Er versuchte, ein Straßenschild zu erkennen, um sich zu orientieren, als er feststellte, dass ihn der Mexikaner im Rückspiegel mit zusammengekniffenen Augen beobachtete. Auf einmal kam ihm sein Gesicht gar nicht mehr so freundlich vor.
„Ich befürchte, Mr von Bingen, dass Ihr Handy hier drinnen nicht funktioniert.“
„Weil wir in Afghanistan sind?“, fragte er verärgert. Was meinte er damit?
„Nein, Sir. Sie können derzeit keine Anrufe tätigen, weil dieses Auto eine spezielle Abschirmung besitzt. Was im Übrigen, technisch gesehen, keine besonders komplizierte Angelegenheit ist.“
Redet so ein mexikanischer Limousinenfahrer? Nein, entschied Arian. Was ging hier vor? Wollte ihn der Mann entführen? Ein Entführer, der einen mit Sir anspricht? Und bei seinem Kontostand ohnehin ein grandioser Scherz. Außerdem sind Limousinen registriert, und seit dem 11. September waren George Orwells Überwachungsvorstellungen aus „1984“, verglichen mit der Überwachung der Stadt New York, nichts.
„Fahren Sie rechts ran“, verlangte Adrian.
„Ich befürchte, Sir, das ist derzeit nicht möglich.“ Ein Blick nach draußen bestätigte: Sie fuhren nicht zur Kanzlei. Sondern quer durch Manhattan weiter nach Westen. Langsam, aber sicher erfasste ihn ein Anflug von Panik. Er rüttelte am Türöffner. Verschlossen. Natürlich. Der Wagen stoppte an einer Ampel. Er warf sich mit dem Rücken gegen die Tür. Trat vor Wut dagegen. Was wollte der Mexikaner von ihm?
„Mr von Bingen“, sagte der Fahrer, seine Stimme war jetzt tonlos. „Es ist zwecklos. Bitte begreifen Sie das.“ Adrian trommelte gegen die Scheibe, versuchte, den Fahrer eines Lieferwagens auf sich aufmerksam zu machen, der neben ihnen stand und mit den Fingern im Takt zu einer Musik auf die Wagentür trommelte. Er blickte beinah in ihre Richtung, ohne Adrian in die Augen zu sehen. Er musste ihn doch sehen! Adrian winkte noch verzweifelter und schlug mit der Faust gegen die Scheibe.
„Sir, ist Ihnen nicht aufgefallen, dass die Scheiben von außen verdunkelt sind?“
„Verdammt!“, schrie Adrian und ließ sich in den Sitz fallen. Noch einmal griff er nach dem Handy, suchte den einzigen Eintrag, von dem er annahm, dass er ihm jetzt helfen könnte: Klara Swell. Sie würde wissen, was zu tun ist. Und sie hatte eine Knarre. Aber das Handy blieb tot. Null Balken. Kein Empfang. Nichts. Adrian ballte die Hand zur Faust und ließ sich in den Sitz sinken. Was sollte er auch tun? Er brauchte eine zündende Idee.
„So ist es besser, Sir. Bitte glauben Sie mir, dass Sie nicht in Gefahr schweben. Mein Auftraggeber möchte nur in Ruhe mit Ihnen reden.“
„Das hätte er aber auch einfacher haben können“, giftete Adrian nach vorne. Er glaubte ihm nicht. Ganz und gar nicht. Und wer sollte das überhaupt sein, dieser ominöse Auftraggeber? Ein Lieferant, der sich für die unbezahlten Rechnungen rächen wollte? Er hatte bisher gedacht, dass er nicht von der Mafia beliefert würde, sondern nur von ehrlichen Händlern wie Shushu. Shushu würde ihm aber keinen Wagen schicken, Shushu würde ihm höchstens einen vergammelten Fisch vor die Tür des Lokals legen.
„Da bin ich mir nicht so sicher“, erwiderte der Mexikaner. „Wie Sie sehen werden, hat er eine sehr spezielle Vorstellung von Diskretion.“
Adrian starrte auf sein nutzloses Handy. „Langsam bekomme ich eine Ahnung davon“, murmelte er zu sich selbst.
„Bitte, Sir, genießen Sie die Fahrt, so gut es Ihnen in dieser für Sie sicherlich verwirrenden Situation möglich ist. Und wenn es Ihre Zeit erlaubt, lesen Sie den Vertrag.“
Was für einen Vertrag?, fragte sich Adrian. Er fingerte am Klappmechanismus der Mittelarmlehne herum. Tatsächlich lag dort ein brauner Umschlag mit einem Aufkleber darauf: Lost Souls Foundation. Stiftung der verlorenen Seelen. Seine Stiftung. Deren Name nicht einmal zwanzig Leute kannten. Die noch nicht einmal gegründet war. Mit einem letzten Funken Hoffnung warf er noch einmal einen Blick auf sein Handy und öffnete dann mit zitternden Fingern den Umschlag.
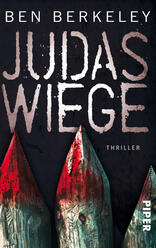





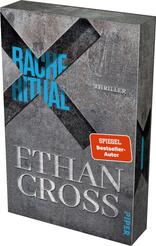






DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.