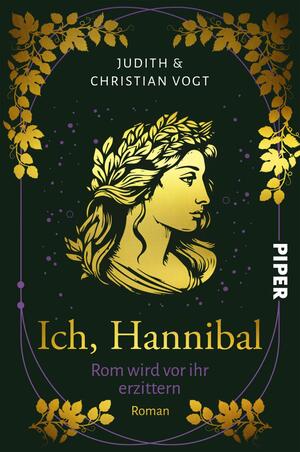

Ich, Hannibal Ich, Hannibal - eBook-Ausgabe
Rom wird vor ihr erzittern
— Eine packende Neuerzählung des größten Feldzugs der Antike„Eine außergewöhnliche, spannende und feministische Nacherzählung eines historischen Feldzugs, mit poetischem Stil und übernatürlichen Elementen, denn hier kämpfen nicht nur Menschen, sondern auch Monster aus antiken Mythen. Der Roman widmet sich auch tiefgehend der Frage, was Krieg mit Menschen macht, und das ist angesichts der krisengeschüttelten politischen Weltlage erschreckend aktuell.“ - amalia-zeichnerin
Ich, Hannibal — Inhalt
218 v. Chr: Feldherr Hannibal und die Armee Karthagos brechen auf, um Rom zu erobern. Doch statt Hannibal führt dessen Mörderin unter seinem Namen die Armee an, und sie entsendet ihre beste Monsterjägerin, die größten Bestien des antiken Mittelmeerraums zu unterwerfen. Nicht nur von Elefanten, sondern auch von Sphinxen, Harpyien und anderen mythischen Kreaturen verstärkt, greift Hannibal Rom an – und sie setzt dabei alles auf eine Karte.
Ein phantastisches modernes Retelling antiker Geschichte, das viele aktuell relevante Fragen aufwirft: Was gilt als monströs? Wie wird Macht über Heere, Menschen und Monster ausgeübt? Und was bedeutet Krieg für die Menschen – über die Bewegungen und Begegnungen von Heeren hinaus?
Leseprobe zu „Ich, Hannibal“
I.
Wie ein neues Zeitalter näherte sich der Gott der Stadt.
„Das ist er!“
Alle, die murrend darauf gewartet hatten, dass ihr Feldherr vom Ende der bekannten Welt wiederkam, spähten ihm entgegen. Sosylos trat aus der Verwaltungsbaracke des Winterlagers, dicht gefolgt von Silenos. Der Sklave aus Sparta und der sizilische Grieche, sie beide waren angetreten, die Geschicke eines großen Mannes zu dokumentieren – in erbitterter Konkurrenz, natürlich. Jetzt kehrte der Mann zurück, dem ihre Schriften gerecht werden sollten. Der sizilische Grieche Silenos hatte [...]
I.
Wie ein neues Zeitalter näherte sich der Gott der Stadt.
„Das ist er!“
Alle, die murrend darauf gewartet hatten, dass ihr Feldherr vom Ende der bekannten Welt wiederkam, spähten ihm entgegen. Sosylos trat aus der Verwaltungsbaracke des Winterlagers, dicht gefolgt von Silenos. Der Sklave aus Sparta und der sizilische Grieche, sie beide waren angetreten, die Geschicke eines großen Mannes zu dokumentieren – in erbitterter Konkurrenz, natürlich. Jetzt kehrte der Mann zurück, dem ihre Schriften gerecht werden sollten. Der sizilische Grieche Silenos hatte immer offener gezweifelt: Wie viel Sinnsuche in einem fernen Heiligtum konnte man vor Soldaten und Heimatstadt rechtfertigen? Wie lange war es götterfürchtig, Melqart um ein glückliches Schicksal zu bitten, und wann wurde es Schwäche, nicht weiterzuziehen ohne göttliche Bestätigung?
Diese Frage hatte sich erledigt.
„Das ist er!“ – der Ruf eines Jünglings im Stimmbruch auf Phönizisch.
„Er ist da!“ – der tiefe Bass eines Veteranen auf iberischem Keltisch.
Sosylos’ Chronistengeist wollte wissen, welchen „er“ sie meinten: den lang ersehnten Hannibal, den jungen Strategen aus Qart-Hadašt, oder den Gott der Stadt, den er als Reittier gebändigt hatte.
Denn der Mann, der an Bord eines Schiffs zum Orakel in Gades gereist war, kehrte auf dem Rücken einer Bestie zurück. Nicht triumphal, wie es unweigerlich bald behauptet werden würde, sondern vorsichtig wie auf einem Pferd, das sich noch in die Kavallerie eingliedern musste.
Triumphal war die Turmhöhe der Bestie, ihre alabasterne Farbe, die Gewalt ihrer Schritte, die goldfunkelnden Spitzen der Stoßzähne. Ebenso golden blitzte das Zyklopenauge auf der Stirn des Elefanten und darüber das Hautbild einer Sonne auf der gefurchten Stirn. Es saß tief in den Poren wie die Zeichnungen unter der Haut von Barbaren.
„Es ist Melqart“, rief ein Bürgersoldat aus Qart-Hadašt.
Sosylos bezweifelte, dass Melqart, der höchste Gott der phönizischen Städte, Elefantengestalt annehmen würde. Es passte nicht zu Melqart, der – egal ob Gott oder Mensch – doch meist vor allem eins war: ein Mann. Und Sosylos’ Blick hatte durch die Beine hindurch unweigerlich das Gehänge gesucht, aber Zitzen gefunden.
„Hannibal ist zurück!“ Weder Zweifel noch Erleichterung klang in Silenos’ Ruf. Nur Triumph – als habe er es immer gewusst. Silenos schlug Sosylos auf den Rücken. „Er ist wieder da! Wir ziehen weiter. Und dann werden wir Geschichte schreiben … zumindest einer von uns.“
Sosylos ignorierte die Spitze. Wild schlug ihm das Herz in der Hoffnung, dabei zu sein, wenn die Welt sich wandelte.
Ein einzelner Mann auf einem einzelnen Monstrum zog ins Winterlager ein. Das gesamte Heer wandte sich ihm zu, jubelte in allen Sprachen, die in seinen Reihen gesprochen wurden. Reihen und Pulks begeisterter Männer formten eine Schneise für die Bestie. Der Mann auf ihrem Nacken knapp oberhalb der gezierten Stirn wankte mit jedem Schritt – nicht wie jemand, der zu fallen drohte, sondern wie ein geübter Reiter, der jede Bewegung mit den eigenen Muskeln abfederte. Wie genau er die Bestie lenkte, konnte in der jubelnden Menge niemand sagen, nicht einmal die Elefantenführer. Sie ähnelte den größeren Elefanten aus Persien und den kleineren numidischen Elefanten, doch der Sand einer älteren Welt rieselte in ihrem Atem. Sie war eines der großen Biester, das ahnten alle, eines der göttlichen Ungeheuer, die vielleicht einst die Welt regiert hatten, bevor die Menschen gewachsen und sie erst angebetet, dann vertrieben und schlussendlich gejagt hatten.
Hannibal hatte es unterworfen. Damit würde er das Heer anführen. Nicht auflösen, nicht zurückschicken, keinem Vertrag gehorchen, keine Hand zum Frieden reichen. Nein, seine Ankunft auf diesem Tier bedeutete nur eins: den Kriegszug.
Natürlich warteten Krieger auf den Krieg, er war zugleich ihr Daseinszweck und ihr Weg, sich aufzuschwingen zu einem anderen Dasein – wenn sie überlebten und bewiesen hatten, wer sie waren. Trotzdem fürchteten Krieger den Krieg, er erschreckte sie bis ins Mark, und deshalb jubelten diese hier nun mit blitzenden Augen und den Armen auf den Schultern der Kameraden. Die numidischen Reiter warfen ihre Helme in die Luft. Die Balearer ließen ihre Schleudern folgen, lachten und tauschten, wenn sie die falsche Lederschlinge aus der Luft fischten. Die Iberer schlugen auf ihre Schilde, dass es über Hügel und Stadt dröhnte. Die Stadtadligen aus Qart-Hadašt stimmten eins ihrer Lieder an Melqart an, eine klanggewordene Sehnsucht nach der alten Heimat, die „Neue Stadt“ hieß. Sosylos, der Spartaner, nannte sie Karchēdón – in Rom machten sie Karthago daraus.
Die Gottheit wandelte unter ihnen, als wären sie nur Grashalme – doch behutsam darauf bedacht, niemanden zu streifen, unweigerlich zu verletzen. Die sinkende Sonne malte einen langen gemeinsamen Schatten von Monstrosität und Reiter.
Und dann, als wären Mann und Monster verbunden, stand die Kreatur still. Die Vielstimmigkeit von Knauf auf Schildbuckel, von vielsprachigem Jubel und Gesang, brach Kehle um Kehle und Schlag um Schlag ab, bis alle schwiegen. Plötzlich war selbst der leichte Wind laut, das Wiehern von einer Koppel, das Absetzen eines Schildrands im Staub, der Ruf eines Vogels aus der Höhe.
Alles teilte denselben Herzschlag, einen elefantenen Herzschlag. Da regte sich die Gestalt in der Höhe endlich, schwang ein Bein über den Nacken und hielt sich einem Sakrileg gleich am Ohr der Kreatur fest, die mit einem langmütigen Ausatmen ein Knie beugte und den Feldherrn absteigen ließ.
Sosylos begriff es sofort. Er war neben dem Biest hergegangen, gefolgt von Silenos, und nach und nach hatten die Kommandanten des Heeres zu ihnen gefunden, angezogen vom Zentrum der Macht, das nun vom ungeheuren Elefanten stieg.
Hannibal trug eine goldene Maske, die Sosylos noch nie an ihm gesehen hatte, darüber waren die dunklen Locken kurz geschnitten, der Schulterschutz aus hartem Leder, der vorn und hinten am Brustpanzer befestigt war, ließ seine Statur entschlossen und kräftig erscheinen.
Aber die Größe stimmte einfach nicht und auch nicht die Haltung oder der Gang der Beine unter dem Streifenschurz. Nicht, dass dieser Mann hier schwach gewirkt hätte oder unsicher. Er war nur einfach nicht Hannibal Barkas.
„Hannibal!“, rief Hanno, Hannibals Neffe, dem es noch nicht aufgefallen zu sein schien.
„Du bist zurück und hast Gewaltiges mitgebracht!“, tönte der numidische Söldnerfürst Maharbal hinter Sosylos. „Damit sind wir unaufhaltsam.“
Maharbal grinste breit. Er war Hannibal treu ergeben, aber Silenos’ Zweifel redeten Maharbal nach dem Mund: Auch der Numider hatte den Sinn angezweifelt, zu einem Heiligtum am Ende der Welt zu reisen, obwohl gerade ein Krieg ausgebrochen war. Sosylos korrigierte den Gedanken: Dieser Krieg war nicht ausgebrochen.
Vulkane brachen aus.
Kriege wurden begonnen.
Irgendeines Mannes Entscheidung war der Beginn, und in diesem Fall war es die Belagerung, Verwüstung und Plünderung einer Stadt gewesen. Die Ermordung der Männer. Die Vergewaltigung der Frauen. Die Entführung der Kinder.
Das hatte einen zweiten Krieg zwischen zwei alten Neuen Städten beginnen lassen. Die Entscheidung des Rats von Qart-Hadašt, Hannibals Entscheidung und ihrer aller Tausende Einzelentscheidungen, Tropfen, die einen Fluss füllten.
Doch das hier war nicht Hannibal.
Nicht-Hannibal rief durch den Mund der Goldmaske, die ein bärtiges Gesicht zeigte und doch keines verbarg: „Dies ist die Bestie, die uns den Sieg bringt!“
Nicht-Hannibal bemühte sich nicht einmal. Es war eine helle Stimme, die aus den Lippen der Goldmaske erscholl. Es waren helle Augen, die aus den Löchern im Gold sahen und Blicke suchten wie Klingen, die sich mit ihren kreuzen würden.
Silenos war der Erste, der der Verwunderung Worte gab. Er redete immer zu viel für jemanden, der nur niederschreiben sollte. „Du bist nicht Hannibal“, stieß er hervor. „Du bist Himilke!“
Die Augen hinter der Maske verengten sich, die Sonne blinzelte hinter dem westlichsten Hügel und legte Schatten auf das Gold.
Die Bestie, der Gott der Stadt, die Kreatur Melqarts gab ein beinahe menschliches Schnaufen von sich, ein Laut des Überdrusses. Der Rüssel schnellte herum, und keiner dieser zwar kriegserfahrenen, aber von Ehrfurcht gebannten Männer reagierte schnell genug. Der gewaltige ascheweiße Rüssel packte Silenos um die Mitte, hob ihn von den Füßen und ließ ihn dann auf die beiden Stoßzähne fallen.
Silenos von Kaleakte, der sizilische Chronist, war Geschichte, als er mit zerschmettertem Rückgrat und aufgeschlitzten Weichteilen gegen den Schild eines Iberers prallte.
Hannibal nahm die goldene Maske ab. „Was sagte er?“, fragte sie – laut und deutlich.
Das war der erste Moment in Sosylos’ langem Leben, in dem die Zeit stillstand. Der Moment drohte, erst zu enden, wenn der nächste Zweifler von einem raschen Hieb der Stoßzähne zerschmettert wäre. Also schwiegen alle und gaben ihm Raum.
Hannibal hob die Brauen. „Nichts?“ Sie beendete die Endlosigkeit mit einem raschen Lächeln. „Dann ist es an der Zeit, euch zu zeigen, wer uns gegen die Römer führt.“
Maharbal atmete hinter Sosylos so scharf aus, dass der es an der Ohrmuschel spürte. Dann wagte er es: „Hast du ihn im Gepäck?“ Er hatte eine arrogante Art zu lachen, Maharbal. Doch er verstand sich auch auf das genaue Gegenteil, das Lachen, an dem andere Männer teilhaben wollten. Das Lachen, bei dem die Welt gut war und die Wolken aufrissen. Mit diesem Lachen tastete er sich zu Hannibal vor – das hatte er immer getan, auch als Hannibal noch der Ehemann dieser Frau gewesen war.
Sie erwiderte es, das Lachen, kehlig blitzte es auf wie zwischen aufgerissenen Wolken. Andere Männer fielen ein, dieses Lachen würde alles aufklären. Dann wurde es wieder finster. „Melqart hat euch Hannibal genommen und diese Bestie im Tausch gegeben. Ich war dabei.“
„Die Bestie soll uns anführen?“, brachte Qarthalo, karthagischer Kommandant der libyschen Infanterie, mit bebenden Bartspitzen hervor.
„So ist es Hannibals Wille. So ist es Melqarts Wille. Warte mit dem Urteil, bis ich die Geschichte erzählt habe, Qarthalo“, sagte sie ruhig.
Maharbal, dessen Wesen Tiere gehorchen wollten, trat auf den Elefanten zu, legte der weißen Kuh die Hand auf den Rüssel. Das Zyklopenauge des Elefanten verengte sich wie bei einem Menschen, der seine Missbilligung für sich behalten will. Der Rüssel schlängelte sich sanft um Maharbals Handgelenk und zerrte ihn dann mit einem Ruck einen Schritt nach vorn und wie zur Verbeugung nach unten.
„Lass ihn los.“ Weich wie Lammfell war die Stimme der Reiterin. Als wäre Stahl darin verborgen, gehorchte das Monstrum. Maharbal wich zurück und atmete mit geweiteten Nasenlöchern seine Erniedrigung beiseite.
„Das große Biest unserer Heimat führt uns an.“ Sie hob wie entschuldigend die Hände. „Und ich führe das Biest.“
„Himilke“, schnaubte Maharbal, keine Spur mehr von dem Lachen. „Du kannst nicht ernsthaft glauben, dein Platz wäre …“
„Du kannst Himilke einen Platz zuweisen, wie du willst. Sie ist nicht hier. Hannibal hat mir seinen Namen verliehen. Und die Bestie.“
„Aber wo ist Hannibal?“ Sosylos presste die Lippen zusammen. Warum hatte er gesprochen? Das Biest war geduldiger mit Kriegern als mit Chronisten umgesprungen und würde ihn flugs zu Silenos’ Leiche befördern, auf die Totenbahre der Geschichte.
Doch andere wiederholten seine Worte, am lautesten Mago, Hannibals jüngster Bruder, der gerade mit einem Pferd aus der Stadt gekommen war und zu begreifen versuchte, was niemand von ihnen verstand. „Wo ist mein Bruder? Wo ist Hannibal?“
Die Frau sah erst Sosylos an, dann Mago, einen trotzigen Schmerz in den Augen. „Hannibal ist tot“, flüsterte sie und sagte dann lauter: „Hannibal ist tot!“
Auch das wurde aufgegriffen, als Wispern, als Rauschen, als Sturm fegte es durch das Heer. Hannibal war tot.
Die Frau, Himilke hatte sie geheißen, schob das Kinn vor. „Aber er ist nicht für nichts gestorben. Nicht, wenn ihr mir zuhört. Ich war dabei. Mir hat er übertragen, was ihr an ihm geliebt habt. Was in ihm brannte. Seht mich an!“
Damit bot ihr der Elefant erneut sein Bein. Als seien sie zusammengewachsen wie die Kriegselefanten im Heer mit den jungen Männern, die als Treiber mit ihnen groß geworden waren, schwang sie sich auf seinen Nacken und reckte die Faust mit der goldenen Maske in die Höhe. Ein letzter Sonnenstrahl fing sich darauf, tanzte über die versammelte Menschenmenge eines Heers, das den Winter über gegoren und nun reif zum Aufbruch war.
„Ich bin Hannibal!“, schrie Hannibal, und mit einem gewaltigen Schütteln des Leibs, einem dröhnenden Schnauben des Rüssels und dem hallenden Tritt baumgleicher Beine verlieh die alabasterne Riesin ihren Worten Nachdruck.
II.
Fulvia betrachtete im Schein der Öllampen den Reigen aus Licht und Schatten auf ihren goldenen Armreifen. Sie atmete langsam ein und aus, als könnte ihr Atem, ihr bloßer Pulsschlag sie verraten. Schwach war sie geworden, und sie hatte den Schmuck in der Privatsphäre ihres Schlafgemachs übergestreift. Wie sehr sie ihn vermisste, wie gern sie sich die Haare hergerichtet hätte. Nicht nach der Schönheit selbst sehnte sich ihr Herz, sondern nach der Stärke, die ihr diese Schönheit verlieh.
Sie hatte darauf geachtet, weder von den Versklavten noch von den Freigelassenen des Haushalts, nicht einmal von einem Laren, einem Schutzgeist des Hauses, dabei beobachtet zu werden. Mit dem Schmuck fühlte sie sich wie eine Diebin, dabei war sie Herrin dieses Hauses. Die Regeln der Trauer verboten ihr das Gefühl von Halt, das ihr Schmuck auf der Haut verlieh. Sie durfte nicht schwach werden, aber der Quell ihrer Stärke blieb ihr verwehrt.
Es war hart gewesen, von einem Tag auf den anderen Ehefrau eines Patriziers und Vorsteherin seines Haushalts zu werden, dazu Mutter von drei Kindern, die nicht die ihren waren. Aber noch schwerer gewöhnte sie sich an den Gedanken, Witwe zu sein.
Kein ganzes Jahr war ihr als Numerius’ Gattin vergönnt gewesen, bevor die Parzen entschieden hatten, seinen Lebensfaden zu durchtrennen. Ein maroder Zahn hatte sich entzündet und ihn das Leben gekostet. Was für ein banales Schicksal für einen Mann aus einer solchen Familie und in der Blüte seiner Jahre! In einem Alter, in dem er eine Karriere als Senator, Konsul, Heerführer hätte einschlagen sollen, war er an der fauligen, eitrigen Wunde verreckt, die der gezogene Zahn hinterlassen hatte.
„Domina?“, erklang die Stimme der Haussklavin aus dem Atrium. „Besuch.“
„Danke, Gaia, ich komme.“ Mit der Atemlosigkeit einer Diebin streifte Fulvia eilig die Armreife ab, entledigte sich der Ohrringe und verstaute alles im goldverzierten Holzkästchen. Dann trat sie ungeschmückt aus dem dumpfen, fensterlosen Gemach, in dem sie zur Frau und ihr Mann zum Leichnam gemacht worden war. Sie löschte ihr Lämpchen – das säulengetragene Atrium um das Regenwasserbecken in der Mitte war von zahlreichen Öllampen golden beleuchtet. Es dämmerte, eine Sklavin entzündete weitere Lampen und entfernte gleichzeitig Zypressenzweige, die überall im Haus den Hauch des Todes überdeckt hatten. Sie hatten jetzt ausgedient: Der Trauerzug war vorbei, die Leiche verbrannt, die Urne außerhalb der Stadt beerdigt, und die Riten der Reinigung waren vollzogen. Als Mädchen hatte Fulvia Zypressenduft gemocht – jetzt war er verflochten mit dem Tod ihres Mannes und den Erwartungen an eine trauernde Witwe.
Wissend schienen sie die Wachsmasken der Ahnengeister, die Laren der Familie, vom Hausaltar anzustarren. Bei Numerius’ Trauerzug waren die Masken von Familienmitgliedern getragen worden, jetzt warfen sie ihr anklagende Blicke zu. Gönnten sie ihr denn nicht den kleinsten Moment der Schwäche?
Hier im Atrium war Numerius’ Leiche tagelang aufgebahrt gewesen – prunkvoll geschmückt und mit einer Münze für den Fährmann im Mund. Nun war das Atrium erleichternd leer.
Er war vermutlich ein guter Mann gewesen. Sie hatte wenig Vergleichsmöglichkeiten, doch selbst mit ihren siebzehn Jahren Lebenserfahrung hatte sie Tratsch aus anderen Ehen gehört, der sie erschaudern ließ. Numerius war älter gewesen als sie, wie üblich, aber nur etwas mehr als ein Jahrzehnt und nicht zwei oder gar drei! Sie hatte ihn nicht geliebt, aber er war ihr auch nicht zuwider gewesen – und für die Liebe, so versessen die Poeten auch danach waren, waren die wenigsten Ehen da. Numerius hatte sie nie geschlagen und ihr sogar immer wieder Geschenke gemacht. Vielleicht hätte sie ihn ja eines Tages geliebt? Vielleicht war bei ihm diese Neigung schon früher erwacht?
Er war Patrizier – gewesen –, und dass er sie als Tochter eines, wenn auch angesehenen, Plebejers geheiratet hatte, bewies doch schon seine Zuneigung. Ihre Eltern waren ganz aus dem Häuschen gewesen, sie so gut zu verheiraten – in die Familie der Cornelii Scipiones mit ihren Absicherungen in alle Richtungen: zu ihrer Klientschaft nach unten, lateral zu all den edlen alten Familien Roms und nach oben zu den beiden Konsuln, wenn sie nicht gerade selbst ein Konsulamt bekleideten wie in diesem Jahr. Fulvia hätte sich auch mit einem weniger angesehenen Mann zufriedengegeben. Als Kaufmannsgattin hätte sie nicht so viel Verantwortung gehabt: einen kleineren Haushalt mit einigen Sklaven und Freigelassenen, aber ohne ein wie aus gehende Senatoren und ohne die Klienten – Händler und Handwerker, die unter dem Schutz eines patrizischen Haushalts standen.
Vom angekündigten Besuch fand sie im Atrium keine Spur. Stattdessen wartete Gaia dort mit gefalteten Händen. „Im Triclinium“, flüsterte sie mit ihrer unmissverständlichen Sorgenfalte zwischen den Brauen. Die unangenehme Art von Besuch also.
Im Esszimmer hatte es sich ein junger Mann in Fulvias Alter auf der mittleren der drei Liegen mit einem Becher Wein bequem gemacht. Die hohe, breite Stirn verlieh ihm den Eindruck von Reife, aber der jungenhafte Blick strafte diesen Eindruck Lügen. Ein Grinsen erhellte sein Gesicht, als sie eintrat.
„Fulvia, die schönste Witwe diesseits des Rubicons!“
„Publius. Findest du solche Worte in Zeiten der Trauer nicht … unangebracht?“, rügte sie ihn.
„Irgendwann müssen wir ins Leben zurückkehren. Endlich ist die Cena Novendialis geschafft – auch wenn ich immer noch Kopfschmerzen vom Wein hab. Das kommt davon, wenn man Sklaven aus dem Barbaricum kauft, die verdünnen ihn einfach nicht genug.“
Ja, für ihn als Mann war die Trauerphase mit dem Leichenschmaus neun Tage nach der Bestattung vorbei – die reich bestickte Toga zeigte es schon. Fulvias Pflicht war noch lange nicht getan – der Pater Familias war gestorben, sie von Ehefrau zu Witwe geworden, und das geschah nicht eben in neun Tagen. Es reichte nicht aus, mit den Klagefrauen zum Klang der Flöten und Hörner zu weinen. Sich gemeinsam mit ihnen die Haare zu raufen, die Wangen zu zerkratzen. Sie musste so viel intensiver trauern als die Männer der Familie, durfte nicht aufhören, Trauer zu tragen, während Publius wieder das Forum aufsuchen konnte, um seinen geliebten Gerichtsverhandlungen zu lauschen und sich danach mit seinen Freunden in den Bädern herumzutreiben.
„Darf ich dich fragen, was du von mir als Trauernder begehrst, Publius?“
„Die ausstehenden Beträge des Bestatters und der Schauspieler beim Trauerzug … Ich will dir einfach nur mitteilen, dass ich sie beglichen habe.“
„Danke.“ Sie neigte bescheiden den Kopf, blieb aber ungastlich mitten im Raum stehen, mit verschränkten Armen. „Das war alles?“
„Es ist an der Zeit, das Erbe mit dir zu besprechen. Willst du dir nicht auch einen Becher Wein bringen lassen?“
Schlagartig stieg Übelkeit in ihr auf. Natürlich führte er etwas im Schilde: Publius Cornelius Scipio der Jüngere, der Sohn des amtierenden Konsuls und der Neffe ihres Mannes, Numerius Cornelius Scipio, war ein arroganter Ehrgeizler und zugleich ein verschlagener Hund. Sie erzwang sich einen beiläufigen Ton. „Die Lage ist eindeutig. Aulus, Cornelia, Sextus und ich sind Hauserben. Sobald er volljährig ist, wird Aulus Pater Familias.“
„Es sei denn …“ Publius räumte seinem breiten Lächeln erst einmal eine schwer aushaltbare Pause ein.
„Es sei denn was?“
„Es sei denn, ihr habt keine Manusehe geschlossen … Und: Es sei denn, es gibt ein gesiegeltes Testament. Aus der Zeit vor Numerius’ erster Eheschließung. Das seinen Lieblingsneffen begünstigt, im Sinne seiner vielversprechenden rechtlichen und militärischen Bildung.“ Der Lieblingsneffe prostete ihr zu.
„Verlass sofort mein Haus!“ Eine eloquentere Entgegnung fiel ihr nicht ein. Er musste ihr aus den Augen, jetzt! Seinem Blick hielt sie stand, und er war es, der ihn weiterwandern ließ, bevor er betont langsam die Beine von der Liege schwang.
„Ich verstehe, dass du aufgeregt bist. Die Trauer, die Verantwortung … und du kommst aus einer plebejischen Familie. Eure Gebräuche, Verantwortungen, Pflichten sind natürlich ganz andere, das muss dir alles sehr unvertraut sein. Du bist überwältigt. Darum bin ich großzügig, liebste Fulvia. Ich gebe dir und den Kindern einen Monat, um dieses Haus zu verlassen.“
Wie konnte er es wagen, der Witwe seines Onkels so wenig Respekt entgegenzubringen? Mochte er sie auch gering achten, den Toten musste er doch schätzen – als Lieblingsneffe! Die Fingernägel bohrten sich in ihre Handflächen. „Was für eine lächerliche Forderung! Damit kommst du nicht durch. Das wird dir ein Praetor schon austreiben!“
Das Recht war auf ihrer Seite – das hoffte sie zumindest, denn wie sollte sie sich mit derlei Dingen auskennen? Ja, sie hatte keine Manusehe geschlossen – was sie beim Erbe benachteiligte, ihr aber viele Freiheiten und Rechte eingeräumt hatte. Numerius war einverstanden gewesen, um die Familie durch eine neue Erbin nicht vor den Kopf zu stoßen. Er hatte gesagt, dass sie die Verbindung immer noch in eine Manusehe umwandeln könnten, wenn sie ihm nach ein paar Jahren Ehe genug vertraute, um sich ohne die Möglichkeit zur Scheidung ganz unter die Flügel seiner Patria Potestas zu begeben. Mit ihrem Vater hatte er es entschieden, und sie war einverstanden gewesen. Dass sie selbst ohne Erbe dastand, hatte ihr trotz des Trauerschleiers der letzten Tage durchaus klar vor Augen gestanden. Aber seine drei Kinder! Die waren zwar minderjährig, aber doch Hauserben, das konnte Publius ihnen nicht nehmen, es war ihr göttliches Recht!
Er leerte den Becher und stellte ihn auf ein Tischchen. „Ein Praetor?“ Er schüttelte ungläubig den Kopf. „Willst du mich verklagen? Dann nimm dir besser einen Anwalt … sonst endet es noch hässlich.“
„Raus.“
„Ein juristischer Rat noch: In Trauer wäre es unschicklich, Rechtsangelegenheiten zu vollziehen. Der seelische Schmerz macht unberechenbar. Als gute Witwe solltest du in Ruhe trauern können … und dafür hast du ja noch einen ganzen Monat. Du siehst, ich bin kein Unmensch.“
„Raus!“ Das Grinsen gehörte ihm aus dem Gesicht gekratzt! Welch Intrige gegen sie selbst und Numerius’ Kinder – die drei waren nicht ihr Blut, sondern seines!
Ohne ein weiteres Wort ließ er sie allein.
Als sie seinem Blick nicht mehr ausgesetzt war, sank sie auf eine Liege und kämpfte mit den Tränen. Hatte sie während der letzten Tage nicht genug gelitten?
Nach wenigen Monaten Ehe war sie nun Mutter dreier fremder Kinder! Und wenn sie keinen guten Anwalt fand, standen sie bald ohne Vermögen, ja, ohne Dach über dem Kopf da. Aber kampflos bekam er sie nicht klein, das war sie auch Numerius’ Kindern schuldig.
Sie zog die Nase hoch, aber ihre Stimme war fest, als sie die Sklavin rief: „Gaia, polier den Bronzespiegel und leg für morgen früh eine gute Palla und den Schmuck heraus. Die Zeit der Trauer ist vorbei. Wir ziehen in den Krieg.“
Die Antike wird auch als das „nächste Fremde“ bezeichnet – und das erfreut sich zurzeit großer Beliebtheit, wie der Erfolg von Autorinnen wie Madeline Miller oder von feministischen Neuinterpretationen wie etwa des Medusa-Mythos aufzeigt. In unserem Roman „Ich, Hannibal“ widmen wir (Judith und Christian Vogt) uns anstelle von Sagen einer feministischen Neuerzählung eines welterschütternden historischen Ereignisses der Antike: dem 2. Punischen Krieg.
Die Siege Roms gegen Karthago sind der Auslöser für Roms Dominanz über den Mittelmeerraum und später über große Teile Europas und Kleinasiens – der Startpunkt dafür, dass sich die folgende europäische Geschichte immer wieder mit Rom identifiziert; dafür also, dass Rom uns immer noch so „nah“ ist. Rom eroberte nicht nur den Mittelmeerraum, sondern auch unsere Köpfe und überstrahlt damit die Geschichte der übrigen Kulturen des Mittelmeerraums. Hannibals Marsch über die Alpen ist daher nicht nur wegen seiner militärischen Erfolge interessant. Ebenso ist eine Erzählung aus karthagischer Sicht ungewöhnlich.
Als eine von drei Erzählperspektiven haben wir die historische Figur Sosylos gewählt. Er war Hannibals Lehrer und Chronist, doch von seinen Aufzeichnungen ist nur ein einziges kurzes Fragment erhalten. Rom dominiert, was wir über Karthago wissen – doch wir sind zum Glück nicht die ersten, die sich damit auseinandersetzen, wie die andere Seite in diesem Krieg wohl ihre Geschichte geschrieben hätte. Wie bei unserem Roman „Schildmaid – Das Lied der Skaldin“, der 2022 im Piper Verlag erschien, haben wir auch bei „Ich, Hannibal“, unser Bestes gegeben, um den historischen Hintergrund so plausibel wie möglich zu gestalten.
Das wesentliche phantastische Element des Romans sind klassische Ungeheuer aus den Mythen des Mittelmeerraums. Unsere Ursprungsidee „Hannibal überschreitet die Alpen mit Monstern statt Elefanten“ entwickelte sich zu einer Auseinandersetzung mit den Monstrositäten dieses speziellen Kriegs und Kriegen im Allgemeinen.
In der Antike war Krieg allgegenwärtig: Er war ein Bewährungsraum auf dem Weg zu männlicher Macht, ein Steigbügel in die Politik. Viel wurde geschrieben über Schlachten und ihre Ausgänge, über Verluste auf beiden Seiten, und akribisch wurden die Männer gezählt, die dabei ihr Leben ließen. Was meist nicht gezählt wurde, waren die zivilen Opfer der Kriege. In den meisten Fällen unerwähnt blieben die systematischen Vergewaltigungen, Verschleppungen, Entmenschlichungen, die die Sieger für die Unterlegenen bereithielten. Krieg war immer auch ein Schauplatz geschlechtsspezifischer Gewalt und damit verbunden war und ist immer noch, dass den Unterlegenen demonstriert wird, dass über „ihre“ Frauen verfügt werden kann.
Es ist verlockend, in den Kriegen zwischen Rom und Karthago ein „Team“ zu wählen, die Perspektive des Underdogs Hannibal einzunehmen und sich vorzustellen, was gewesen wäre, wenn … Wenn er Bundesgenossen Roms auf seine Seite gezogen hätte, wenn er weiter gegen Rom siegreich gewesen wäre. Von diesem „Was wäre, wenn“, der Lust an der alternativen Geschichtsschreibung, lebt auch „Ich, Hannibal“, wenn der historische Hannibal von seiner Frau Himilke getötet und ersetzt wird – die es besser weiß, als lediglich mit sterblichen Elefanten über die Alpen zu ziehen. Wie wird es ihr ergehen mit ihrer mythisch-monströsen Kriegsmaschinerie? Und wie wird es ihr ergehen mit den anderen Monstern des Krieges, der männlichen Gewalt, die auch ihr Feldzug mit sich bringt?
Den Fokus auf Karthago statt Rom zu verschieben war nur die halbe Arbeit. In einem Roman über einen Krieg den Fokus von der männlichen Perspektive zu verschieben, war die andere Hälfte – auf Hannibal, die sich männliche Macht aneignet, auf Tamenzut, die als Bestienjägerin jenseits geschlechtlicher Rollenbilder steht, auf Fulvia, die als Römerin in einem Rechtssystem scheitert, das von und für Männer geschrieben wurde.
Übrigens ist Rom uns auch an dieser Stelle das „nächste Fremde“: Teile unseres Zivilrechts beruhen auf römischem Recht, und so ist der Erbstreit, den Fulvia im Sinne ihrer Stiefkinder in Angriff nimmt, an eine sehr ähnliche Situation in Christians jüngerer Familiengeschichte angelehnt. Wie er für Fulvia ausgeht, lässt sich im Frühjahr 2024 erlesen, in „Ich, Hannibal“.
„Eine außergewöhnliche, spannende und feministische Nacherzählung eines historischen Feldzugs, mit poetischem Stil und übernatürlichen Elementen, denn hier kämpfen nicht nur Menschen, sondern auch Monster aus antiken Mythen. Der Roman widmet sich auch tiefgehend der Frage, was Krieg mit Menschen macht, und das ist angesichts der krisengeschüttelten politischen Weltlage erschreckend aktuell.“
„Noch fantastischer als das Original!“
„Genüsslich bürsten Judith und Christian Vogt in ›Ich, Hannibal‹ die Darstellungen großer Männer in der Geschichtsschreibung gegen den Strich.“
„Ein zutiefst schönes Buch mit fragilen Momenten intensiver Nähe und Solidarität unter Frauen und queeren Menschen.“
„Das Ehepaar Vogt, Meister der modernen deutschen Phantastik, hat nun einen fulminanten Roman abgeliefert, der Spannung, Action und feinstes Worldbuilding kombiniert.“
„Mühelos schaffen die Vogts es hier, Hannibal mit einer feministischen Perspektive zu erzählen.“
„Rasant und abwechslungsreich“
„Hier wird die Leserin beziehungsweise der Leser durch die Bank gut, rasant und abwechslungsreich unterhalten.“













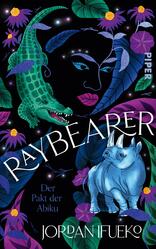















DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.