
Im Reich von Isis und Osiris
Eine Nilreise von Abu Simbel bis Alexandria
— Eine Entdeckungsreise entlang Ägyptens Lebensspender, dem sagenumwobenen Nil„Ein intensives Erlebnis, ohne die Wohnung zu verlassen.“ - Kurier Wien (A)
Im Reich von Isis und Osiris — Inhalt
Eine Entdeckungsreise entlang Ägyptens Lebensspender, dem sagenumwobenen Nil. Carmen Rohrbachs 1000 Kilometer langer Weg führt von den Tempeln von Abu Simbel über die von Palmen und Mangobäumen gesäumte Insel Elephantine bis zur Nilmündung in Alexandria.
„Geschichten, die Fluss und Sand und Steine zum Leben erwecken.“ Schweizer Fernsehen
Auf eigene Faust erkundet sie das Tal der Könige, durchstreift mit ihrem treuen Esel Aton die Sahara, besucht die großen Pyramiden und lauscht bei Nilbarsch und Malvenblütentee den Geschichten der Menschen am Ufer des längsten Flusses der Welt.
Intensiver als an Carmen Rohrbachs Seite kann man Ägypten und seinen großen Strom nicht erleben.
Leseprobe zu „Im Reich von Isis und Osiris“
Fluss des Lebens
Wie eine smaragdgrüne Schlange windet sich der Nil durch das Sandmeer. Vom Flugzeug schaue ich hinunter auf den Fluss, der von Süden nach Norden fließt, sich schlängelnd fortbewegt und mich an einen grünen Lindwurm erinnert. Ich fliege flussaufwärts von Kairo nach Assuan. Von dort will ich seinen Lauf begleiten bis zur Mündung ins Mittelmeer.
Der Nil hat Ägypten geschaffen. Ohne ihn gäbe es nicht dieses Land mit seiner Kultur und seiner langen Vergangenheit, nicht die Pyramiden und die Sphinx, nicht das hunderttorige Theben und die [...]
Fluss des Lebens
Wie eine smaragdgrüne Schlange windet sich der Nil durch das Sandmeer. Vom Flugzeug schaue ich hinunter auf den Fluss, der von Süden nach Norden fließt, sich schlängelnd fortbewegt und mich an einen grünen Lindwurm erinnert. Ich fliege flussaufwärts von Kairo nach Assuan. Von dort will ich seinen Lauf begleiten bis zur Mündung ins Mittelmeer.
Der Nil hat Ägypten geschaffen. Ohne ihn gäbe es nicht dieses Land mit seiner Kultur und seiner langen Vergangenheit, nicht die Pyramiden und die Sphinx, nicht das hunderttorige Theben und die Königsgräber im Tal des Todes, nicht Abu Simbel und die Tempel von Edna und Edfu. Ohne den Nil wäre auch unsere westliche Welt eine ganz andere, denn vieles von dem, was wir denken und glauben, hat seinen Ursprung in Ägypten. Diese Gedanken gehen mir durch den Kopf, während ich die Stirn gegen das Fenster drücke und meinen Blick nicht abwenden kann von dem grünen Band dort unten. Schon seit einer Stunde fliegen wir über den Fluss. Die Sicht ist klar, durch keine Wolke getrübt.
Der Nil ist der längste Strom der Erde, vom Quellgebiet in Zentralafrika bis zur Mündung ins Mittelmeer legt er 6670 Kilometer zurück. Weil die Quelle so weit entfernt ist, wussten die Bewohner des fruchtbaren Niltals lange nicht, wo das Wasser entspringt, das alljährlich über die Ufer trat und die Felder überflutete. Ihnen war nur bewusst, dass sie dem Wasser und dem nährstoffreichen Schlamm ihr Leben verdanken. Und so beteten sie damals den Nil an, in ihrer Vorstellung ein Gott, den sie Hapi nannten. Sie verehrten und fürchteten ihn, denn wenn die Überschwemmung zu gewaltig ausfiel, zerstörten gurgelnde Wassermassen ihre Häuser, rissen Menschen und Tiere mit sich. Manchmal aber war die Flut zu gering, um den segensreichen Schlamm bis zu den Feldern zu bringen, nichts konnte gedeihen und Hungersnöte waren die Folge.
Jahrtausendelang blieb die Quelle des Nil ein Geheimnis. Erst kurz vor Beginn des 20. Jahrhunderts gelang es, das Rätsel zu lösen. Zahlreiche Forscher, Entdecker, Abenteurer hatten sich in der Vergangenheit auf den Weg ins Innere Afrikas gemacht, und fast alle verloren ihr Leben bei der gefährlichen Suche. Spannende Berichte ranken sich um diese Entdeckungsgeschichte.
Der Nil machte es ihnen schwer, denn er hat zwei Quellflüsse: den Blauen Nil und den Weißen Nil, dessen Quelle besonders schwer zu finden war. Der Blaue und der Weiße Nil fließen bei Khartum, der heutigen Hauptstadt des Sudan, zusammen. Der Blaue Nil ist der kürzere von beiden, bringt aber mehr als zwei Drittel des Wassers. Er ist dunkel, weil er viel erdigen Schlamm mit sich führt. Das Wasser des Weißen Nil dagegen ist sehr hell. Seine Quelle liegt tief in Afrika.
Den Ursprung des Blauen Nil entdeckte der spanische Missionar und Jesuit in portugiesischen Diensten Pedro Paez im Jahr 1618. Zusammen mit dem Kaiser von Äthiopien besuchte er den in 1830 Meter Höhe gelegenen Tanisee, aus dem der Blaue Nil entspringt. Beeindruckt soll der Missionar gesagt haben: „Es freut mich sehr, etwas erblicken zu dürfen, was der Große Alexander und Julius Cäsar vergeblich zu sehen wünschten.“ Der Kaiser war gerührt von der Begeisterung des Priesters und erlaubte ihm, dort eine Kirche zu errichten.
Der Bericht von Pedro Paez geriet in Vergessenheit, und so konnte der Schotte James Bruce of Kinnaird 152 Jahre später glauben, er habe die Quelle des Blauen Nil als Erster ausfindig gemacht. James Bruce hatte den 1370 Kilometer langen Fluss erkundet, der das Äthiopische Hochland durchquert und dann weiter in den Sudan fließt. Wild rauscht er in tiefen Schluchten dahin und stürzt südlich von Bahir Dar als zweitgrößter Wasserfall Afrikas in die Tiefe.
Der Ursprung des Weißen Nil dagegen blieb lange im Ungewissen. Schon in der Antike hatte man über die Herkunft des Nil gerätselt. Herodot, dem griechischen Historiker und Geografen, der im 5. Jahrhundert v. Chr. lebte, verdanken wir einen Großteil unseres Wissens über die antike Welt. Er verließ sich nicht nur auf Überlieferungen und schrieb nieder, was erzählt wurde; er fuhr höchstpersönlich in einem der landesüblichen Segelboote, einer Feluke, auf dem Nil bis zu den Stromschnellen des 1. Katarakts. Für Herodot war das wilde Wasser mit seinem donnernden Getöse, den schaurigen Wasserwirbeln und der stürzenden Flut der Eingang zur Hölle. Der Blick in diesen tosenden Schlund jagte ihm, wie er schrieb, Schauer des Schreckens über den Rücken.
Insgesamt sechs Katarakte zwischen Omdurman und Assuan machten eine reguläre Schifffahrt auf dieser Strecke unmöglich. Besonders bei Niedrigwasser waren diese natürlichen Barrieren aus Granit schwer passierbar. Wer es dennoch riskierte, drohte an den Felsen zu zerschellen. Erst ab dem letzten Katarakt war der Warentransport mit Schiffen auf dem Nil möglich. Güter aus dem Inneren Afrikas wurden mit Karawanen zu diesem Umschlagplatz gebracht. Dort liegt heute Assuan, das Ziel meines Fluges.
Die Stromschnellen gibt es nicht mehr, sie sind im Nasser-Stausee versunken.
Weiter als bis zum obersten Katarakt bei Omdurman drang Herodot nicht vor, aber er erfuhr von Einheimischen, dass der Nil aus schmelzendem Schnee herausfließe. Der Grieche hielt diese Auskunft für völligen Unsinn. Eis und Schnee mitten in Afrika unter der heißen Sonne des Äquators, daran konnte er nicht glauben. Sechs Jahrhunderte später schrieb der Gelehrte Claudius Ptolemäus, der Nil entspringe in den Mondbergen Afrikas. Die Berge seien so hoch, dass Schnee sie für immer und ewig bedecke, behauptete er, ohne je dort gewesen zu sein. Er gab nur wieder, was er von Kaufleuten gehört hatte, die sich bei ihren Handelsfahrten weit in unbekannte Gebiete vorgewagt und die Schneeberge am Horizont erspäht hatten, hochragend bis in die Wolken.
Kaiser Nero wollte das Rätsel unbedingt lösen und schickte zwei Hundertschaften des römischen Heeres nach Süden. Sie sollten bis zum Ursprung des Nil fahren. Die Soldaten kamen nicht weit, unrettbar blieben sie in den Nilsümpfen des heutigen Sudan stecken. Viele von ihnen starben an Malaria und Erschöpfung, nur wenige überlebten und kehrten zurück. Um nicht Neros Zorn auf sich zu ziehen, erzählten sie, der Nil entspringe in der Hölle, und Teufel bewachen seine Quelle. Der Ursprung des Nil blieb weiterhin unentdeckt.
Die Neuzeit brach an mit ihren technischen Möglichkeiten, dem Glauben an den Fortschritt und die Allmacht der Maschinen. Der Mensch begann, sich als Beherrscher der Erde zu fühlen, aber noch immer wusste man nicht, wo die Quelle des Weißen Nil war. Unter den Quellensuchern war auch eine Frau, Florence Baker. Zusammen mit ihrem Mann Samuel unternahm sie in den Jahren 1861 bis 1873 mehrere Afrikareisen. Sie war die erste und im 19. Jahrhundert einzige Frau, die an Expeditionen zu den Nilquellen teilnahm. Ihr Schicksal ist ungewöhnlich und an Dramatik kaum zu überbieten.
Sie kam 1841 als Tochter eines deutsch-ungarischen Adligen im Gebiet des heutigen Rumänien zur Welt und hieß als Kind Maria. Ihre Eltern wurden während der Revolution 1848 auf ihrem Familiengut in Siebenbürgen ermordet, nur Maria überlebte. Von wem sie gerettet wurde, wusste die damals knapp Siebenjährige nicht. Die Waise kam in den Harem eines osmanischen Herrschers und sollte mit kaum vierzehn Jahren als Sklavin verkauft werden. Bei der öffentlichen Versteigerung in Viddin, dem heutigen Bulgarien, war zufällig der Engländer Samuel Baker anwesend. Er verliebte sich in das außergewöhnlich schöne Mädchen, und da er nicht genügend Geld besaß um mitzubieten, entführte er das Haremskind kurzerhand.
Mit Florence, wie sich Maria nun nannte, war Samuel anschließend jahrelang auf Expeditionsreisen in Afrika unterwegs. Weil seine Begleiterin in riskanten Situationen kühlen Kopf bewahrte, rettete sie ihm mehrmals das Leben. Probleme mit den oft feindlich gesinnten Einheimischen löste Florence mit Klugheit und Einfühlungsvermögen. Das Forscherpaar gehört zu den wenigen Entdeckern, welche die unmenschlichen Strapazen und alle Gefahren ihrer Nilexpeditionen überlebten. Die Nilquelle fanden sie nicht, erforschten aber den Albertsee und erkundeten unbekannte Gebiete am Oberlauf des Weißen Nil.
Vor der Rückkehr nach England heirateten sie. Dennoch wurde Florence von der sittenstrengen englischen Gesellschaft nicht akzeptiert, denn immerhin war sie ohne Trauschein mit ihrem Mann durch Afrika gereist. Samuel wurde für seine Erfolge bei der Erforschung des Nil geehrt und gefeiert, sogar von der Queen geadelt. Die Leistungen seiner Frau Florence blieben unerwähnt.
Schließlich sandte die Royal Geographic Society, die Königlich Geographische Gesellschaft, den schottischen Arzt und Missionar David Livingstone nach Afrika. Jahrelang blieb er verschollen, bis der Herausgeber vom New York Herald seinen fähigsten Reporter, Henry Morton Stanley, auf Livingstones Spuren setzte. Stanley fand den Vermissten, von Tropenkrankheit geschwächt, in einer Hütte am Ufer des Tanganjikasees. Es war am 10. November 1871, als sich jene legendäre Szene abspielte, die wegen ihrer Skurrilität bis heute fasziniert: Zwei Menschen weißer Hautfarbe begegnen sich in Schwarzafrika und haben nichts Besseres zu tun, als steife englische Etiquette zu wahren. „Doktor Livingstone, nehme ich an?“, begrüßte der Reporter den schon tot geglaubten Forscher, der die Quelle in der falschen Gegend vermutete, zuerst am Tanganjika-, dann am Bangweolosee. Zwei Jahre später, im Mai 1873, starb Livingstone an der Ruhr am Südufer des Bangweolosees im heutigen Sambia.
Im Jahr 1892 entdeckten die Österreicher Oscar Baumann und Oskar Lenz einen in den Victoriasee mündenden Fluss namens Kagera. Sie glaubten, er müsse der Quellfluss des Nil sein. Sechs Jahre später bestätigte der deutsche Arzt und Afrikaforscher Richard Kandt die Vermutung der Österreicher, übersah dabei aber, dass der Kagera zwei Zuflüsse hat. Der längere ist der Luvironza und entspringt in Burundi, er gilt heute als der eigentliche Quellfluss. Aber die schneebedeckten Berge waren immer noch unentdeckt.
Im Jahr 1906 schließlich rüstete der italienische Prinz Ludwig Amadeus von Savoyen eine Expedition ins heutige Grenzgebiet zwischen Uganda und Burundi aus. Sein Ziel war das Ruwenzorigebirge, jene Mondberge, die schon in der Antike als Quellgebiet des Nil bezeichnet worden waren. Der Prinz bestieg den höchsten Gipfel und war der erste Mensch, der wirklich an der Quelle stand, denn die vielen Bäche, die aus dem Schnee der Ruwenzoriberge herausfließen, vereinigen sich zum Luvironza, der später zum Nil wird.
Bald werden wir landen, seit über zwei Stunden sind wir schon in der Luft. Die smaragdgrüne Schlange ist schmal geworden, im Westen reicht die Wüste fast bis an den Strom heran. Nur dort, wo kleine Kanäle das Land bewässern, ist es grün, da blüht Leben. Mich überrascht, wie scharf die Grenze zwischen Ödnis und Fruchtbarkeit sich abzeichnet. Die Wüste wirkt übermächtig, als könnte sie jederzeit den schmalen grünen Streifen verschlingen. Östlich des Flusses wird sie Arabische, westlich Libysche Wüste genannt.
Vom Flugzeug aus sind keine Bewohner zu sehen, wahrscheinlich fliegen wir zu hoch. Auch Ortschaften gibt es kaum, selten kann ich einige Häuser mit flachen Dächern und unter hohen Bäumen ein paar Hütten ausmachen. Mal erkenne ich die Kronen von Dattelpalmen, dann wieder sind es Zuckerrohr- und Hirsefelder oder Bananenstauden.
Als ich nach fast drei Stunden in Assuan aus dem Flugzeug steige, habe ich auf einer Strecke von ungefähr tausend Kilometern Ägypten von Norden nach Süden überflogen. Warme, trockene Luft empfängt mich. Ein Taxi bringt mich zum Old Cataract Hotel. Wenig später sitze ich auf der Terrasse des berühmten Hotels, einem historischen Ort, denn hier schrieb Agatha Christie ihren weltbekannten KriminalromanTod auf dem Nil, und auch für den nach ihrem Buch gedrehten Film bot das Hotel die passende Kulisse. Es ist ein prächtiges Gebäude, seine Fassade schimmert rosarot, innen ist es im maurischen Stil gestaltet mit hohen Korridoren, Säulen und Bögen, kostbaren Kronleuchtern und Verzierungen aus Stuck. Einzigartig ist auch seine Lage auf einem Felssporn hoch über dem Nil.
Von der Hotelterrasse blicke ich hinunter auf einen üppigen Garten. Mango- und Zitrusbäume spenden Schatten, Hibiskus und Oleander blühen in leuchtenden Farben – ein Paradies, das sein Gedeihen dem ständigen Sprühen der Sprengleranlage verdankt. Die gepflegte Gartenanlage fällt sanft hinab zum Nilufer, wo Kapitäne in ihren Feluken auf Touristen warten, um sie für einen Ausflug zu gewinnen. Weiter schweift mein Blick über den Fluss zum westlichen, unbewohnten Ufer. Dort beginnt die Wüste, und Sandberge türmen sich auf.
Das Old Cataract Hotel verströmt das nostalgische Flair vergangener Tage. Die Teppiche sehen kostbar aus, Lampen, Stühle und Tische sind dem historischen altenglischen Mobiliar täuschend echt nachgebildet. Oder sollte tatsächlich alles noch aus dem späten 19. Jahrhundert stammen, als das Hotel gebaut wurde? Die Kellner sind in die Livree der Kolonialzeit gekleidet. Selbst die Kinder, die den Gästen die Schuhe putzen, tragen ein osmanisches Prinzengewand mit Pluderhosen, goldbesticktem Gürtel und Fez auf dem Kopf.
Ich bestelle Malvenblütentee, karkadeh. Dunkelrot schimmert das Getränk im Glas, ein neuartiges Geschmackserlebnis. Anders als der bei uns übliche Hibiskustee ist karkadeh zugleich süß und säuerlich und prickelt auf der Zunge.
Während ich auf den mir empfohlenen Nilbarsch mit Kreuzkümmel, samak bi’l kammun, warte, versuche ich mir ein Bild von den Gästen zu machen, die sich während der größten Mittagshitze auf der schattigen und luftigen Terrasse aufhalten. In der Mehrzahl sind es ältere, unauffällig sportlich gekleidete Ehepaare, den Gesprächsfetzen nach zu urteilen, die an mein Ohr dringen, vor allem englischsprachige Reisende.
Meine Gedanken schweifen immer wieder ab, zurück in eine Vergangenheit, die ich nicht selbst erlebt habe, die ich mir aber, angeregt durch Bücher, Filme und Fotos, lebhaft vorstellen kann. Vornehm gekleidete Damen mit bis zum Boden wallenden weißen Kleidern und breitkrempigen Hüten, einen Sonnenschirm graziös in der Hand, und ihre männlichen Begleiter, zünftig in Tropenanzügen und mit Tropenhüten, posieren vor Tempeln, reiten auf Kamelen oder segeln auf dem Nil, dezent im Hintergrund die einheimischen Diener. Im Europa des 19. Jahrhunderts war es fast schon eine Selbstverständlichkeit unter wohlhabenden, bildungsbeflissenen Bürgern und auch Künstlern, dem nasskalten Winter zu entfliehen, sich auf einer Nilreise zu amüsieren, die Pyramiden zu bestaunen und die Königsgräber bei Luxor zu besuchen.
Nachdem ich den köstlichen Nilbarsch gegessen habe, schlendere ich die Uferpromenade, die Corniche, entlang, die den Ort Assuan gegen den Nil abgrenzt. Zahlreiche Taxis und Pferdekutschen kurven auf der Suche nach Fahrgästen umher. Die zweispurige Fahrbahn ist in der Mitte durch einen Grünstreifen geteilt, auf dem Büsche und Bäume wachsen. Auf der Nilseite wird ein breiter Fußweg von einer hüfthohen Mauer vor dem tiefer liegenden Ufer geschützt. Restaurants, Hotels und Geschäfte reihen sich aneinander. Dahinter liegt die eigentliche Ortschaft mit meist zweistöckigen Häusern, kleinen, ebenerdigen Geschäften und einem Markt, dem Suq, auf dem vor allem Souvenirs für Touristen angeboten werden, aber auch Obst, Gemüse und Backwaren.
Noch immer ist Assuan eine beschauliche und überschaubare Stadt, und das, obwohl die Einwohnerzahl in den letzten Jahrzehnten sprunghaft gestiegen ist. Sie soll bei etwa 400000 liegen, je nachdem wie weit man die Hütten im Umland miteinberechnet. Menschen mit dunkler Hautfarbe überwiegen, denn hier war von alters her nubisches Siedlungsgebiet, das Land Kusch, wie es früher genannt wurde. Die Nubier, nicht zu verwechseln mit den schlanken und hochgewachsenen Nuba aus dem Sudan, sind muskulös und kräftig gebaut, meist untersetzt, mit breiten Gesichtern, vollen Lippen und kurzem Kraushaar. Doch im Laufe der Jahrtausende entstand eine Mischbevölkerung mit den eher hellhäutigen Ägyptern, die fast europäisch wirken.
Ich verlasse den Uferweg und folge einem Sträßchen in die Altstadt, spaziere über den Suq mit seinen mannigfaltigen Verkaufsbuden. Anders als sonst auf orientalischen Märkten werde ich nicht zum Kaufen gedrängt und genieße so das ungestörte Schauen entlang der Marktstände mit ihren leuchtenden Farben und exotischen Gerüchen. Gewürze, fein gemahlen und aufgehäuft zu ebenmäßigen Pyramiden, verströmen einen betörenden Duft. Es riecht weihnachtlich nach Zimt, Ingwer, Kardamom.
Vom Suq gehe ich weiter durch die engen Gassen und halte Ausschau nach einer preisgünstigen Unterkunft, denn ich möchte mir nur eine einzige Nacht in dem luxuriösen Old Cataract Hotel gönnen, um sein historisches Flair zu genießen. Danach will ich noch ein paar Tage mehr in Assuan bleiben, den Staudamm besuchen, auch das Simeon-Kloster und die Steinbrüche, wo der Granit für die Tempel gebrochen wurde.
Für die alten Ägypter hatte Assuan, das einst Syene hieß, zugleich symbolische und wirtschaftliche Bedeutung, denn hier endete das Reich der Pharaonen. Alle Schätze des schwarzen Kontinents wurden auf dem Landweg mit Karawanen an die ägyptische Grenze gebracht und auf Schiffe verladen, wodurch der Markt- und Handelsort große Bedeutung erlangte. Der Name Assuan geht auf das koptische Wortsuan für Handel zurück; zusammen mit dem arabischen Artikel wurde daraus As-Suan.
Kaum merklich kühlt die Luft ab, ein leichter Wind streift über mich hinweg. Ich sitze in einem Terrassenrestaurant an der Corniche und blicke auf den Fluss unter mir, wo Felukensegel weiß in der Dämmerung leuchten. Dann schweift mein Blick weiter zum gegenüberliegenden unbesiedelten Ufer. Die Sonne nähert sich der goldgelb leuchtenden Wüste und versinkt im Sandmeer, das für wenige Sekunden altrosa schimmert. Dort, auf einem der Sandberge, hebt sich im Abendlicht das Aga-Khan-Mausoleum hell gegen den dunklen Himmel ab. Mein erster Tag am Nil neigt sich dem Ende zu. Die Nacht senkt sich über die Erde. Die Dunkelheit saugt die Farben des Tages auf. Musik klingt aus den Lokalen an der Uferstraße, und die Lichter der Laternen und Terrassenlampen spiegeln sich im jetzt fast schwarzen, leise dahinfließenden Wasser des Nil. Morgen wird Bakri mich abholen und zu seiner Familie auf die Insel Elephantine bringen. Ich bin voller Erwartung, freue mich auf neue Erfahrungen und Begegnungen mit den Inselbewohnern, die in zwei kleinen Dörfern leben und nubischer Herkunft sind.
Die Elefanteninsel
Mitten im Strom liegt die Insel Elephantine. An ihrer Südspitze ragen runde Granitquader aus der Erde, gerade so, als würde eine Herde Elefanten die Insel auf ihren Rücken durch den Fluss tragen. Vielleicht rührt der Name von diesen elefantenähnlichen Steinen her, wahrscheinlicher aber ist, dass zur Zeit der Pharaonen mit Elfenbein gehandelt wurde und Elefantenkarawanen Gold und Edelsteine hierher transportierten. Wohl aus diesem Grund hieß die Insel in der Sprache Altägyptens Yeba, was Elefant bedeutet.
Bakri wartet mit seinem Ruderboot unten am Flussufer auf mich. Ich lernte ihn gestern Nachmittag auf dem Suq kennen, wo er einen kleinen Stoffladen betreibt. Als ich ein grünes Kopftuch bei ihm kaufte, kamen wir ins Gespräch. Ich erzählte ihm von meiner Suche nach einer preiswerten Unterkunft, da schlug er mir vor, mich zu seiner Familie auf Elephantine zu bringen. Eine wunderbare Gelegenheit, mehr über das Leben der Menschen in Ägypten zu erfahren.
Die Strömung ist erstaunlich stark. Bakri muss sich kräftig in die Riemen stemmen. Wenn man den Nil vom Ufer aus betrachtet, scheint er gemächlich zu fließen; mitten im Fluss spürt man erst, wie stark die Strömung ist. Bakri rudert an der Südspitze der Insel vorbei, wo schon vor 5000 Jahren eine Siedlung mit Namen Sunt lag. Sie war ein wichtiges Zentrum des Handels und galt als Tor nach Afrika. Heute heißt die Ausgrabungsstätte dieser historischen Stätte Elephantine, wie die Insel selbst, und beschäftigt seit Jahrzehnten die Archäologen. Vom Boot aus erkenne ich Mauern, Säulen und Tempel.
Am Westufer der Insel legen wir an. Palmen und Mangobäume bilden ein grünes Laubdach, am Boden wuchern Gräser und Stauden. Eine fruchtbare Insel, denn überall plätschert Wasser in Rinnen und künstlichen Bächen, die der Nil speist. Ein schmaler, lehmglatter Weg führt zu einem Haus, das romantisch von hohen Bäumen beschattet wird. Es steht allein für sich, etwa sechzig Meter vom Dorf entfernt. Bakri stellt mich seinem Vater, der Mutter, seinem jüngeren Bruder und den zwei Schwestern vor, die gerade dabei sind, Betten und Kochtöpfe aus dem Haus zu tragen.
„Was geschieht denn hier?“, frage ich überrascht.
„Meine Eltern ziehen vorübergehend in das Haus meines Schwagers“, erklärt mir Bakri.
„Warum denn das?“
„Sie wollen nicht stören.“
„Aber Bakri, ich will doch niemanden vertreiben! Ich hätte gern eine Weile mit ihnen zusammengewohnt und ihr Leben geteilt.“
„Das können Sie doch auch so. Meine Eltern freuen sich, wenn Sie zu Besuch kommen, so oft und so lange Sie wollen.“
Ich bin ein wenig enttäuscht. So werde ich nicht wirklich an ihrem Alltag teilnehmen können, werde nicht als Mitglied der Familie, sondern als Gast behandelt werden und bleibe eine Fremde. Nun gut, ich will versuchen, das Beste aus der Situation zu machen, und irgendwie verstehe ich auch ihre Entscheidung. Als Grund haben sie angegeben, mich nicht stören zu wollen, aber ich denke, in Wirklichkeit wollen sie durch mich nicht gestört werden, wollen sich so wie immer verhalten und sich nicht von mir beobachtet fühlen. Als Reisende ist dies für mich eine gänzlich neue Erfahrung. In der Mongolei, im Jemen oder bei den Indianern in Ecuador, überall wurde ich ganz selbstverständlich aufgenommen und durfte mit meinen Gastgebern leben, ob in der Jurte, im Beduinenzelt oder in einer Hütte. Vielleicht sind es die Nachwirkungen aus der Kolonialzeit, die eine Kluft zwischen Einheimischen und Besuchern gerissen haben? Das erste Mal erlebe ich, als Fremde wirklich fremd zu sein.
Beim Eintreten entdecke ich über der Haustür einen Talisman, einen winzigen Stoffbeutel in Herzform, der die bösen Geister am Eindringen hindern soll. Später, als ich allein bin, schaue ich hinein und ziehe einen Streifen Papier heraus, auf dem in Arabisch eine Sure aus dem Koran steht. Außerdem finde ich darin eine blaue Glaskugel mit einem schwarzen Punkt in der Mitte, einer Pupille ähnlich. Das blaue Glasauge ist ein magischer Abwehrzauber. Es soll den bösen Blick ablenken.
Das Haus ist einstöckig. Unten befinden sich die Küche und ein Wohnzimmer, auf einer Treppe gelange ich nach oben in die Schlafräume. Von dort führt eine Stiege hinauf aufs Flachdach mit Blick zum Nil. Die Toilette ist draußen in einem Häuschen, ein Bad gibt es nicht, nur ein winziges Waschbecken in der Küche.
Nachdem ich mit der Besichtigung fertig bin, blicke ich in erwartungsvolle Gesichter. Als ich sage, dass ich das Haus mag, fällt die Anspannung von ihnen ab, und meine Gastgeber schenken mir ein offenes Lächeln.
„Was kostet es, wenn ich eine Woche bleibe?“
Die Mienen verschließen sich wieder. Keiner sagt ein Wort. Endlich wendet sich Bakri an mich: „Bezahlen können Sie, wenn Sie wieder ausziehen. Geben Sie dann einfach so viel, wie es Ihnen wert ist.“
Meine Vermieter verabschieden sich, und ich bleibe allein zurück. Bevor ich noch mit Auspacken fertig bin, erscheint Bakri schon wieder – und bringt mir Fische aus dem Nil, ganz frisch, heute Morgen gefangen. Es sind Barsche, die hier brodi heißen. Eine Bezahlung will er auf gar keinen Fall. „Wir sind doch Freunde!“ O je, denke ich, das wird alles in allem eine teure Rechnung werden! Freundschaft verpflichtet, großzügig zu sein.
Die Küche ist der kleinste Raum im ganzen Haus, eng wie eine Abstellkammer, noch dazu ohne Fenster. Eine nackte Glühbirne, mit einem dünnen Draht an der Decke befestigt, spendet kümmerliches Licht. Das Feuer unter dem Herd flammt auf, nachdem ich den Hebel an der Gasflasche geöffnet habe. Einen alten Tiegel und ein paar zerbeulte Töpfe finde ich im Backrohr. Die Familie hat fast alle ihre Kochutensilien, das Geschirr und Besteck mitgenommen. Ich werde später fragen, ob sie mir einiges borgen können, oder mir das Nötige auf dem Suq von Assuan kaufen, aber dafür muss ich erst wieder über den Nil setzen. In der Küche befinden sich allerdings auch keine Regale, keine Ablage, keine Arbeitsfläche. Wie schaffen es die nubischen Hausfrauen, hier zu kochen, noch dazu für eine vielköpfige Familie? Aber eigentlich müsste ich mich nicht wundern; im Jemen habe ich diese kleinen Kammern bereits kennengelernt, die der nubischen Küche täuschend ähnlich sahen. Dort hockten Frauen beim Zubereiten auf dem Boden, und ich kauerte mich zu ihnen und half beim Putzen und Schnippeln des Gemüses. Am Ende wurden mit einem Eimer Wasser oder einem Schlauch die Abfälle weggespült, und alles war wieder sauber.
Ich zögere nicht, es mir etwas bequemer zu machen, rücke einen Tisch in den Gang vor die Küchentür, auf dem ich arbeiten kann. Beim Ausnehmen, Putzen und Entschuppen der Fische sticht mich eine starre Rückenflosse schmerzhaft in den Daumen, tief ins Nagelbett hinein. Ich habe großes Glück, dass sich die Verletzung später nicht entzündet. Als ich die Fische in der Pfanne brate und mir ihr köstlicher Duft in die Nase steigt, ist der Schmerz vergessen. Zum Fisch esse ich Möhrengemüse, Kartoffeln und Gurkensalat, Beilagen, mit denen ich mich auf dem Suq in Assuan reichlich eingedeckt habe.
Ich kann es kaum erwarten, die Umgebung zu erkunden. Mein Haus liegt ungefähr in der Mitte der lang gestreckten Insel. Sie soll nur drei Kilometer messen, was ich mir schwer vorstellen kann; schließlich befinden sich zwei Dörfer, die Ausgrabungsstätte, Gärten und Felder auf ihr. Ein von Palmen, Mango- und Zitronenbäumen beschatteter Fußweg schlängelt sich nach Norden, wo der Bewuchs allmählich niedriger wird und sich ein Hochhaus erhebt, das Oberio-Hotel. Präsident Hosni Mubarak war angeblich entsetzt über dieses moderne Gebäude, das nicht auf die romantische Garteninsel passt, und soll weitere Hotelbauten auf Elephantine untersagt haben.
Begleitet von plätschernden Wasserläufen, gehe ich zurück in Richtung Süden und besichtige die beiden Dörfer. Wie für Nubierdörfer typisch, sind die Häuser aus Lehm gebaut. Sie haben flache Dächer und ein, höchstens zwei Stockwerke. Einige der ockergelb oder blau gestrichenen Hausmauern zieren selbst gemalte Bilder, die religiöse Themen, aber auch Menschen bei der Arbeit oder Kinder beim Lernen zeigen. Fenster- und Türumrahmungen schmücken farbige Ornamente. Keine Abfälle, keine Plastiktüten, kein Fetzchen Papier liegen herum. Täglich werden die Gassen mit Wasser besprengt und gekehrt, sodass der Lehmboden glatt und glänzend geworden ist wie poliertes Parkett.
Frauen, von Kopf bis Fuß in schwarze Tücher gehüllt, hocken vor ihren Haustüren auf dem Boden oder auf kleinen Holzschemeln und blicken mir freundlich entgegen. Offensichtlich sind sie daran gewöhnt, dass Touristen hin und wieder durch ihre Dörfer spazieren.


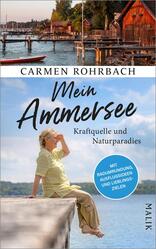

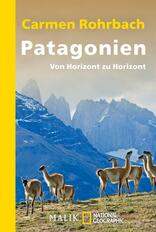




DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.