
In guten und in bösen Tagen - eBook-Ausgabe
Meine Ehe zwischen Liebe und Gewalt
„Ein Buch, dass die Frage nach dem Warum sehr offen und anschaulich beantwortet.“ - Ruhr Nachrichten
In guten und in bösen Tagen — Inhalt
Wie geht man damit um, wenn die Gewalt langsam in eine Beziehung kriecht und sie dann mit ganzer Macht beherrscht? Warum bleiben Frauen allzu oft bei ihren gewalttätigen Männern? Wie kommt es zu der Spirale aus Liebe und Gewalt – und wie kann man sie durchbrechen?
Kelly Sundberg wurde selbst von ihrem Mann Caleb geschlagen; trotzdem liebte sie ihn aufrichtig und schwieg viel zu lange über ihr Leid. Nun will sie mit ihrer Geschichte Antworten auf diese Fragen geben. Schonungslos ehrlich, berührend und aufrüttelnd berichtet sie von ihrer Ehe zwischen Glück und Angst, zwischen Liebe und Gewalt, erzählt, was der Entschluss, Caleb zu verlassen, auslöste, und zeigt, dass die Problematik von häuslicher Gewalt viel komplexer ist, als wir ahnen.
Leseprobe zu „In guten und in bösen Tagen“
Prolog
In einer Stadt auf einem Hügel, in einem Staat voll abgesägter Berge, in dem sich matschige Straßen an verdreckten Flüssen entlangschlängelten, metallische Ablagerungen im Wasser glänzten wie stählerne Regenbogen und das gedämpfte Sonnenlicht durch schattige Bäume fiel, lebte einmal ein Archivar. Sein Job war das Erinnern.
Mein Job war das Vergessen.
Auf seinem Handy hatte mein Mann Caleb, der Archivar, eine Sammlung von Selbstporträts. Jedes sah gleich aus, nur seine Kleidung, seine Gesichtsbehaarung oder der Hintergrund wechselten. Auf einem Bild [...]
Prolog
In einer Stadt auf einem Hügel, in einem Staat voll abgesägter Berge, in dem sich matschige Straßen an verdreckten Flüssen entlangschlängelten, metallische Ablagerungen im Wasser glänzten wie stählerne Regenbogen und das gedämpfte Sonnenlicht durch schattige Bäume fiel, lebte einmal ein Archivar. Sein Job war das Erinnern.
Mein Job war das Vergessen.
Auf seinem Handy hatte mein Mann Caleb, der Archivar, eine Sammlung von Selbstporträts. Jedes sah gleich aus, nur seine Kleidung, seine Gesichtsbehaarung oder der Hintergrund wechselten. Auf einem Bild stand er im karierten Hemd vor unserem Bücherregal, seine unnachgiebigen Augen blickten fest in die Kamera, und sein langer, aber säuberlich gestutzter Bart verdeckte seine finstere Miene. Auf einem anderen Bild saß er auf dem Sofa vor dem Wohnzimmerfenster. Er trug ein blaues Kapuzenshirt, und sein Gesicht war glatt rasiert, aber der Blick war der gleiche. Unnachgiebig. Undurchdringlich.
Abends kuschelten wir uns auf dem Sofa aneinander, ich legte ihm den Kopf auf die Schulter, und wir zogen uns eine Decke über die Beine. Er scrollte Dutzende von diesen Fotos
durch. „Wozu machst du die alle?“, fragte ich ihn.
„Ich stelle mir vor, das wird mein Autorenfoto“, sagte er. „Da möchte ich ernst aussehen.“
Ich fand sein Verhalten seltsam, aber er hatte oft solche unerklärlichen Anwandlungen. Ich lachte, griff mir das Telefon und scrollte die Bilder alle durch. „Sehen eher aus wie Verbrecherfotos“, meinte ich und warf ihm das Handy wieder auf den Schoß.
Später erzählte er mir die Wahrheit. Er machte die Fotos als Dokumentation. Er machte sie, um sein Elend zu dokumentieren. Und seine Schande.
In Morgantown, der College-Stadt in West Virginia, in der wir lebten, gab es ein zwölfstöckiges Studentenwohnheim namens „Summit Hall“: ein steriler Kasten aus Metall und Fenstern. In diesem Kasten lebten achtzehn- bis zweiundzwanzigjährige Kids. In aufeinandergestapelten Zimmern nahmen sie Drogen, verloren ihre Jungfräulichkeit, lernten für ihre Prüfungen, weinten aus Heimweh nach ihren Müttern, schliefen an den langen Tagen und feierten die kurzen Nächte durch. Es war ein beherrschtes Chaos aus Hochstimmung, Experimentierfreudigkeit, Freude und Verlust.
Unter all diesen Zimmern, im ersten Stock, lag ein Apartment – ein schöner Käfig – mit polierten Parkettböden, Chromhängelampen und Ledermöbeln. Das Apartment war für eine Familie gedacht, die „auf dem Gelände wohnenden Fakultätsbetreuer“, oder, wie ich uns gerne nannte, „Studi-Mom und Dad“. In diesem Apartment wohnte ich seit vier Monaten mit Caleb, der seit acht Jahren mein Mann war, und unserem siebenjährigen Sohn, Reed. In diesem Apartment schliefen mein Mann und ich miteinander, ganz leise, damit uns die Mädchen im Stockwerk über uns nicht hörten. Hier brachte ich unseren kleinen Sohn ins Bett, deckte ihn gut zu und sagte: „Ich liebe dich, mein kleiner Räuber.“ Er murmelte „Ich lieb dich auch“ und schloss die Augen vor der dunklen Nacht.
Ich machte seine Zimmertür zu und ging ins Nebenzimmer zu Caleb. Dann lehnte ich mich an seinen Brustkorb und sagte: „Ich liebe dich auch.“ Er schaute auf mich herunter, lächelte und küsste mich.
Unser Sohn war sehr stolz darauf, in einem Studentenwohnheim zu leben. Keiner von seinen Freunden durfte in ein Gebäude voller College-Studenten marschieren, die allesamt einen Narren an ihm gefressen hatten. Jeder, der unseren Sohn kennenlernte – ein goldiger, intelligenter und lustiger Junge mit Superhelden-Fixierung –, verliebte sich in ihn, und die College-Studenten waren keine Ausnahme. Auf seiner Geburtstagsfeier wurde er mit Geschenken überschüttet: Pokémon-Karten von den achtzehnjährigen Jungs, die selbst noch auf Pokémon standen, und Brettspiele von den Mädchen, die alle zu uns kommen und mit ihm spielen wollten.
Wenn er in der Schule ein Bild von seinem Zuhause malen sollte, malte er ein Bild vom Studentenwohnheim, obwohl wir den Großteil seiner Kindheit in einem kleinen Haus am anderen Ende der Stadt verbracht hatten. Er malte ein großes Rechteck, das er mit lauter quadratischen Fenstern ausfüllte. Vor dem Gebäude standen Reed, Caleb, unsere zwei Hunde und ich. Ganz unten auf das Blatt schrieb er: „Willkommen in Summit Hall!“ Auf dem Bild lächeln wir alle, sogar die Hunde.
Am Tag von Reeds Geburtstagsparty heftete ich ein blaues Band an sein Kostüm, auf dem „GEBURTSTAGSKIND!“ stand. Ich dekorierte die Wohnung mit Luftschlangen, Konfetti und einer zirkusartigen Popcorn-Maschine. Ich stellte rot-weiß-gestreifte Popcorn-Behälter daneben, die genauso aussahen wie die, die man im Kino bekommt, backte ein Dutzend Cupcakes, füllte Schalen mit allen möglichen Süßigkeiten und verteilte Hinweise im Studentenwohnheim für eine riesige Schnitzeljagd durchs ganze Gebäude.
Am Morgen kam ich irgendwie nicht richtig in Schwung, obwohl ich diese ganzen Erledigungen noch auf der Liste hatte. Irgendwie ahnte ich, dass es ein schlechter Tag werden würde. Ich zog mich langsam an und hätte am liebsten gar nicht die Sicherheit meines Schlafzimmers verlassen, aber ich konnte ja nicht dort bleiben. Am Vorabend hatten wir die Wohnung geputzt, nur das große Bad musste ich noch machen. Ich goss mir eine Tasse Kaffee ein, dann ging ich ins Bad und begann rasch die Ablagen abzuschrubben. Caleb stellte sich in die Tür. Schaute mich an. Ich schaute ihn nicht an. Schrubbte einfach weiter.
„Kannst du mir wohl die Toilettenbürste aus dem anderen Bad holen?“, fragte ich, ohne aufzublicken.
Er ging, kam mit der Toilettenbürste zurück, kniete sich neben die Toilette und fing an zu schrubben, wobei er die Bürste in wütenden Bewegungen vor und zurück bewegte.
„Du brauchst das nicht zu machen“, sagte ich. „Lass sie einfach da, ich mach das dann schon.“
Er nahm die Bürste und knallte sie an die Wand, das Wasser aus der Toilette spritzte über den ganzen Boden. Ich zuckte zusammen. Die Hunde, die uns normalerweise von Zimmer zu Zimmer folgten, schlichen hinaus und ins Kinderzimmer. Caleb wandte sich zu mir und schrie: „Ich wusste, dass du das machen würdest! Diese Wohnung ist doch sauber genug. Für dich ist es einfach nie genug!“
Ich legte den Schwamm aus der Hand und rannte hinaus. Ich wusste, was jetzt kam. Meine Therapeutin hatte mir geraten, „die Situation zu verlassen“, wenn er sich so verhielt. Ich nahm meine Schlüssel und mein Handy, aber er kam mir nachgerannt, riss mir das Telefon aus der Hand und schmetterte es an die Wand, sodass es zerbrach. Es war eines von vielen Handys, die er zerbrochen hat. Die Schlüssel hatte ich immer noch in der Hand. Ich schaute zur Tür. Er sah es. Wenn ich es zur Tür hinaus schaffte, konnte ich rennen. Das Wohnheim war über die Ferien geschlossen, aber drei von den Aushilfskräften, die auch im Haus wohnten, waren bis Mittag am Empfang. Vor ihnen würde er mich niemals schlagen.
Wieder schaute ich zur Tür und versuchte, um ihn herumzugehen. Caleb kam mir zuvor, vertrat mir den Weg und breitete die Arme aus. Dann tat ich es. Ich duckte mich unter seinem Arm durch, riss die Tür auf und rannte so schnell ich konnte, hinaus in die Sicherheit.
Allerdings folgte er mir. Er folgte mir, obwohl die Assistenten da waren. Sie standen am Empfang und lächelten, als sie mich sahen, aber dann erstarrten ihre Gesichter. Ich rannte vorbei, und Caleb jagte mich. „Komm zurück!“, schrie er. „Komm zurück, du blöde Schlampe!“
Ich rief den Aushilfen zu: „Ruft die Polizei!“, und dann dachte ich, „Oh Gott, hab ich das gerade wirklich gesagt? Hab ich das wirklich gesagt?“
Sie starrten mich an. „Im Ernst?“, fragte ein junger Mann und streckte zögernd die Hand nach dem Telefon aus. Er konnte nicht recht einschätzen, ob das Ganze ein schlechter Witz war, aber ich hatte keine Zeit mehr, ihm zu antworten, denn ich rannte bereits auf die Eingangshalle zu. Caleb verfolgte mich auf Strümpfen. Wir schafften es bis zur Straße, aber dort blieben wir stehen. Uns wurde beiden bewusst, dass wir jetzt ein Publikum hatten.
Ich sah, dass Caleb mir nun nichts mehr tun würde. Er ließ die Schultern hängen und schaute sich um.
„Jetzt ist es aus und vorbei“, sagte er.
Ich geriet in Panik. „Ich bring das wieder in Ordnung“, sagte ich. „Ich bring das wieder in Ordnung.“
Wir gingen zurück ins Haus, diesmal in den Keller, durch eine andere Tür. Ich weinte: „Ich bring das in Ordnung“ und lief die Treppe hoch.
Ich ging zitternd zu den Aushilfen hoch, um mit ihnen zu reden, und begann zu schluchzen.
„Es tut mir leid“, sagte ich. „Er nimmt Medikamente gegen seine Stimmungsschwankungen, und er verträgt sie nicht so gut. Nebenwirkungen.“ Das stimmte sogar. „Bitte sagt es niemandem. Ich weiß, ich hab nicht das Recht, euch um so etwas zu bitten, aber bitte erzählt es niemandem.“
Eine von den jungen Frauen nahm mich zärtlich in den Arm. „Natürlich nicht“, sagte sie.
Der junge Mann schaute zu unserem Apartment. „Ist Reed da drin?“, fragte er.
„Ja“, sagte ich.
„Soll ich hochgehen und mich zu ihm setzen?“, fragte er.
„Ja, bitte“, sagte ich.
Ich schloss ihm die Wohnung auf und ging dann wieder hinunter, um Caleb zu suchen. Er stand bei den Getränkeautomaten. Er sah so winzig aus, so verletzlich. Ich konnte nicht glauben, was ich ihm angetan hatte. Ich hatte sein Leben ruiniert. Jetzt würde er garantiert seinen Job verlieren.
„Ich hab es in Ordnung gebracht“, sagte ich. Dann nahm ich ihn in den Arm. Er begann zu weinen und legte mir den Kopf auf die Schulter. Der Stoff meines T-Shirts war innerhalb von Sekunden durchnässt. Er hatte sich mir gegenüber noch nie so verletzlich gezeigt. Ich hielt ihn fest im Arm.
„Es ist okay“, sagte ich. „Ich hab es wieder in Ordnung gebracht. Komm, wir gehen wieder hoch.“
Ich brachte ihn nach oben, dann ging ich zu Reed ins Zimmer. Der Assistent saß bei ihm auf dem Bett, sie spielten Lego. Reed schien nichts gemerkt zu haben.
„Alles gut“, sagte ich. „Danke.“
Der Assistent stand neben mir – noch kein Mann, aber auch kein Junge mehr. Er schaute zu Caleb hinüber, der im Nebenzimmer stand.
„Brauchen Sie irgendwas?“, fragte er.
Ja, hätte ich am liebsten gesagt. Bitte mach, dass er aufhört. Bitte sag ihm, dass er aufhören soll, mir wehzutun. Bitte beschütz mich. Ich hab solche Angst. Ich hab so schreckliche Angst.
Aber das sagte ich nicht.
„Mir geht’s gut“, sagte ich.
Im Hinausgehen warf er Caleb noch einen Blick zu, doch der schaute ihn nicht an.
Als der Assistent weg war, brach ich weinend zusammen. Ich spürte, dass Caleb immer noch stinksauer war. Wir erwarteten Gäste, und ich wusste, dass ich mich fertig machen musste, ein paar Eiswürfel auf meine roten, geschwollenen Augen legen und meine Augenringe mit Concealer abdecken. Mein feuchtes T-Shirt wechseln, Lächeln üben. Mein sieben Jahre altes Geburtstagskind war schon ganz aufgeregt.
Reed spielte ruhig auf seinem Bett. Das tat er immer bei diesen Wutausbrüchen. Er blieb so lange in seinem Zimmer, wie es nötig war. Ich ging auf den Flur, und Reed folgte mir. Er stellte sich vor mich, und ich schaute zu ihm herab. Zögernd streckte er die Arme aus, legte mir die Hände auf den Bauch und schaute mir auf eine so forschende Art in die Augen, wie er es noch nie zuvor getan hatte. Er wurde groß, und sein Blick verriet mir, dass er Bescheid wusste. Er wusste, was hier vor sich ging.
„Mom?“ Er hielt mich immer noch sanft fest und nahm die Augen nicht von mir.
„Alles gut, mein Schätzchen“, sagte ich und beugte mich zu ihm herab, um ihm das dicke Haar auf der Stirn glatt zu streichen. „Mir geht’s gut.“
„Ich mag es nicht, wenn die Hunde zu mir ins Bett kommen, weil sie so dolle Angst haben“, sagte er.
Er hatte eine so starke Ähnlichkeit mit mir als Kind: dasselbe rotblonde Haar und die großen blauen Augen. Ich erinnerte mich an mich selbst als kleines Mädchen in Idaho, ein sensibles kleines Mädchen, das die Traurigkeit der Erwachsenen in seiner Umgebung wahrnahm, sich aber nie vorgestellt hätte, dass seine eigene Zukunft so herzzerreißend aussehen würde. In diesem Moment wusste ich es.
Ich wusste, dass wir gehen mussten.
1 Blues
Als ich klein war, hatte mein Bruder Glen nächtliche Albträume und schlafwandelte, außerdem litt er an chronischer Migräne. Meine Mutter konzentrierte sich nächtelang nur auf sein Mondgesicht. Um die Augen hatte sie Fältchen vor lauter Sorge, sie tupfte ihm den Kopf mit kalten Tüchern ab, führte ihn zurück ins Bett, hielt ihm die zitternden Schultern.
Ich hatte auch Albträume, aber sie verliefen still. Ich wachte mitten in der Nacht auf, und die Geister, meine Angst vor allem, was ich nicht unter Kontrolle hatte, legten sich bleischwer auf meine Brust. Ich atmete schwer und zitterte, aber ich konnte nicht schreien. Ich konnte sie direkt über mir spüren. Ich konnte sie in den Ecken schweben sehen. Sie gingen niemals weg, nicht mal, wenn ich aufwachte.
Einmal schoss Glen schreiend den Flur hinunter, und ich schaute von meiner Tür aus zu, wie meine Mutter seine Hand nahm und ihn zurück in sein Zimmer führte. Sie konnte ihn nicht aufwecken, wenn er in diesem Zustand war. Er schaute mich an – seine Augen waren weit aufgerissen, das Weiß war rot geädert –, aber er war wie im Tiefschlaf und konnte mich nicht sehen. Ich war unsichtbar für beide.
Eines kalten Wintermorgens wachte ich früh auf und schaute aus dem Fenster über meinem Bett hinaus in die Dunkelheit. Das Eis auf dem Fenster bekam Risse und splitterte, als ich meine Hände auf die gefrorene Schicht legte. Meine Fingerspitzen hinterließen dampfende Abdrücke in winzigen Punkten. Ich beugte mich vor und machte einen schattenhaften Geist auf meine Fensterscheibe, indem ich die Wangen gegen das Glas drückte und die Luft durch meine Lippen blies. Der Geist starrte mich an, als ich mir die Decke fest um die Schultern zog. Ich wollte nicht aufstehen, bevor das Haus warm war, also kuschelte ich mich unter die Bettdecke und wartete, bis mein Vater in unserem Holzofen eingeschürt hatte.
Jeden Morgen lauschte ich nach dem Geräusch des Radios und des prasselnden Feuers. Die Schule blieb nur geschlossen, wenn die Temperatur unter minus 20 Grad fiel, und das passierte manchmal mehrere Tage hintereinander. Wenn der DJ „Leo der Löwe“, ein Mormone mittleren Alters mit einer dröhnenden Stimme, wieder mal kältefrei verkündete, lächelte ich in mich hinein, bevor ich aus dem Bett hüpfte, um draußen zu spielen. Das Wetter konnte mich nie zurückhalten. Ich hatte vor nichts Angst, nur vor Geistern.
Mein Nachbar Danny mochte die Kälte nicht, und heute war ein kalter Tag. Seine Tante, bei der er wohnte, arbeitete in der Schulkantine, und seine Familie hatte keinen Holzofen. Sie konnten ihr Haus nie so richtig heizen. Meine Familie war nicht reich, so gerade eben Mittelschicht, aber meine Mutter war geprüfte Krankenschwester, und mein Vater arbeitete für den US Forest Service, also hatten wir im Vergleich zu Dannys Familie doch ziemlich viel.
Eine Weile konnte Danny nicht mehr rüberkommen, weil er versucht hatte, meinen „Intimbereich“ zu berühren, wie meine Eltern es nannten. Ein paar Monate zuvor waren Danny und ich auf der Seite des Gartens gewesen, wo meine Eltern ihren Gemüsegarten hatten. Wir versteckten uns hinter einer Reihe Tomatenpflanzen, als er mich bat, ihm meinen „Intimbereich“ zu zeigen. Ich wollte nicht, aber er sagte, dass Erwachsene das die ganze Zeit machten. Die älteren Nachbarsjungen kicherten in Dannys Garten und deuteten zu uns hinüber. Ich hatte das Gefühl, dass ich reingelegt wurde, aber ich war zu jung, um das Ganze zu durchschauen, und da ich sonst auch vor keiner Herausforderung kniff, hob ich langsam meinen Rock hoch, und er ließ seine Hose herunter.
In seinem eigenen „Intimbereich“ hing etwas – rosa und weich. Ich konnte den Blick nicht abwenden. Da schob er die Hüften vor und meinte, wir sollten sie aneinander reiben. Ich trat rasch einen Schritt zurück, denn das wollte ich nun wirklich nicht machen. Genau in dem Moment kam meine Mutter um die Ecke geschossen und gestikulierte aufgeregt, als wären ihre Hände Schmetterlinge. Sie riss meinen Rocksaum wieder herunter und sagte zu Danny: „Geh nach Hause und komm nie wieder hierher!“ Dann zerrte sie mich schleunigst ins Haus und hielt mir eine Predigt, dass ich den Jungen niemals meinen Intimbereich zeigen dürfte – unter gar keinen Umständen. Ich nickte nur und schaute ins Leere.
Es war nicht das erste Mal, dass ich Ärger bekam. Ich war ein schwieriges Kind. Mein Bruder, der sechs Jahre älter war, war der Goldige, der Aufrichtige. Ich habe meine Mutter Glen nie so anschreien hören, wie sie mich anschrie. In mir loderte so eine Wut, ich wollte ständig Dinge, die ich nicht haben konnte – später ins Bett gehen, mehr Freunde haben, eine andere Familie. Einmal jagte ich meinen Bruder mit einem hoch erhobenen Schlittschuh. Er schloss sich ins Badezimmer ein, und ich rammte die Kufe in die Holztür und zog sie nach unten, was einen tiefen Kratzer im Holz hinterließ. Später schämte ich mich dafür, aber das verheimlichte ich. Ich wollte nicht, dass jemand meinte, es täte mir leid.
„Das ist eben das Temperament der Rothaarigen“, sagten alle über mich. Das hörte meine Mutter gar nicht gern, denn sie hatte auch rote Haare. „Die Leute machen die Rothaarigen so“, sagte sie, „weil sie sie von vornherein so behandeln.“ Vielleicht hatte sie recht, denn sie war genau wie ich. Sie kniff nie vor einer Auseinandersetzung.
An dem Tag, bevor er meinen Intimbereich sehen wollte, jagte Danny mich mit einem Messer ums Haus. Er hatte meine Puppe in den Matsch geworfen, also hatte ich ihn geschubst. Mädchen hin oder her, ich war bereit zum Kampf, aber er zog ein Messer aus der Tasche und erklärte, damit würde er mich schneiden. Ich sah in seinem Blick, dass er es ernst meinte. Ich rannte, so schnell ich konnte, und umrundete dreimal das Haus, während ich nach Glen schrie. Mein Bruder saß mit seinen Freunden auf der Veranda, und sie ignorierten mich, wie immer. Ich war ziemlich schnell, normalerweise schneller als die Jungen, aber ich wurde langsam müde, und Danny holte auf. Ich wusste, dass er mit dem Messer nach mir stechen würde. Dass er keinen Spaß machte. In seinen Augen lag Grausamkeit, und die war nicht wie die Wut, die in meiner Brust brannte, aber normalerweise damit endete, dass ich heulend ins Kinderzimmer geschickt wurde. Dannys Raserei war größer.
Schließlich schritt Glen doch ein, packte Danny beim T-Shirt und befahl ihm, mich in Ruhe zu lassen. Dann stieß mein Bruder mich kräftig gegen die Schulter und nannte mich eine Memme. „Der hätte dir doch sowieso nichts getan“, sagte er.
Ich stand da mit schmerzender Schulter, während der kleine Knoten in meinem Magen sich brennend seinen Weg bis in meine Kehle bahnte. Das Brennen war irgendwas zwischen Wut und Traurigkeit. Glen verstand das nicht. Er würde immer größer sein als ich. Er würde immer stärker sein. Ich mochte das zäheste kleine Mädchen der Welt sein, aber ich war trotzdem bloß ein Mädchen.
Ich wusste, dass meine Mutter mir nicht glauben würde, deswegen erzählte ich ihr nicht, dass Danny versucht hatte, mich mit einem Messer zu stechen und dass Glen eine ganze Weile zugeschaut hatte, bevor er eingriff und mir half. Ich hatte Angst vor Danny und seinem Messer, aber nicht genug, um das Risiko einzugehen, der Lüge bezichtigt zu werden. Im Davonlaufen war ich damals schon ganz gut, aber um Hilfe zu bitten, fiel mir schwer.
Trotzdem wusste ich, dass ich nett sein musste zu Danny, weil sein Vater im Sterben lag. Seine Mutter hatte die Familie verlassen. Danny lebte mit seinem Vater im Haus nebenan, aber als sein Vater zu krank wurde, zog Danny zu seiner Tante, die in der gleichen Straße wohnte. Dort lebte er dann mit seinem Bruder Wade, seiner Schwester Bambi, seiner Tante und seinem Großvater, der Alzheimer hatte. Sein Bruder und er taten praktisch nichts anderes, als bei uns im Hof Basketball zu spielen und das Elchfleisch-Jerky meines Vaters aufzuessen.
Einmal im Winter kamen wir von der Kirche nach Hause und entdeckten, dass Danny eine Pizza aus unserer Gefriertruhe in der Garage gestohlen hatte und sie über einem Feuer im Hof aufzubacken versuchte. Doch sein Feuer wollte nicht so richtig brennen, und alles, was er zustande brachte, war eine Pfütze aus geschmolzenem Schnee. Die Pizza war halb gefroren, halb durchgeweicht, und ich dachte mir, dass das so ziemlich das Dämlichste war, was ich jemals gesehen hatte. Außerdem dachte ich, meine Eltern würden stocksauer werden, aber sie wurden nicht böse. Sie nahmen Danny mit ins Haus und machten ihm ein Schinkenbrot. Meine Eltern machten sich Sorgen um ihn, was ich nie so richtig verstand. Sie sahen in ihm nur das verletzliche Kind. Das Kind mit dem Messer sahen sie nicht.
Meine Mutter rief Dannys Tante an, die seinen Bruder Wade rüberschickte, damit er ihn abholte. Wade war groß und hatte strähniges rotes Haar, jede Menge Sommersprossen und starke Arme, und er jagte mir Angst ein. Sein Hund Mimi folgte ihm überallhin, wie ein kleiner weißer Mopp, der ihm ständig um die Füße wuselte. Durch Mimi wirkte Wade weniger furchteinflößend, weil er sie so lieb hatte.

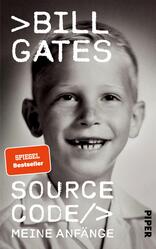
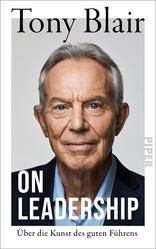

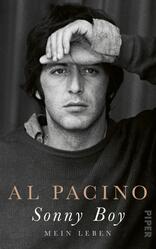



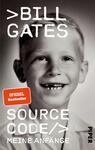


DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.