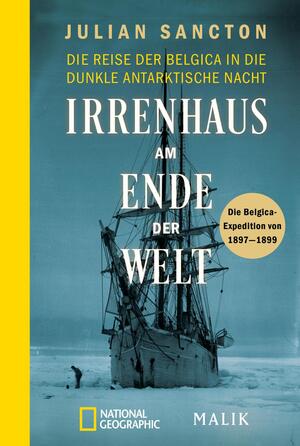
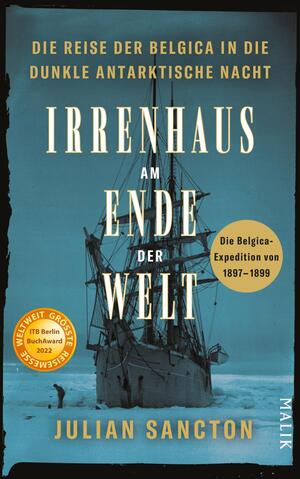
Irrenhaus am Ende der Welt Irrenhaus am Ende der Welt - eBook-Ausgabe
Die Reise der Belgica in die dunkle antarktische Nacht. Die Belgica-Expedition von 1897–1899
— Spannende Polar-Expedition, filmreif erzähltIrrenhaus am Ende der Welt — Inhalt
Expedition ins ewige Eis
„Ein seltenes Juwel der Sachbuchliteratur“ Walter Isaacson
Im August 1897 bricht der belgische Kommandant Adrien de Gerlache auf, um die Antarktis zu erobern. Bereits auf dem Weg gen Süden gibt es zahlreiche Rückschläge: Stürme, Beinahe-Meutereien, Strandungen. Als der nach Ruhm strebende de Gerlache schließlich vor der Wahl steht, geschlagen nach Hause zurückzukehren oder kurz vor Wintereinbruch tiefer ins Eis zu fahren, entscheidet er sich für Letzteres – mit fatalen Folgen. Die Belgica bleibt im Packeis stecken.
Gefangen in völliger Isolation und endloser Nacht, geplagt von Krankheit, Hunger und Monotonie, greift bald der Wahnsinn um sich. Der Arzt Frederick Cook und der junge Roald Amundsen werden mit ihrem grenzenlosen Optimismus für die Mannschaft überlebenswichtig …
„Dieser packende Bericht über die Belgische Antarktis-Expedition von 1897 bietet Meuterei, Gefahr und das Urteil des jungen Roald Amundsen über rohes Robbenfleisch.“ The Guardian
Mit exklusivem Zugang zu zahlreichen Originalquellen rekonstruiert Sancton die unglaubliche Geschichte der Belgica bis ins letzte Detail und leistet einen elementaren Beitrag zur Polargeschichte. Das Buch wurde 2022 mit dem ITB BuchAwardausgezeichnet.
„Die Reise eine Katastrophe, die Erzählung darüber fesselnd wie ein Abenteuerroman.“ mare
„Mit minutiöser Recherche und dem scharfen Auge eines Schriftstellers hat Julian Sancton eine der spannendsten – und erschreckendsten – Abenteuergeschichten seit Jahren geschrieben. Lassen Sie sich dieses Buch nicht entgehen!“ Scott Anderson
Leseprobe zu „Irrenhaus am Ende der Welt“
PROLOG
20. Januar 1926 Leavenworth, Kansas
Das Licht eines kalten, grauen Morgens fiel durch die Gitter vor den schmalen Fenstern der Krankenstation im Bundesgefängnis Leavenworth. Erschöpft von seiner Sechzehnstundenschicht räumte der alte Doktor das Behandlungszimmer auf und gab dem Wärter zu verstehen, dass er bereit war, sich zu seiner Zelle zurückbringen zu lassen. Sobald er seine Pflicht wieder an den eigentlichen Gefängnisarzt abgegeben hatte, war er ein Gefangener wie jeder andere, Häftling #23118.
Der Doktor ließ sich auf sein Bett fallen. Hinter [...]
PROLOG
20. Januar 1926 Leavenworth, Kansas
Das Licht eines kalten, grauen Morgens fiel durch die Gitter vor den schmalen Fenstern der Krankenstation im Bundesgefängnis Leavenworth. Erschöpft von seiner Sechzehnstundenschicht räumte der alte Doktor das Behandlungszimmer auf und gab dem Wärter zu verstehen, dass er bereit war, sich zu seiner Zelle zurückbringen zu lassen. Sobald er seine Pflicht wieder an den eigentlichen Gefängnisarzt abgegeben hatte, war er ein Gefangener wie jeder andere, Häftling #23118.
Der Doktor ließ sich auf sein Bett fallen. Hinter ihm lag eine anstrengende Nacht. Eine Opioidkrise von nie da gewesenem Ausmaß hielt das Land fest im Griff – auch das oberste Stockwerk der Krankenstation wurde nach Einbruch der Dunkelheit zu einem „Drogen-Irrenhaus“, wie der Doktor es formulierte, wo die Süchtigen im Zwangsentzug nach dem erlösenden Schuss schrien. Die Zelle des Doktors war ein hell beleuchteter Raum in dem dreistöckigen Ziegelbau, ausgestattet mit einem Einzelbett, einem Stuhl und fließend Wasser. An den Wänden hingen mehrere kunstvolle Stickbilder, die er selbst angefertigt hatte. Seine Unterbringung im Gefängnis war komfortabler als die mancher seiner Zeitgenossen, darunter der Chicagoer Gangster Big Tim Murphy (der sein Freund und Beschützer geworden war) oder, später dann, Carl Panzram, der überaus produktive und reuelose Serienmörder (der es nicht wurde). Die Delikte von Häftling #23118 waren anderer Art. Der Sechzigjährige war wegen Betrugs mit Aktien einer Erdölgesellschaft verurteilt worden, der sich zu einem Pyramidensystem ausgewachsen hatte. Er saß gerade das dritte Jahr seiner vierzehnjährigen Haft ab – das war zwar ein weitaus höheres Strafmaß, als sonst für vergleichbare Vergehen verhängt wurde, aber es passte zu seinem schlechten Ruf.
In seinen fast schon vergessenen Jahren als junger Mann, lange bevor er in Ungnade gefallen war, hatte sich der Doktor einen Namen als gefeierter Polarforscher gemacht. Mit seiner Behauptung, 1908 den Nordpol erobert zu haben, war er zum Nationalhelden geworden, bis der Verdacht aufkam, dass er diese Großtat – wie auch einige andere – nur vorgetäuscht hatte. „Er wird für alle Zeiten als einer der größten Hochstapler der Welt gelten“, versicherte die New York Times. „Und damit, nicht mit der Entdeckung des Nordpols, wird er sich ein Denkmal setzen.“
Am Nachmittag informierte ihn ein Gefängnisaufseher darüber, dass er Besuch habe. Seit er im vergangenen Jahr hierher ins Bundesgefängnis verlegt worden war, hatte der Doktor sich geweigert, seine Familie oder Freunde zu empfangen. Der Mann, der heute auf ihn wartete, war vermutlich der einzige Mensch auf Erden, bei dem er gerne eine Ausnahme machte. Es verging kaum ein Tag, an dem der Gefangene nicht an seinen früheren Kameraden dachte, jenen vitalen 53-jährigen Norweger, mit dem er fast dreißig Jahre zuvor an einer qualvollen Expedition in die Antarktis teilgenommen hatte. Der ehemalige Lehrbursche des Doktors in allen Polarfragen war später einer der bedeutendsten Entdecker geworden, den die Welt je gesehen hatte: der rechtmäßige Eroberer des Südpols. Seine schlagzeilenträchtigen Heldentaten und die offensichtliche Mühelosigkeit, mit der er sie vollbrachte, hatten ihm eine nahezu mystische Aura verliehen. Eine internationale Vortragsreise führte ihn auch durch die Vereinigten Staaten, und nun hatte er beschlossen, seinem früheren Mentor seine Aufwartung zu machen.
Die Nachricht, dass der gefeierte Entdecker dem wohl bekanntesten Insassen von Leavenworth einen Besuch abstattete, sprach sich in Windeseile herum. Schon wenige Minuten später strömten die Reporter zum Gefängnis. Mit seiner öffentlichen Geste der Unterstützung des diskreditierten Doktors setzte der Norweger seinen eigenen guten Ruf aufs Spiel. Doch der Besuch war mehr als ein bloßer Akt des Mitleids für einen alten Freund, der sich in einer misslichen Lage befand. Der jahrelange, ehrgeizige Wettlauf um die begehrtesten geografischen Trophäen des Planeten hatte seinen Tribut gefordert. Das Feuer, das in seinem Innersten brannte, hatte den Norweger aufgezehrt. Er war zu einem verbitterten, paranoiden Mann geworden, und nur wenige Freunde waren ihm geblieben, die ihn so gut kannten wie der Doktor, von dem er einst, als alles noch einfacher gewesen war und nur das eigene Überleben zählte, so viel gelernt hatte. Vor allem aber fühlte er sich moralisch verpflichtet, dem Mann einen Besuch abzustatten, dem er sein Leben verdankte.
Seit die beiden einander zum letzten Mal begegnet waren, hatte das Schicksal sie in völlig unterschiedliche Richtungen geführt, und deren Spuren waren ihren Gesichtern deutlich anzusehen. Bereits diese ersten Jahre der Gefangenschaft hatten dem Doktor jede Farbe und Vitalität geraubt. Seine schiefergrauen Augen hatten ihr lebendiges Funkeln nahezu verloren, sein einst so üppiges Haar war dünn geworden und die große Nase – sofern das überhaupt möglich war – noch größer. Wenn er jedoch lächelte, konnte man außer einigen Goldzähnen durchaus noch etwas von seinem früheren, jüngeren Ich aufblitzen sehen.
Der Besucher aus Norwegen überragte den Doktor um ein ganzes Stück. Sein Gesicht war „braun, stark verbrannt von der polaren Schneewelt, von tiefen Falten durchzogen und voller Lebenskraft“, erinnerte sich der Doktor später. Der Forscher „stand im Zenit seines Ruhmes, [während] ich mein Leben als Verurteilter fristen musste … Dies empfand ich im ersten Moment als furchtbar, doch schon bald hatte die alte Herzlichkeit alle Hemmnisse überwunden. Wir fühlten uns wie Brüder.“
Die Männer gaben einander die Hände und ließen sie nicht mehr los. Um mögliche unerbetene Zuhörer zu verwirren, bedienten sie sich dem Doktor zufolge der „Mischsprache der Belgica“. An Bord dieses Schiffes waren sie einander zum ersten Mal begegnet, als junge Männer, während ihrer ersten Reise in die Antarktis. Die verschiedenen Sprachen der Wissenschaftler, Offiziere und Mannschaftsmitglieder waren zu einem babylonischen Amalgam aus Französisch, Niederländisch, Norwegisch, Deutsch, Polnisch, Englisch, Rumänisch und Lateinisch verschmolzen. Die Reise hatte sie gelehrt, welch verheerende Wirkung Kälte und Dunkelheit auf die menschliche Seele haben können. Es war diese Expedition gewesen, die den Doktor zu einem wahren Sonnenanbeter gemacht hatte. Auch damals war er ein Gefangener gewesen, aber nicht von Gitterstäben und Riegeln eingeschlossen, sondern von einer schier endlosen Eisfläche. Und auch damals hatte er Schreie in der Nacht gehört.
TEIL I
Manchmal dient die Wissenschaft als Vorwand für eine Expedition. Ich glaube, sie ist selten der Grund dafür.
George Mallory
KAPITEL 1
WARUM NICHT BELGIEN?
16. August 1897 Antwerpen
Die Schelde wand sich träge vom Norden Frankreichs durch Belgien und bog beim Hafen von Antwerpen, wo sie tief und breit genug für Hochseeschiffe wurde, scharf nach Westen ab. Es war ein wolkenloser Sommermorgen, und mehr als 20 000 Menschen drängten sich in der Stadt entlang des Flussufers, um der feierlich auslaufenden Belgica zuzujubeln. Der 34 Meter lange, dreimastige Walfänger – ausgestattet mit einem frischen, stahlgrauen Anstrich und einem kohlebefeuerten Motor – war auf dem Weg in die Antarktis, um ihre unerforschten Küsten zu kartieren und Erkenntnisse über ihre Fauna, Flora und Geologie zu gewinnen. Was die Menge heute jedoch hierherführte, war weniger die Aussicht auf wissenschaftliche Entdeckungen als vielmehr Nationalstolz: Das kleine Land Belgien, das erst 67 Jahre zuvor seine Unabhängigkeit von Holland erklärt hatte und damit jünger war als viele seiner Einwohner, machte sich daran, die Grenzen der Forschungsgeschichte neu zu ziehen.
Um zehn Uhr lichtete das Schiff den Anker und segelte gemächlich Richtung Nordsee, so schwer beladen mit Kohle, Proviant und Ausrüstung, dass sein Deck nur einen halben Meter aus dem Wasser herausragte. Begleitet von einer Flottille von Jachten, auf denen sich Regierungsvertreter, Gratulanten und Journalisten versammelt hatten, glitt die Belgica stolz durch Antwerpen: vorbei an den beflaggten Häusern des Hafenviertels, der prächtigen gotischen Kathedrale, die die Silhouette der Stadt dominierte, und an Het Steen, der Festung, die seit dem Mittelalter am Flussufer aufragte. Von einem Ponton aus hörte man eine Militärkapelle „La Brabançonne“ spielen, die Nationalhymne Belgiens, deren Motiv so groß war wie das Land klein. Zu beiden Ufern der Schelde wurden Böllerschüsse abgefeuert. Schiffe aus der ganzen Welt ließen ihr Nebelhorn ertönen und hissten die schwarz-gelb-rote belgische Flagge. Jubelrufe wogten durch die Menge, als die Belgica vorübersegelte. Die ganze Stadt schien zu vibrieren.
Auf der Schiffsbrücke, den Blick zurück auf das aufgewühlte Meer aus Fahnen, Hüten und Taschentüchern gewandt, stand der 31-jährige Kommandant der Expedition, Adrien de Gerlache de Gomery. Sein Gesichtsausdruck ließ keine Gemütsregung erkennen, doch hinter seinen schweren Lidern verbarg sich eine glühende Begeisterung. Sein Äußeres war bis ins kleinste Detail auf diesen Augenblick abgestimmt, bis hin zu den aufwärts gezwirbelten Schurrbartenden, dem sorgfältig getrimmten Bart und dem Knoten in seiner Krawatte. De Gerlaches dunkler, zweireihiger Mantel war zu warm für diesen Augustmorgen – wenn auch bei Weitem nicht warm genug für das Eis am Ende der Welt –, doch er verlieh seinem Auftreten eine gewisse Schneidigkeit, wie sie einem Mann, der drauf und dran war, Geschichte zu schreiben, durchaus zustand. Der Kommandant schien den Beifall zu genießen, denn er griff immer wieder nach dem lackledernen Schirm seiner mit dem Emblem der Belgica verzierten Kappe, nahm sie vom Kopf und winkte damit der jubelnden Menge zu. Er hatte sich so lange nach diesem Jubel gesehnt, dass ihm der Startpunkt der Expedition fast wie die Ziellinie vorkam. „Meine Gemütsverfassung“, schrieb er, „war die eines Mannes, der soeben sein Ziel erreicht hat.“
In gewisser Weise traf dies sogar zu. Dass das Schiff überhaupt auslief, war de Gerlaches persönlicher Triumph. Trotz des tief empfundenen Patriotismus, der an diesem Morgen zu spüren war, war die Belgische Antarktis-Expedition weniger eine nationale Unternehmung als vielmehr Ausdruck Adrien de Gerlaches eisernen Willens. Über drei Jahre hatte er damit verbracht, die Route zu planen, eine Mannschaft zusammenzustellen und die nötigen Mittel für die Fahrt aufzubringen. Nur dank seiner Entschlossenheit hatte er Skeptiker überzeugen, Geldhähne sprudeln lassen und eine ganze Nation dazu bringen können, sein Vorhaben zu unterstützen. Auch wenn ihn noch 16 000 Kilometer von seinem Ziel trennten, gewährte ihm dieser Moment bereits einen Vorgeschmack auf den ersehnten Ruhm. Die Aufbruchsstimmung und seine ihm zujubelnden Landsleute ließen de Gerlache nur allzu leicht vergessen, dass dieser Ruhm nur geborgt war. Um ihn sich tatsächlich zu verdienen, würde er seine Reise in eine der unwirtlichsten Gegenden der Erde, durch einen Kontinent, der so lebensfeindlich war, dass es noch keinem Menschen gelungen war, mehr als ein paar Stunden an seinen Küsten zu verbringen, erst einmal überleben müssen.
Etwa zwanzig Kilometer nordwestlich von Antwerpen verlief die Grenze zwischen Belgien und den Niederlanden, quer über die Schelde hinweg. Bevor die Belgica sie kreuzte, legte sie am Kai von Liefkenshoek an, um eine letzte Sache zu erledigen. Während die Feierlichkeiten an Deck und auf den Jachten, die das Schiff umschwärmten, munter weitergingen, lief die Besatzung emsig zwischen Landungsplatz und Laderaum hin und her, um eine halbe Tonne Tonit zu verladen, einen Sprengstoff, dem eine größere Sprengkraft zugeschrieben wurde als Dynamit. Die Tonitstangen, die mehrere große Kisten im Laderaum des Schiffes füllten, waren de Gerlaches Lebensversicherung. Was genau ihn im antarktischen Eis erwarten würde, wusste er nicht, doch ihm war klar, dass man sich einem Kontinent, der die Menschen bis zum 19. Jahrhundert erfolgreich hatte abwehren können, mit einigem Respekt nähern musste. Aus seiner Sicht gab es gleich mehrere Möglichkeiten, wie das Schiff dort zerstört werden könnte: Es könnte einen Eisberg rammen oder auf ein unkartiertes Riff auflaufen. Doch das wohl gefürchtetste Szenario war, dass das Eis die Belgica einschließen würde und ihre Mannschaft verhungern ließe. Schon etliche berüchtigte Expeditionen in die Nordpolregion waren von einem solchen Schicksal ereilt worden. De Gerlache ging jedoch davon aus, dass eine halbe Tonne Tonit ausreichen würde, um den Griff des Meereises nötigenfalls zu lösen. Es war das erste Mal, dass er die Naturgewalten der Antarktis unterschätzte, doch es würde nicht das letzte Mal sein.
Während die Mannschaft das Tonit in den Laderaum brachte, verließ ein Grüppchen von Würdenträgern eine der Jachten und ging an Bord der Belgica, um de Gerlache und seinen Männern eine gute Reise zu wünschen. Als leidenschaftlicher Seemann fühlte sich der Kommandant auf dem Meer wesentlich wohler als in der Menge, und in den letzten drei Jahren war er des freundlichen Händeschüttelns überdrüssig geworden. Er hatte mehr Zeit damit zugebracht, anderen Geld abzuschwatzen, als er voraussichtlich in der Antarktis verbringen würde. So spürte er, während er Höflichkeiten mit Ministern, vermögenden Förderern und den weisen alten Herren der Königlichen Belgischen Geografischen Gesellschaft austauschte, seine Verpflichtungen ihnen gegenüber schwer auf sich lasten. Sein Respekt vor dem gefrorenen Kontinent war, wie sich später herausstellen sollte, nicht besonders groß; das Urteil dieser Männer aber fürchtete er umso mehr.
Sollte seine Unternehmung scheitern, würde er die Enttäuschung eines ganzen Landes auf sich nehmen müssen. Viel schlimmer jedoch war für ihn die Vorstellung, welche Schande dies für seine angesehene Familie bedeuten würde. Die de Gerlaches zählten zu den ältesten Adelsdynastien Belgiens und ihr Stammbaum ließ sich bis in das 14. Jahrhundert zurückverfolgen. Ein Verwandter, Baron Etienne-Constantin de Gerlache, war einer der Gründer der belgischen Nation, einer der maßgeblichen Mitgestalter der Verfassung des Landes sowie dessen erster Ministerpräsident gewesen (auch wenn seine Amtszeit gerade einmal neunzehn Tage gewährt hatte). Sowohl Adriens Großvater als auch sein Vater hatten sich als Militäroffiziere verdient gemacht. Ein de Gerlache war zu Höherem bestimmt – und das erwartete auch die Öffentlichkeit. Adriens Familie hatte der Presse und den Mitgliedern des Brüsseler Hochadels gegenüber demonstrativ ihre Unterstützung für sein Antarktisprojekt zugesagt und damit ihren guten Ruf auf seinen Erfolg verwettet. Das alles verstärkte den Erwartungsdruck, dem der Kommandant sich ausgesetzt sah.
Adriens Eltern, seine Schwester und sein Bruder – ein vielversprechender Leutnant – waren ebenfalls an Bord der Belgica gekommen, wo sie auch dann noch blieben, als die Würdenträger bereits auf ihre Jachten zurückgekehrt waren. Aus den Reihen der Förderer durfte lediglich Léonie Osterrieth bleiben, die engagierteste und leidenschaftlichste Unterstützerin der Expedition. Die füllige 54-jährige Witwe eines bekannten Antwerpener Kaufmanns behandelte de Gerlache wie ihren eigenen Sohn. Er wiederum nannte sie „Maman O.“ und betrachtete sie als seine zuverlässigste Vertraute. (Angesichts ihrer großzügigen finanziellen Beteiligung an der Expedition verliehen die Männer ihr später den Spitznamen Mère Antarctique, was „Mutter Antarktis“ bedeutet, aber auch gleichlautend mit Mer Antarctique – „Antarktisches Meer“ – ist.) Als es ans Abschiednehmen ging, umarmte Adriens Vater, der ehrwürdige Auguste, sämtliche Mitglieder der Expedition, vom einfachen Matrosen bis zum Wissenschaftler, und nannte sie alle mit zitternder Stimme seine „lieben Kinder“. Emma, die Mutter des Kommandanten, schluchzte hemmungslos, als hätte sie eine Vorahnung, dass sie ihren ältesten Sohn vielleicht nie mehr wiedersehen würde. Georges Lecointe, der 28-jährige Kapitän des Schiffes, ein kleiner, streitbarer Bursche, schwor, er und der Rest der Männer würden für ihren Sohn ihr Leben einsetzen – und er war zweifellos jemand, der seine Versprechen hielt. Dann ließ er die Besatzung ein dreifaches „Lang lebe Madame de Gerlache!“ anstimmen. Noch während der letzte Jubelruf über der Schelde verhallte, gab der Kapitän den Befehl zum Aufbruch.
„Los, alle Mann zurück auf ihre Posten!“
De Gerlaches Familie verließ das Schiff und bestieg eine Jacht namens Brabo, die wendete, um zurück nach Antwerpen zu fahren. Dem Kommandanten, der, seine Kappe schwenkend, an Deck der Belgica stand, gelang es zwar, die Tränen zurückzuhalten, doch – wie ein Beobachter bemerkte – „sein Gesichtsausdruck verriet eine tiefe Ergriffenheit“.
„Vive la Belgique!“, schrie er über das Wasser, als die Brabo davonzog. Dann schwang er sich mit der Gewandtheit eines Akrobaten hinauf in die Takelage. In weniger als fünfzehn Sekunden war er im Mastkorb – einem umfunktionierten Fass – angelangt, wo er ein letztes Mal seine Kappe schwenkte, bis das Boot mit fast allen an Bord, die ihm lieb und teuer waren, hinter der nächsten Flussbiegung verschwand.
De Gerlache hatte sein ganzes Leben in Belgien verbracht, und dennoch fühlte er sich in der Kajüte eines Schiffes mehr zu Hause, ganz gleich, wohin es ihn brachte. Zur Welt gekommen war er am 2. August 1866 im belgischen Hasselt. Im Unterschied zu seinem Bruder, seinem Vater, seinem Großvater und etlichen anderen Männern in der jahrhundertelangen Ahnenreihe der Familie de Gerlache interessierte er sich nicht für eine Karriere beim Militär. Im Grunde seines Herzens war er Pazifist und träumte von einem Leben auf hoher See – eine eher ungewöhnliche Vision für einen Jungen, der in einem Land aufwuchs, das nach seiner Abspaltung von den Niederlanden in der Revolution von 1830 ohne Kriegsflotte und mit einer eher unbedeutenden Handelsmarine und nur knapp 65 Kilometern Küste dastand.
Als Kind hatte sich de Gerlache kaum für die Kriegsspiele der anderen Jungen begeistern können. Stattdessen hatte er unzählige einsame Stunden damit zugebracht, kunstvolle Miniaturschiffe zu basteln. Sein Meisterstück war ein prächtiges Segelboot mit funktionierender Takelage, das er mit der liebevollen Hilfe seiner Mutter im Laufe eines Winters gebaut hatte. Als es schließlich fertig war, ließ er es auf einem Bach in der Nähe seines Elternhauses zu Wasser. Er strahlte vor Stolz, als sich die sorgfältig umsäumten Segel mit Wind füllten, musste dann aber hilflos mit ansehen, wie das Schiff von einer Böe erfasst und kielaufwärts über eine Staustufe getrieben wurde. Die Cambrier, wie er sie getauft hatte, war das erste Schiff unter seinem Kommando – und mit ihr erlebte er seinen ersten Schiffbruch.
Dieser herzergreifende Vorfall konnte seine maritimen Ambitionen jedoch kaum dämpfen. Anfangs begegneten die Eltern seiner Leidenschaft für das Meer noch mit Nachsicht und taten sie als vorübergehenden Jungentraum ab, doch mit den Jahren wurde seine Begeisterung, befeuert durch die vielen Geschichten über Heldentaten auf hoher See, die er verschlang, immer mehr zu einer fixen Idee. Mit sechzehn Jahren schrieb er sich an der Freien Universität Brüssel ein und konnte mit seinen Leistungen glänzen. Im Sommer heuerte er regelmäßig als Hilfsmatrose auf Überseedampfern an und reiste so von Antwerpen aus über den Atlantik, unter anderem bis nach New York und Philadelphia.
Colonel Auguste de Gerlache war mit Adriens Berufswahl nicht einverstanden, da sie in seinen Augen nicht dem gesellschaftlichen Stand und dem Bildungsniveau seines Sohnes entsprach. Die Vorstellung, dass Adrien Decks schrubben, auf einem Haufen zusammengerollter Taue schlafen, steinharten Schiffszwieback essen und die üblichen demütigenden Rituale für Neulinge über sich ergehen lassen musste, war ihm unerträglich. Er bedrängte Adrien deshalb, sich einen respektableren Beruf zu suchen, doch bald war unübersehbar, dass der Junge an Land nicht glücklich werden würde. „Sobald er nach Hause kam, war er wehmütig“, erinnerte sich Adriens Schwester Louise. „Aus reinem Pflichtbewusstsein und Gehorsam setzte er sein Ingenieurstudium fort, so gut er konnte; kurze Zeit später hatte sich sein gesundheitlicher Zustand ernsthaft verschlechtert; er wurde melancholisch, und seine Augen bekamen jenen Ausdruck, wie er Seeleuten und anderen Reisenden zu eigen ist, jenen verschleierten, unergründlichen Blick, der selbst dann, wenn er direkt auf einen gerichtet ist, an irgendeinem Punkt in endlos weiter Ferne zu verharren scheint.“
Schließlich gab Auguste seinen Widerstand auf. Er gestattete dem Sohn, an einem Schifffahrtslehrgang teilzunehmen und sich bei der belgischen Marine zu verpflichten – so unvollkommen diese auch sein mochte. De Gerlache gab sich große Mühe zu beweisen, dass er das Vertrauen seines Vaters verdient hatte. Seine Lehrer bemerkten schnell seine Leidenschaft für die Seefahrt und sein Talent in der Beurteilung von Wind und Strömungen. Schon nach kurzer Zeit konnte de Gerlache seine weite Seemannshose und den Südwester gegen die schmucke Uniform eines Offiziersanwärters tauschen. Es dauerte nicht lange, bis er zu den vielversprechendsten Talenten der belgischen Marine zählte. Allzu viel gehörte freilich nicht dazu, denn die Hauptaufgabe der Flotte bestand darin, den Fährbetrieb in der Nordsee zu überwachen. Um die nötigen Erfahrungen für den Posten eines Schiffskapitäns zu sammeln, blieb de Gerlache somit nichts anderes übrig, als auf ausländischen Schiffen anzuheuern. Auf diesen Reisen lernte er auch erstmals die Ehrfurcht gebietende, zerstörerische Kraft des Meeres kennen. Bei einer Fahrt wurde die Craigie Burn, das britische Schiff, auf dem de Gerlache diente und das auf dem Weg über Kap Hoorn nach San Francisco war, von den Stürmen und Felsen vor der Küste Feuerlands so heftig gebeutelt, dass die Mannschaft sie aufgeben musste. Es war de Gerlaches zweiter Schiffbruch.
Nach mehreren Jahren Dienst auf niederländischen Ozeandampfern beförderte man ihn zum Oberleutnant und übertrug ihm die Aufsicht über die Fährverbindung zwischen Ostende und Dover. Auf dieser Route begegnete de Gerlache 1890 auch zum ersten Mal dem belgischen König, der unterwegs nach London war. Leopold II., ein groß gewachsener, gebieterischer Mann mit einer Nase wie eine Axtklinge und einem Vollbart wie ein graues Brett, zeigte durchaus Interesse am Werdegang de Gerlaches, einerseits wegen dessen illustren Familiennamens und andererseits, weil man ihm von dem außerordentlichen Talent des jungen Mannes berichtet hatte. Der Monarch stattete dem 23-jährigen Leutnant daher einen Besuch auf der Kommandobrücke ab. Ob er dem belgischen Staat gerne diene, wollte der König von ihm wissen. De Gerlache antwortete mit jugendlicher Freimütigkeit: „Ja, sehr gerne, Sire. Allerdings ist es, was das Navigieren betrifft, doch recht eintönig. Aber das ist nun einmal alles, was wir in unserem Land haben, und somit bleibt uns keine Wahl.“
Leopold, der das Fehlen einer ernst zu nehmenden belgischen Präsenz auf See als eine nationale Schande betrachtete, fühlte sich durch de Gerlaches Offenheit düpiert.
„Nun ja“, sagte er. „Zumindest im Augenblick.“
Schon kurze Zeit später erhielt de Gerlache das Angebot, bei der Kartierung des Flusssystems im Kongo-Freistaat mitzuwirken, einem Landstrich Zentralafrikas, den Leopold nicht als belgische Kolonie, sondern als sein Privateigentum beanspruchte und zu seiner persönlichen Bereicherung ausbeutete. Mit dieser Mission hätte sich de Gerlache in dieselben undurchsichtigen Verstrickungen manövriert wie Kurtz und Marlow in Joseph Conrads Herz der Finsternis, sich aber zugleich die Gunst Leopolds sichern können, was seiner Karriere äußerst zuträglich gewesen wäre.
Auf die Gefahr hin, den König ein weiteres Mal zu verärgern, lehnte der Leutnant das Angebot ab. Er interessierte sich weder für die Binnenschifffahrt noch für den Kongo, sondern hatte im Geiste bereits Kurs auf kältere Gefilde genommen.
Zwar waren weite Teile der Welt – vor allem in Afrika, Südamerika oder Zentralasien – von europäischen Entdeckern immer noch nicht erkundet worden, doch es gab einen Kontinent, über den kaum jemand überhaupt etwas wusste: die Antarktis. Die südlichste Region der Erde, ein Gebiet mit einer Fläche größer als Nordamerika, war ein weißer Fleck auf der Landkarte geblieben – abgesehen von einigen wenigen kurzen Küstenabschnitten, zu denen einzelne Abenteurer, Walfänger und Robbenjäger vorgestoßen waren, seit man dort 1820 Land entdeckt hatte. Ob es sich bei dem, was jenseits dieser Linie lag, um die offene See, ein Meer aus Eis oder eine riesige Landmasse handelte, war nicht bekannt. Die Antarktis war somit das letzte große geografische Geheimnis.
Nur drei Expeditionen waren auf ihrer Reise nach Süden jemals über den 70. Breitengrad hinausgekommen. Derartige Schiffsreisen waren gefährlich und kostspielig, und die letzte von ihnen lag fast ein halbes Jahrhundert zurück. Weltweit waren die geografischen Gesellschaften übereinstimmend zu der Meinung gelangt, dass es höchste Zeit war für eine neue Ära der Antarktisforschung. De Gerlache, der sich seit jeher von Berichten über Polarabenteuer hatte mitreißen lassen, war fest entschlossen, sich daran zu beteiligen. Als er daher 1891 erfuhr, dass der schwedische Forscher Adolf Erik Freiherr von Nordenskiöld eine Antarktisexpedition plante, bewarb er sich bei ihm und bot an, beim Eintreiben finanzieller Mittel in Belgien behilflich zu sein. Er erhielt keine Antwort auf seinen Brief. Während andere sich dadurch wahrscheinlich hätten entmutigen lassen, erkannte der 25-jährige Leutnant darin eine Chance: Als Nordenskiölds Vorhaben doch nicht zustande kam und kein anderer an seine Stelle trat, reifte die Saat einer vagen Idee, die bei de Gerlache schon vor langer Zeit auf fruchtbaren Boden gefallen war, zu einem Plan heran. Ungeachtet seiner mangelnden Erfahrung beschloss er, selbst eine Expedition auf die Beine zu stellen, die sowohl ihm als auch Belgien Ruhm einbringen würde. Fragen wie Warum ich? oder Warum Belgien? schien er sich dabei nicht zu stellen. Stattdessen fragte er sich: Warum nicht ich? und Warum nicht Belgien?
Eine Entgegnung, die durchaus gerechtfertigt gewesen wäre, betraf die Finanzierung des Vorhabens. Um die nötigen Gelder für die mehrjährige Reise aufzutreiben, würde de Gerlache seinen Landsleuten deutlich machen müssen, dass sich eine Investition in die Unternehmung, aber auch in ihn lohnte. Dies würde eine Werbekampagne erfordern, die ebenso raffiniert und durchdacht sein musste wie die Schiffsmodelle, die er einst gebaut hatte.
De Gerlache war sich darüber im Klaren, dass die potenziellen Geldgeber ihr Vermögen vermutlich nur ungern für etwas riskieren würden, das sich nur allzu leicht als Jugendtraum eines unerfahrenen Kommandanten abtun ließ. Er beschloss daher, an ihren Nationalstolz zu appellieren. Als cleverem Seemann waren ihm die nationalistischen Strömungen, die ganz Europa erfasst hatten, nicht verborgen geblieben; nun würde er sie sich geschickt zunutze machen. Er würde erklären, dass sich Belgien als noch junge Nation kaum eine bessere Gelegenheit erträumen konnte, um die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit zu erregen, als eine Expedition, die die Landesflagge am anderen Ende des Globus hissen und weltweit für Medienberichte sorgen würde.
Der junge Leutnant war außerdem davon überzeugt, dass
er nur dann mit Unterstützung für sein Vorhaben rechnen konnte, wenn er es als wissenschaftliche Expedition deklarierte. Im 19. Jahrhundert war es zu einem regelrechten Entdeckungswahn gekommen: Die Staaten Europas rangen miteinander um mögliche Kolonialgebiete, mit denen sie ihren globalen Einfluss ausweiten und den unersättlichen heimischen Industrien den nötigen Nachschub an Rohstoffen zusichern konnten. Doch das waren nicht die einzigen Aspekte, mit denen Erkundungsreisen gerechtfertigt wurden: Neben Naturwissenschaftlern wie Charles Darwin oder Alexander von Humboldt fanden sich unter den Forschern jenes Jahrhunderts auch Seefahrer, Soldaten, Kaufleute und Missionare. Datenmaterial – über Pflanzen, Tiere, Geologie oder die Bevölkerung – war zu einer ebenso wertvollen Beute geworden wie Gold, Gewürze oder billige Arbeitskräfte in früheren Zeiten. Der Westen hatte die damals bekannte Welt in weiten Teilen erobert, doch nun strebte er danach, sie zu verstehen. Zwischen den geografischen Gesellschaften Europas und Amerikas entwickelte sich ein fairer Wettkampf, dessen begehrte Trophäe der wissenschaftliche Fortschritt war sowie das Recht, sich als Nation damit zu brüsten. Wurden dabei auch noch wertvolle Bodenschätze entdeckt, umso besser.
Auch für de Gerlache mag der wissenschaftliche Anspruch nur ein Mittel zum Zweck gewesen sein, doch er maß ihm immerhin eine so große Bedeutung bei, dass er sich von mehreren namhaften belgischen Gelehrten beraten ließ. Sein Nachname dürfte ihnen nicht fremd gewesen sein, doch von ihm selbst hatten sie noch nie gehört. Dennoch bekundeten sie großes Interesse an seiner Antarktisunternehmung. Mit ihrer Unterstützung konnte de Gerlache einen ausführlichen Antrag verfassen, den er Ende 1894 bei der Königlichen Belgischen Geografischen Gesellschaft in Brüssel einreichte, jener Institution, die über sämtliche Forschungsvorhaben unter belgischer Flagge befand und die Regierung hinsichtlich deren Finanzierung beriet. Das in ordentlicher Handschrift verfasste Dokument wirkte und las sich wie der Aufsatz eines eifrigen Schuljungen. Aus Angst, die Öffentlichkeit könnte sich an seinem jugendlichen Alter stoßen, hatte er einen elaborierten Ton angeschlagen und bemühte die erste Person Mehrzahl, den „Pluralis Majestatis“: „Da alles, was mit dem Wissen über die Polregion in Verbindung steht, seit jeher eine unwiderstehliche Faszination auf uns ausgeübt hat, fragen wir uns, ob es nicht möglich wäre, eine belgische Expedition zur Erkundung des Antarktischen Ozeans zu organisieren.“
Die Gesellschaft lud ihn prompt in den imposanten, neoklassizistischen Akademiepalast im Stadtzentrum von Brüssel ein, wo er seine Pläne vorstellen sollte. So stand de Gerlache mit seinen 28 Jahren am 9. Januar 1895 vor der versammelten graubärtigen Wissenschaftselite Belgiens und präsentierte die Details seines Projekts. Er erklärte, dass es in jüngster Zeit eine wahre Flut von Expeditionsreisen in die Arktis gegeben habe – allein in jenem Jahr wetteiferten nicht weniger als vier um den Nordpol –, „das Südmeer aber ist, zumindest in wissenschaftlicher Hinsicht, noch immer unerforscht“. De Gerlache erläuterte ein umfangreiches Forschungsprogramm mit zahlreichen wissenschaftlichen Beobachtungen, die er durchführen wollte. So plante er unter anderem, zoologische, botanische, ozeanografische und meteorologische Daten zu sammeln, den Erdmagnetismus zu untersuchen und dem bislang nur ansatzweise erklärbaren Phänomen des südlichen Polarlichts auf den Grund zu gehen. Zudem strebte er die kartografische Erfassung des gesamten Küstenverlaufs von der Spitze der Antarktischen Halbinsel bis nach Viktorialand auf der anderen Hälfte der Erdkugel an, wo der furchtlose britische Seefahrer James Clark Ross mehr als fünfzig Jahre zuvor den bis dato ungeschlagenen Rekord von 78° 10’ südlicher Breite aufgestellt hatte.
Die Expedition, die de Gerlache dem Gremium vorschlug, würde knapp zwei Jahre dauern. Sie sollte im September 1896 beginnen, Anfang Dezember die Antarktis erreichen und dann bis Mitte des darauffolgenden Jahres einen steten Kurs Richtung Süden nehmen. De Gerlache plante, den zermürbenden Winter (der zeitlich mit dem Sommer auf der Nordhalbkugel zusammenfällt) in Australien abzuwarten und erst dann in die Antarktis zurückzukehren, wenn im Frühjahr das Meereis aufbrach. Noch nie zuvor hatte ein Mensch den Winter jenseits des südlichen Polarkreises verbracht und miterlebt, wie das Meereis sich verdichtete und die Sonne wochenlang nicht zu sehen war. Auch de Gerlache hatte nicht diese Absicht, doch er hoffte zumindest, dass es ihm mithilfe des richtigen Schiffes gelingen würde, weiter in das Packeis vorzudringen als irgendjemand zuvor.
Als er mit seiner Ansprache geendet hatte, schallte ihm aus dem Auditorium begeisterter Applaus entgegen. Angesteckt von de Gerlaches Unerschrockenheit und jugendlicher Tatkraft, sagten die anwesenden Wissenschaftler unmissverständlich ihre Unterstützung für eine belgische Antarktisexpedition zu.
Um tatsächlich Geschichte zu schreiben – und seinem Vater zu beweisen, dass sein Traum von einer ruhmreichen Seefahrerkarriere nicht unbegründet war –, würde de Gerlache mit einem Rekord oder irgendeinem anderen Novum in der Tasche zurückkehren müssen. Die Polarforschung schien seit Langem allein aus einer Reihe von Heldentaten zu bestehen: Stets war es darum gegangen, wer die höchsten Breiten erreicht, die tiefsten Temperaturen überstanden oder die längsten Distanzen zurückgelegt hatte. Derartige Glanzleistungen faszinierten die Öffentlichkeit und befriedigten das tiefe Verlangen des Menschen, in unbekanntes Territorium vorzudringen.
Auch de Gerlache setzte sich ein solches Ziel, nachdem er sich mit seinen wissenschaftlichen Beratern abgestimmt hatte. Sie waren vor allem an der Untersuchung des Erdmagnetismus interessiert, die er in seiner Präsentation erwähnt hatte. „Allein schon, so etwas zu erwägen“, erklärte der Astronom Charles Lagrange, „wäre eine hinreichende Rechtfertigung für die Durchführung dieser Expedition.“ Lagrange war überzeugt, dass man mit der Entdeckung des magnetischen Südpols, die Ross 1841 nicht gelungen war, zweifellos „Geschichte schreiben“ würde.
Der magnetische Südpol lag der damaligen Auffassung zufolge nahe des 75. Breitengrads. Seine exakte Verortung würde von großem Nutzen sein, denn sie würde den Seeleuten ermöglichen, ihre Kompassmessungen genauer anzupassen. Vor allem aber wäre sie ein wirklicher Erfolg. De Gerlache korrigierte daher die vorgesehene Reiseroute entsprechend: Seinem neuen Plan zufolge sollte ein vierköpfiger Landungstrupp in Viktorialand, genau südlich von Neuseeland, zurückbleiben und dort ein Winterlager errichten. Bei den ersten Frühlingsanzeichen würde er sich dann zum magnetischen Südpol aufmachen.
Die Anerkennung des Vorhabens durch die Geografische Gesellschaft kam genau im richtigen Moment: Erst ein gutes halbes Jahr zuvor, im Juli 1895, war man beim Sechsten Internationalen Geografischen Kongress in London – einer Zusammenkunft aller geografischen Gesellschaften weltweit – übereingekommen, dass der Erforschung der Antarktis höchste Priorität beizumessen sei. In seinem offiziellen Bericht legte der Kongress sogar einen konkreten Zeitpunkt dafür fest: „Diese Aufgabe sollte noch vor dem Ende des Jahrhunderts in Angriff genommen werden.“ Der Wettlauf um die Antarktis hatte begonnen und ließ einen tapferen, nahezu unbekannten jungen Marineoffizier aus Belgien gegen bedeutende Seefahrernationen wie Deutschland, Großbritannien und Schweden antreten, die schon kurze Zeit später ebenfalls ankündigten, Expeditionen zum antarktischen Kontinent entsenden zu wollen.
De Gerlache würde sich beeilen müssen. Dabei gab es jedoch ein nicht unerhebliches Problem: Die Geografische Gesellschaft mochte ihm zwar ihren Segen gegeben haben, die finanziellen Mittel aber stellte sie ihm nicht in Aussicht. De Gerlaches Schätzungen zufolge würden sich die Kosten für die Expedition auf rund 300 000 belgische Franc belaufen (was einem heutigen Wert von 1,5 Millionen Euro entspricht). Seine wissenschaftlichen Berater erachteten diesen Betrag als deutlich zu niedrig – tatsächlich entsprach er nur einem Bruchteil des Budgets, das manche der anderen weltweit geplanten Antarktisexpeditionen beantragten; de Gerlache aber glaubte, es könne nur von Vorteil sein, wenn sich die Finanzierung auch realisieren ließe.
So begann er also mit seiner Suche nach einem vermögenden Gönner. Zunächst wandte er sich an den wohl prominentesten Bürger des Landes, König Leopold höchstpersönlich. Immerhin – so glaubte er – könnte die Aussicht, dass ein neu entdecktes Land nach ihm benannt werden würde, für den Monarchen durchaus reizvoll sein. Er ließ dem Palast einen Prospekt über die geplante Expedition zukommen, erhielt jedoch keine Antwort. Vermutlich war König Leopold immer noch verstimmt, weil sich der Leutnant gegen eine Teilnahme an seinem Kongoprojekt entschieden hatte.
De Gerlache ließ sich nicht beirren und versuchte es als Nächstes bei diversen Mitgliedern der belgischen Oberschicht, wobei ihm die zahlreichen guten Beziehungen seiner Familie von Nutzen waren. Vom vornehmen Stadthaus seiner Eltern in einem grünen Brüsseler Vorort aus begann er eine aufwendige Werbekampagne. Als Antwort auf seine Briefe erhielt er eine Flut aufrichtiger Ermutigungen, aber kein Geld.
Er wollte die Hoffnung schon fast aufgeben, als ihm endlich ein Betrag von 25 000 Franc in Aussicht gestellt wurde. Der edle Spender war der 57-jährige Soda-Tycoon Ernest Solvay, angeblich der reichste Mann Belgiens, der einen erheblichen Anteil seines Vermögens dem wissenschaftlichen Fortschritt überantwortete. De Gerlaches Wagemut gefiel ihm und erinnerte ihn vielleicht auch daran, wie er selbst sich einst aus eigener Kraft hochgearbeitet hatte. Mit Solvays Kreditangebot schien eine belgische Antarktisexpedition auf einmal mehr zu sein als ein bloßer Wunschtraum. Schon bald folgten andere Geldgeber Solvays Vorbild, was de Gerlache ermutigte, sich nach einem Schiff umzuschauen – der größte Posten in seinem Finanzplan.
Ursprünglich hatte er mit dem Gedanken gespielt, das Schiff exakt nach seinen Bedürfnissen fertigen zu lassen, doch schon bald musste er feststellen, dass die Kosten dafür sein Budget gesprengt hätten. Daher entschied er sich, ein Schiff zu erwerben oder auch nur zu pachten, das sich bereits unter polaren Bedingungen bewährt hatte, was vermutlich ohnehin klüger wäre. In belgischen Werften wurde er nicht fündig, weshalb er weiter nördlich, in Schottland und Norwegen, nach einem Schiff suchte, das dafür gemacht war, sich dem Würgegriff des Eises zu widersetzen. Im März 1895 ging er auf Einladung eines Schiffsmaklers für drei Monate an Bord der Castor, eines stattlichen norwegischen Dreimasters mit Dampfantrieb, vor der Küste Grönlands auf Wal- und Robbenfang. Das Schiff war erst zwei Jahre zuvor in antarktischen Gewässern unterwegs gewesen und stand nun zum Verkauf. Die Reise diente zwei Zielen: Sie gab de Gerlache die Möglichkeit, sich mit dem Schiff vertraut zu machen und sich zugleich Grundkenntnisse des Navigierens in der Polarregion anzueignen. Obwohl er jahrelang zur See gefahren war, wusste er nichts über das ewige Eis.
Die arktische Jagdsaison war ertragreich, und de Gerlache konnte – wenn auch mit einigem Unbehagen – mitverfolgen, wie Entenwale zerlegt und Tausende von Heulern, deren unglaublich weiches Fell sie äußerst begehrt machte, mit Keulen erschlagen wurden. In den Gewässern waren auch noch andere Robbenfänger unterwegs, und obwohl de Gerlache eigentlich an der Castor interessiert war, warf er doch auch den ein oder anderen heimlichen Blick auf die Konkurrenz. Vor Jan Mayen, einer kleinen Vulkaninsel im Arktischen Ozean, auf halber Strecke zwischen Norwegen und Grönland, erregte eine elf Jahre alte Bark mit dem Namen Patria seine Aufmerksamkeit. Von der Form her war sie weitaus weniger ansprechend als die Castor und stellte mit ihren dreißig Metern Länge und 244 Tonnen Gewicht zudem das kümmerlichste Schiff der norwegischen Walfangflotte dar, doch de Gerlache staunte, wie gewandt sie sich im Eis bewegte und als wie robust sie sich erwies, wenn sie an Eisbergen entlangschrammte oder auf Packeisplatten hinaufglitt, um sie dann unter ihrem Gewicht zerbersten zu lassen. Sie hatte es ihm augenblicklich angetan, doch als er sich diskret nach ihrem Preis erkundigte, hieß es, sie sei unverkäuflich – was ohnehin keine Rolle spielte, denn trotz der Zusagen von Solvay und anderen Förderern verfügte de Gerlache lediglich über einen Bruchteil der Summe, die er für den Kauf eines Schiffes benötigen würde.
So kehrte de Gerlache im August 1895 ohne Schiff nach Belgien zurück. Es schien, als würde sein großes Projekt nun doch scheitern. Auch ein Jahr nach Antragstellung existierte die Belgische Antarktis-Expedition lediglich auf dem Papier und ihre Mannschaft aus niemandem außer ihm selbst. De Gerlache wusste nicht, wen er als potenziellen Gönner noch hätte ansprechen können. Seine Pläne jedoch aufzugeben, jetzt, wo er sein kühnes Vorhaben vor der gesamten belgischen Öffentlichkeit so vollmundig angekündigt hatte, und Ernests Solvays Angebot auszuschlagen wäre eine unerträgliche Demütigung.
Da sowohl sein Appell an den König als auch der an die Regierung erfolglos geblieben waren, wandte sich de Gerlache direkt an seine Landsleute. Mithilfe der Königlichen Belgischen Geografischen Gesellschaft startete er im Januar 1896 eine landesweite Spendenkampagne zur Finanzierung der Expedition. Schon bald flossen Beiträge jeder Größenordnung: Ein Lehrer spendete einen Franc, ein Briefträger drei, ein Senator tausend. Die Gesellschaft und auch zahlreiche weitere Befürworter und Förderer wie Léonie Osterrieth organisierten im ganzen Land Benefizveranstaltungen, darunter Konzerte, Vorträge, ein Radrennen und Flüge mit dem Heißluftballon.
Insgesamt beteiligten sich 2500 Belgier an der Spendenaktion, mit der bis zum Mai 1896 ein Erlös von insgesamt 115 000 belgischen Franc erzielt wurde. Jetzt, wo de Gerlaches Pläne allmählich Gestalt annahmen, öffnete auch die Regierung endlich ihre Schatulle: Im Juni stimmten beide Kammern des Parlaments der Gewährung eines zusätzlichen Kredits über 100 000 Franc zu. Mit einem Mal hatte die Expedition eine neue Dimension erreicht, die de Gerlache mit Begeisterung, aber auch mit Sorge erfüllte. Diese Geldbeträge waren mehr als nur ein Zuschuss zu seinem Antarktistraum. Die Reise, die jahrelang lediglich in seiner Fantasie existiert hatte, war nun auch in der Vorstellung seiner Landsleute zum Leben erwacht und weckte damit auch deren Verlangen, ein Stück vom erhofften Ruhm abzubekommen. Er war auf dem besten Weg, seinen Traum zu verwirklichen, hatte damit aber auch im ganzen Land eine emotionale Beteiligung erzeugt, die er irgendwann würde zurückzahlen müssen. Diese Bürde sollte ihn von nun an ständig begleiten, seine Entscheidungen beeinflussen und seine glühenden Ambitionen mit der Furcht vor einem schändlichen Versagen überschatten.
Ab diesem Augenblick, das wurde de Gerlache schnell klar, war die Expedition nicht länger nur seine Angelegenheit. Den widersprüchlichen Erwartungen der Geografischen Gesellschaft (die auf äußerster wissenschaftlicher Genauigkeit bestand), seiner Geldgeber (die ihre Investition gut angelegt wissen wollten), der erfolgshungrigen Öffentlichkeit (die nach todesverachtenden Heldentaten verlangte) und seiner eigenen Familie (die darauf vertraute, dass er ihren guten Ruf nicht beschädigte) gerecht zu werden sollte sich letztlich als ein unmöglicher Balanceakt erweisen.
Endlich hatte de Gerlache genügend Geld, um ein Schiff zu kaufen. Mithilfe eines Mittelsmannes – Johan Bryde, der norwegischstämmige Direktor der belgischen Botschaft in Sandefjord – gab er ein Angebot für die Patria ab, jenes Schiff, das seine Avancen noch im Jahr zuvor zurückgewiesen hatte. Als geschicktem Verhandler gelang es Bryde, sie für 70 000 Franc zu erwerben. Im Sommer 1896 reiste de Gerlache ins norwegische Sandefjord, um seine neue Errungenschaft in Empfang zu nehmen. Er spürte die Schiffsplanken unter seinen Füßen und ließ seine Hand über das Schandeck gleiten. Endlich besaß er ein Schiff, das er sein Eigen nennen durfte – das erste seit den Modellschiffen seiner Jugend. Am 5. Juli gab er der Bark den Namen Belgica.
Eigentlich hatte de Gerlache sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Weg Richtung Antarktis befinden wollen, doch er war noch längst nicht aufbruchbereit. Da er um jeden Preis verhindern musste, die Antarktis im schrecklichen Südwinter zu erreichen, sah er sich gezwungen, die Abreise um ein ganzes Jahr zu verschieben.
De Gerlache blieb mehrere Monate in Sandefjord, um die für die Reise erforderlichen Umbauten an der Belgica zu beaufsichtigen. In jener Zeit sollte er auch fließend Norwegisch lernen. Der Schiffsrumpf wurde zum Schutz vor den heftigen Attacken des Eises mit dem widerstandsfähigsten Holz ummantelt, das sich auftreiben ließ, tropischem Grünherzholz. Außerdem ließ de Gerlache den Schiffsbauer Lars Christensen (der zufällig Brydes Schwiegervater war) im Inneren des Schiffes mehrere Schichten Filz und Holz anbringen, als Isolierung und zum Schutz vor Schiffsbohrwürmern. Christensen baute darüber hinaus einen neuen Motor ein sowie eine zusätzliche Schiffsschraube aus Stahl, die sich einklappen ließe, falls das Schiff vom Eis eingeschlossen werden sollte. Er erweiterte das Achterdeck und richtete eine Offiziersmesse sowie eine Dunkelkammer ein, in der Fotoplatten entwickelt werden konnten. Zu guter Letzt baute er auf Deck zwei Labore, die de Gerlache mit hochmodernen wissenschaftlichen Geräten aus ganz Europa ausstattete. Als Christensen seine Arbeiten beendet hatte, war die Bark von der speckigen Patina und dem durchdringenden Trangestank gänzlich befreit. Die Belgica erstrahlte in neuer Pracht und sah fast aus wie eine Vergnügungsjacht.
Nun, da de Gerlache endlich sein Schiff hatte, galt es, die Besatzung aus Wissenschaftlern und Seeleuten zusammenzustellen. Dabei stieß er auf ein Problem, mit dem er noch lange nach dem Auslaufen zu kämpfen haben würde, auch wenn es wesentlich leichter zu überwinden war, als er zu diesem Zeitpunkt glaubte. De Gerlache, der den Verlust seiner Ehre mehr fürchtete als den Tod, hatte eine fast schon pathologische Angst vor der hurrapatriotischen belgischen Presse entwickelt, die ihn seiner Ansicht nach in der Luft zerreißen würde, falls die Besatzung des Schiffes nicht ausnahmslos aus stolzen Belgiern bestehen würde. Diese Forderung zu erfüllen war jedoch so gut wie unmöglich. Angesichts der dürftigen maritimen Tradition seines Heimatlandes konnte de Gerlache kaum darauf hoffen, genügend erfahrene belgische Matrosen für seine Expedition aufzutreiben. Außerdem würde die Reise, die er sich vorgenommen hatte, nicht nur gefährlich sein, sondern auch wenig einträglich. Belgier, die auf Abenteuer aus waren, würden ihr Glück vermutlich eher im Kongo versuchen. Und auch wenn es dem Land nicht an guten Wissenschaftlern mangelte, waren die besten bereits anderweitig untergekommen. Kurz nachdem die Expedition erstmals angekündigt worden war, hatte de Gerlache begeisterte Zusagen mehrerer bedeutender Wissenschaftler erhalten, doch als die Vorbereitungen sich in die Länge zogen, war einer nach dem anderen wieder abgesprungen. Sie waren enttäuscht gewesen wegen der Verzögerungen und misstrauisch gegenüber dem ihrer Meinung nach dürftig ausgestatteten und schlecht organisierten Vorhaben.
Der Einzige, der de Gerlache die Treue gehalten hatte, war Emile Danco, einer seiner ältesten Freunde, der ihn im vergangenen Jahr bereits bei seiner Reise an Bord des Walfängers begleitet hatte. Beide waren zurückhaltende, behütet aufgewachsene Offizierssöhne und hatten daher schnell zueinandergefunden. Während de Gerlache jedoch weiterhin eine Karriere bei der Marine anstrebte, war Danco in die belgische Armee eingetreten und zum Artillerieleutnant aufgestiegen. Mit seiner kräftigen Statur und dem markanten Kinn, das ihm ein attraktives Aussehen verlieh, gab er zwar ein glaubwürdiges Bild von einem Antarktisabenteurer ab, war aber weder Wissenschaftler noch Matrose.
Was ihm an Qualifikationen fehlte, machte er jedoch durch Begeisterung wett. Seine Mutter war gestorben, als er noch ein Kind gewesen war; nach dem Tod seines wohlhabenden, aber tyrannischen Vaters war ihm ein erkleckliches Erbe geblieben – ebenso wie der dringende Wunsch, die Welt außerhalb Belgiens kennenzulernen. Er war zweifellos der engagierteste Begleiter, den de Gerlache sich vorstellen konnte. Danco verzichtete nicht nur auf eine Entlohnung, sondern bot sogar an, mehrere Tausend Francs zu der Expedition beizusteuern. Sobald die Aufgabenverteilung offiziell feststand – wofür ein besonderer, von Leopold II. unterzeichneter militärischer Dispens erforderlich war –, ging er dazu über, seinen Jugendfreund als „mon commandant“ anzusprechen, und wechselte vom familiären tu (du) zum respektvolleren vous (Sie).
Doch zwei Männer machten noch keine vollständige Besatzung aus. Vor die Wahl gestellt, entweder mehrere Ausländer zu rekrutieren oder sich mit unerfahrenen Belgiern abzufinden, um die Reise nicht noch einmal verschieben oder ganz absagen zu müssen, beschloss de Gerlache, das Risiko einzugehen und sich in der Frage des Patriotismus auf einen Kompromiss einzulassen. Verließ er sich gänzlich auf eine schlecht vorbereitete belgische Mannschaft, dann wäre die Expedition von vornherein zum Scheitern verurteilt, und ohne Wissenschaftler zu einer wissenschaftlichen Mission aufbrechen, das konnte er auch nicht. So wurde die Belgische Antarktis-Expedition mangels Alternativen zu einer internationalen Unternehmung – was ihr eindeutig zugutekam.
Der Zweite, den de Gerlache anheuerte, war Henryk Arctowski, ein hervorragender, aber mittelloser polnischer Chemiker und Geologe, der mit der Universität Lüttich zusammenarbeitete. Arctowski war ein Mann, den sein ernstes Auftreten, die stets tadellosen Anzüge, der Rauschebart und seine umfassende Publikationsliste wesentlich älter erscheinen ließen als 23 Jahre. Erst viele Monate später gestand er de Gerlache, dass er eigentlich gar kein Diplom besaß: „Ich muss Ihnen mitteilen, dass ich über keinen akademischen Titel verfüge“, schrieb er ihm. „Mein Studienverlauf war bisher ziemlich unkonventionell, und ich bin noch immer weit von dem Ziel entfernt, das ich mir gesetzt habe.“ De Gerlache hatte zu wenig Alternativen, um besonders wählerisch zu sein. Arctowski behielt also seinen Posten. Die Belgica würde sein Diplom werden.
Aufwendiger gestaltete sich für de Gerlache die Suche nach einem Zoologen. Emile Racovitza, 27 Jahre alt, stammte aus einer wohlhabenden rumänischen Familie und studierte an der Pariser Sorbonne, wo er mit seinen außergewöhnlichen Arbeiten über die ozeanische Fauna, insbesondere über Seewürmer, großen Eindruck bei seinen Professoren hinterlassen hatte. Arctowski hatte ihn vorgeschlagen, auch wenn die beiden Männer kaum unterschiedlicher hätten sein können. Ihre Persönlichkeit spiegelte unübersehbar das von ihnen gewählte Fachgebiet wider: Während der Geologe eine spröde, unnachgiebige Art besaß, zeigte der Zoologe sich äußerst lebendig und von einer warmen Herzlichkeit. Ebenso reizvoll aber mag für de Gerlache die Tatsache gewesen sein, dass Racovitza anbot, ohne Heuer für ihn zu arbeiten.
Und dann fehlte noch die eigentliche Schiffsbesatzung. Die wenigen Belgier, die de Gerlache im Laufe des Jahres in die Mannschaft hatte einschleusen können, waren eigentlich nicht erste Wahl. Zu ihnen gehörten der Marinemechaniker Joseph Duvivier, dessen vorgesetzter Offizier ein Empfehlungsschreiben verfasst hatte, das sich eher wie eine Warnung ausnahm: „Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass es Mr. Duvivier möglicherweise gelingt, einen sehr einfachen Motor wie den der Belgica in Betrieb zu nehmen, doch garantieren kann ich es Ihnen nicht.“ De Gerlache stellte den Mann ein.
Ein weiterer belgischer Bewerber war Louis Michotte, ein Tunichtgut von 28 Jahren, der bei der französischen Fremdenlegion diente und gerade von einem fünfjährigen Einsatz aus Afrika zurückgekehrt war, währenddessen ein Einheimischer ihm einen Daumen abgebissen hatte. „Als junger Mann habe ich ein paar Jugendsünden begangen“, schrieb er de Gerlache, „die mein Vater mir heute noch vorhält, aber wenn ich Sie in irgendeiner Funktion begleiten könnte, Sir, dann darf ich hoffen, dass er mir verzeiht, und Sie, Sir, könnten eine gute Tat für sich verbuchen.“ Auf seiner Liste von Fähigkeiten, die ihn für die Antarktisforschung qualifizierten, nannte Michotte auch seine Fechtkünste. De Gerlache heuerte ihn ebenfalls an.
Der Großteil seiner Mannschaft aber musste aus verlässlichen Männern bestehen, die in der Lage waren, ein Schiff durch Eis und Stürme zu steuern. Norwegen mit seiner florierenden Schifffahrtsindustrie und außergewöhnlich langen Küstenlinie, seiner Wikingertradition und den zahllosen Meeresmythen war der ideale Ort, um nach ihnen Ausschau zu halten. Es war nahezu unmöglich, einen Norweger zu finden, der nichts von Schiffen verstand. Während seines Aufenthalts mit der Belgica in Sandefjord hatte de Gerlache bereits einige interessierte Nordländer verpflichten können – altgediente Arktisveteranen ebenso wie jugendliche Neulinge.
Ende Juli 1896 erhielt er einen Brief, der seine Aufmerksamkeit erregte:
An Leutnant A. de Gerlache,
wie ich soeben erfahren habe, beabsichtigen Sie, erst im nächsten Jahr zu Ihrer Antarktisexpedition aufzubrechen. Ich möchte mich daher erkundigen, ob es in der Mannschaft für Ihre Expedition noch eine offene Stelle gibt. Sollte dies der Fall sein, würde ich mich gerne um eine Anstellung als Matrose bewerben.
Ich bin 24 Jahre alt und war 1894 mit Kapitän Stöcksen auf der Magdalena im Eismeer unterwegs und dieses Jahr unter Kapitän Evensen an Bord der Jason.
Ich verfüge über einen Abschluss an der Mittelschule, das Abitur sowie ein Zeugnis der Seefahrtschule. Ich besitze ein einwandfreies Gesundheitszeugnis. Außerdem möchte ich hinzufügen, dass ich Erfahrung im Skifahren habe und schon mehrere anspruchsvolle Skitouren im Hochgebirge unternommen habe.
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie so freundlich wären, mir bald zu antworten …
Roald Amundsen
De Gerlache war begeistert und erklärte sich sofort zu einem persönlichen Treffen mit Amundsen bereit. Der Mann, den er kennenlernte, schien direkt einem der Abenteuerromane entsprungen zu sein, die er als Kind gelesen hatte. Mit seinen 1,80 Metern, neunzig Kilogramm und den scharf geschnittenen Gesichtszügen sah Amundsen aus wie ein moderner Wikinger. Besonders beeindruckt war de Gerlache von den Fähigkeiten als Langläufer, die Amundsen für sich beanspruchte. Das Skifahren war erst vor Kurzem jenseits seiner Ursprungsregion, dem skandinavischen Hinterland, populär geworden, und wenn de Gerlache den magnetischen Südpol erreichen wollte, brauchte er unbedingt einen geübten Skifahrer an seiner Seite. Verlockend war auch, dass Amundsen ebenso wie Danco und Racovitza keine Entlohnung erwartete. Für ihn zählte einzig und allein, dabei sein zu können.
Es war Bryde gewesen, der de Gerlache Amundsens Bewerbung hatte zukommen lassen. In eine Ecke des Schreibens hatte der Diplomat eine begeisterte Notiz an den Kommandanten gekritzelt: „Nehmen Sie ihn, mein Freund!“ De Gerlache war auf ein wahres Juwel gestoßen. Das Beurteilen anderer war nie seine Stärke gewesen, doch bei dem Norweger erkannte selbst er sofort, dass dessen Talent als gewöhnliches Mitglied der Besatzung vergeudet wäre. Obwohl Amundsen sich als einfacher Matrose beworben hatte, ernannte de Gerlache ihn zum Ersten Offizier, eine Position, in der er den maritimen Gepflogenheiten zufolge den Kommandanten der Belgica beerben würde. Dass im Notfall ein Norweger das Kommando übernehmen sollte, war alles andere als ideal. Danco befürchtete sogar, dies könnte dazu führen, dass die norwegischen Besatzungsmitglieder sich nicht mehr loyal gegenüber de Gerlache zeigten oder vielleicht sogar eine Meuterei anzettelten.













DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.