

Jahrhundertzeuge Ben Ferencz Jahrhundertzeuge Ben Ferencz - eBook-Ausgabe
Chefankläger der Nürnberger Prozesse und leidenschaftlicher Kämpfer für Gerechtigkeit
— Die erste umfassende Biografie über Benjamin Ferencz„Dieses Buch über einen Helden der Gerechtigkeit, der so gut wie alles im blutigsten aller Jahrhunderte gesehen hat, ist eine ebenso aufrüttelnde wie spannende Geschichtsstunde, die auch heute ins Mark trifft.“ - Der Tagesspiegel
Jahrhundertzeuge Ben Ferencz — Inhalt
Benjamin Ferencz - Der Mann, der SS-Generäle jagte, Opfer entschädigte und für den Weltfrieden kämpft
Es war ein Sensationsfund: Der Jurist Ben Ferencz entdeckte nach dem Zweiten Weltkrieg einen Ordner mit minutiös aufbereiteten SS-Ereignismeldungen – eine Chronik des Massenmords. Der daraus folgende Einsatzgruppenprozess in Nürnberg, in dem Ben Ferencz mit gerade einmal 27 als Chefankläger auftrat, gilt als größter Mordprozess der Geschichte. Auch später prägte er wichtige Etappen der Zeitgeschichte an vorderster Front, von der Wiedergutmachungspolitik der BRD bis zum Aufbau des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag. Philipp Gut hat Gespräche mit Ben Ferencz geführt und lässt anhand der Biografie dieses faszinierenden Jahrhundertzeugen die Geschichte des 20. Jahrhunderts lebendig werden.
„Der Portraitierte äußerte gegenüber seinem Biographen die Hoffnung, dass dieses Buch die Leser ›informieren, unterhalten und inspirieren‹ wird. Das tut es auf jeden Fall. Benjamin Ferencz ist ein Vorbild.“ ― br.de
- Basierend auf persönlichen Gesprächen mit Ben Ferencz
Leseprobe zu „Jahrhundertzeuge Ben Ferencz“
Mehr als ein Anfang
Als ich Benjamin B. Ferencz im März 2018 das erste Mal traf, hätten wir beide nicht gedacht, dass sich daraus eine intensive Zusammenarbeit und schließlich sogar eine Biografie entwickeln würde. Vermittelt durch die damalige liechtensteinische Außenministerin Aurelia Frick, die Ferencz von seinem völkerrechtlichen Engagement bei der UNO in New York kannte, besuchte ich ihn für einen Zeitschriftenartikel an seinem Zweitwohnsitz in Delray Beach, Florida. Er wohnte dort in den Wintermonaten in einer Seniorensiedlung mit kleinen Bungalows [...]
Mehr als ein Anfang
Als ich Benjamin B. Ferencz im März 2018 das erste Mal traf, hätten wir beide nicht gedacht, dass sich daraus eine intensive Zusammenarbeit und schließlich sogar eine Biografie entwickeln würde. Vermittelt durch die damalige liechtensteinische Außenministerin Aurelia Frick, die Ferencz von seinem völkerrechtlichen Engagement bei der UNO in New York kannte, besuchte ich ihn für einen Zeitschriftenartikel an seinem Zweitwohnsitz in Delray Beach, Florida. Er wohnte dort in den Wintermonaten in einer Seniorensiedlung mit kleinen Bungalows und künstlich angelegten Teichen. Doch die Gespräche mit ihm verliefen gleich so animiert, dass er bald die beiläufige Bemerkung fallen ließ, ich hätte ja schon fast das Material für ein ganzes Buch beisammen. Das war zwar reichlich optimistisch, aber der Gedanke ließ mich nicht mehr los. Der alte Mann war mir auf Anhieb sympathisch, und die Faszination, aber auch der Respekt für sein außergewöhnliches Leben wuchsen, je mehr ich davon erfuhr. Das positive Echo auf den journalistischen Bericht über ihn ermunterte mich dann dazu, das Projekt in Angriff zu nehmen. Ferencz sicherte sofort seine Unterstützung zu, obwohl er wusste, dass es auch für ihn einige Arbeit bedeuten würde. Dabei ging es ihm nie um seine Person – er war in seiner langen Karriere schon genug im Rampenlicht gestanden –, sondern um die Weiterverbreitung seiner Ideen und Anliegen.
Was er propagierte, ging unmittelbar aus seinen eigenen Erfahrungen hervor. Im Jahr 1947 – mit gerade einmal siebenundzwanzig – war er nämlich Chefankläger im größten Mordverfahren der Geschichte geworden. Bei den Nürnberger Nachfolgeprozessen brachte er hochrangige SS-Offiziere vor Gericht, die im Zweiten Weltkrieg mit ihren Killerkommandos – den sogenannten Einsatzgruppen – in der von der Wehrmacht eroberten Sowjetunion über eine Million Menschen ermordet hatten. Mit der Verfolgung der Täter sah der brillante Jurist seine Mission jedoch mitnichten als beendet an. Er setzte sich in der Nachkriegszeit im Rahmen der Wiedergutmachungspolitik der Bundesrepublik vehement für die Entschädigung der Opfer des Nationalsozialismus ein und gehörte zu den maßgeblichen Promotoren des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag. Das alles gehörte für ihn untrennbar zusammen. Nürnberg war ein Meilenstein der Rechtsgeschichte – aber die damals angestoßene Entwicklung musste weitergehen.
Der Ideenreichtum und die Konsequenz, mit denen Ferencz seine weit gesteckten Ziele verfolgte, beeindruckten mich tief. Ich empfand es als Privileg, einem der letzten großen Augenzeugen der Weltkriegsepoche zu begegnen, der, wie er selbst sagt, einen „Blick in die Hölle“ getan hat – und seither alles daransetzte, eine Wiederholung solcher Gräuel zu verhindern. Hörte ich ihm zu, wie er auf seine unverwechselbar lebendige und anschauliche Art den ungeheuren Erfahrungsschatz seines beinahe hundertjährigen Lebens ausbreitete, kam es mir vor, als ob ich im Theater der Geschichte in der ersten Reihe säße.
Die Darstellung in diesem Buch beruht – neben Ferencz’ Studien und den autobiografischen Aufzeichnungen, die er unter dem Titel Benny Stories im Internet veröffentlicht hat – auf zwei Hauptquellen. Zum einen auf ebenjenen Gesprächen, die ich im März 2018 und nochmals Ende Januar 2019 mit Ferencz in Florida geführt habe. In den mehrtägigen Treffen verblüffte er mit seiner mentalen Frische und einem annähernd fotografischen Gedächtnis. Im Hintergrund lauschte seine Frau Gertrude, die an Alzheimer litt. Er kümmerte sich liebevoll um sie, nebst einer Krankenpflegerin, die regelmäßig vorbeikam. An den Diskussionen beteiligte sie sich nicht mehr; aber wenn er etwas Lustiges erzählte, lachte sie unverhofft mit. Sie kannten und liebten sich nun schon seit über achtzig Jahren. Zu diesem Zeitpunkt war Ferencz längst der letzte lebende Chefankläger der Nürnberger Prozesse und ihr lebendiges Symbol. Es ist nicht unbedingt selbstverständlich, dass er mich in diesem hohen Alter empfangen hat – und so die Leserinnen und Leser an seinen Erinnerungen und Gedanken teilhaben lässt.
Die zweite wichtige Quelle ist das umfangreiche Privatarchiv, das Ferencz dem United States Holocaust Memorial Museum (USHMM) in Washington vermacht hat. Es umfasst Briefe, Tagebücher, offizielle Dokumente, Zeitungsausschnitte, Fernseh- und Radiointerviews, Fotografien und anderes. Im Januar 2019 durfte ich mich während des „Government Shutdown“ in die dort lagernden Schätze vergraben, Originale sichten und Mikrofilme kopieren.
In Amerika genießt Ben Ferencz so etwas wie einen Kultstatus – zum Beispiel als Held mehrerer Fernseh- und Kinodokumentationen. Da sein Werdegang aber aufs Engste mit der deutschen Geschichte verknüpft ist, scheint es an der Zeit, dass er nun auch im deutschen Sprachraum jene Aufmerksamkeit erhält, die er meiner Ansicht nach verdient. Ben Ferencz selbst hofft, dass dieses Buch zukünftige Leser „informieren, unterhalten und inspirieren“ werde.
Wenn Ferencz im Zusammenhang mit einer Geschichte, deren Dreh- und Angelpunkt der Holocaust an den europäischen Juden ist, von „unterhalten“ spricht, ist das kein Zufall – und auch kein Fauxpas. So fürchterlich die Verbrechen waren, deren Zeuge er wurde, so unerschütterlich sind sein Humor und sein Glaube an die Werte von Toleranz und Mitgefühl. Als Handelnder und Chronist eines Zeitalters der Extreme verbindet sich in ihm die große Geschichte mit vielen kleinen Anekdoten. Sie erheitern den Geist und sorgen für Entspannung. „Das Leichte schwer, das Schwere leicht“, ist ein ästhetischer Grundsatz, dem er sicher ohne Zögern zustimmen würde.
Verschiedene Personen haben bei der Realisierung des Projekts entscheidend mitgeholfen. Wertvolle Unterstützung erhielt ich jederzeit von Donald Ferencz, Benjamins Sohn; er war Reiseleiter und Türöffner in Amerika. Henry Mayer, Liviu Carare, Nancy Hartman, Anatol Steck und Anna Cave vom United States Holocaust Memorial Museum leisteten unverzichtbare Dienste bei den Recherchen in der „Benjamin B. Ferencz Collection“. Mayer stellte sich auch als Chauffeur zur Verfügung, um den Teil der Akten zu erreichen, die im Shapell Center aufbewahrt werden, einem modernen Archiv- und Forschungszentrum im Niemandsland außerhalb von Washington. Inga Huber begleitete den Schreibprozess administrativ und inhaltlich. Last but not least bleibt „Ben“ – wie er allgemein genannt wird – selbst zu erwähnen. Ohne seine aktive Mitwirkung und geduldige Bereitschaft, die Geschichte seines bewegten Lebens zu erzählen, wäre Jahrhundertzeuge Ben Ferencz in dieser Form nicht möglich gewesen. Seine fesselnden Schilderungen und sein gewinnendes, charmantes Wesen werde ich nie vergessen. Wenn etwas davon auch auf den folgenden Seiten aufschiene, wäre das mehr als nur ein schöner Anfang.
Lenzburg, im Februar 2020
Philipp Gut
Von Hell’s Kitchen nach Harvard
Baby fast über Bord
Es begann mit einer Falschmeldung. Als Benjamin Berell Ferencz, von seiner Familie „Benny“ genannt, am 29. Januar 1921 auf Ellis Island vor New York landete, registrierte ihn die Einwanderungsbehörde irrtümlicherweise als vier Monate altes Mädchen namens Bela. Außer dem Zivilstand – unverheiratet – stimmte daran nichts. Er hieß erstens nicht Bela, war zweitens kein Mädchen und drittens nicht vier Monate alt – sondern schon bald einjährig. Geboren worden war er am 11. März 1920 in einem einfachen Bauernhaus im Ort Şomcuta Mare (deutsch Großhorn) in Transsilvanien. Das Gebiet, in dem eine relativ starke jüdische Minderheit lebte, gehörte ursprünglich zum Königreich Ungarn. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde es Rumänien zugeschlagen. Aus den Erzählungen seiner Verwandten erfuhr Ben später, dass der verbreitete Antisemitismus ein Grund für die Emigration nach Amerika gewesen sei. Der andere war die Armut. Da half auch der Name Ferencz nichts, den die Familie mit dem Habsburgerherrscher Franz Josef teilte; denn Ferencz, üblicherweise ein Vorname, bedeutet so viel wie Franz.
Der kleine Blondschopf mit den wachen blauen Augen reiste in Begleitung seines Vaters, seiner Mutter, seiner Schwester Pepi, die knapp zwei Jahre älter war als er, und eines Onkels namens Leppold. Die winterliche Atlantiküberfahrt in der dritten Klasse war furchtbar gewesen. Ben heulte die ganze Zeit, vor Hunger oder Kälte oder beidem zusammen. Das ständige Geschrei brachte den Vater derart außer sich, dass er in seiner Verzweiflung das Baby beinahe über Bord geworfen hätte. Leppold, der älteste der fünf Brüder von Bens Mutter, konnte ihn im letzten Augenblick daran hindern.
Der Vater trug schweres Gepäck mit sich: Amboss, Hammer, Spezialwerkzeug. Er war Schuhmacher und stolz darauf, aus einem einzigen Stück Kuhhaut ein Paar Stiefel herstellen zu können. Obwohl er in seiner Kindheit ein Auge verloren und kaum Schulbildung genossen hatte, hoffte er, in der Neuen Welt Erfolg zu haben. Doch wie er bald feststellen musste, verlangte in New York niemand nach seinen handgefertigten Produkten in alteuropäischem Stil. Die Amerikaner trugen moderne Schuhe, massenhaft von Maschinen fabriziert, die er nicht zu bedienen wusste. Nachdem eine jüdische Hilfsorganisation den Ankömmlingen einige Wochen lang ein Dach über dem Kopf zur Verfügung gestellt hatte, war der Vater deshalb froh, eine Stelle als Hauswart in einem alten New Yorker Mietshaus zu finden. Es lag in einem Distrikt, der als Hell’s Kitchen, Teufelsküche, bekannt war. Die Bezeichnung kam nicht von ungefähr – die Gegend war berüchtigt für ihre hohe Kriminalitätsrate. Die Familie bezog eine kleine, dunkle Wohnung im Kellergeschoss.
Es war der Ort, an dem Bens Erinnerungen an die Welt begannen. „Ich war etwa drei Jahre alt, als mein Geist aus seinem Kokon schlüpfte.“ In seinem Kopf speicherten sich Bilder eines Herds mit Holzfeuerung, eines Spülbeckens, in dem Lumpen, Kleider und Kinder gewaschen wurden, oder eines Gaslichts, das mit einem Zündholz zu entfachen war. Nischen dienten als Schlafplätze, auch für zahlende Gäste. Um etwas zusätzliches Geld zu verdienen, beherbergte die Mutter nämlich europäische Einwanderer für einen bescheidenen Preis. Sein Bett musste Ben nicht selten mit seiner Schwester oder gar den Fremden teilen. Andere Teile des Kellers dienten als Rückzugsort für „Alkoholiker und streng riechende Vaganten“. Die Mutter, die Jiddisch mit ihm sprach, wenn sie nicht gerade auf Ungarisch oder Rumänisch mit ihm schimpfte, mahnte Ben, sich von den „Faulenzern“ fernzuhalten. „Ich lernte, dass ›leben und leben lassen‹ die beste Politik war.“
In diese Tage der frühen Kindheit reichen auch seine ersten religiösen Erfahrungen zurück. Die Eltern waren orthodox; der Vater ging jeden Morgen in die Synagoge. Der aufgeweckte, rebellische Junge hingegen war „skeptisch von Beginn an“. In einem Regal am Fuß seines Bettes flackerten kleine Lichter in merkwürdig geformten Gläsern. Sie reflektierten die Seelen von lieben Verstorbenen, und dies sei ein Mittel, um sich an sie zu erinnern und mit ihnen zu kommunizieren, erklärte ihm die Mutter. „Ich verstand, was sie sagte, war aber nicht recht überzeugt davon. Ich beobachtete die Flammen sehr vorsichtig, entdeckte jedoch nie eine Seele oder einen Geist.“ Auf die Bemerkung der Mutter, der Rauch der Kerzen, die sie für die Verstorbenen anzündete, steige in den Himmel hinauf, antwortete er: „Aber da ist kein Loch in der Decke.“
Die Zweifel am Glauben begleiteten ihn sein Leben lang. Die schrecklichen Erfahrungen, die er später als amerikanischer Ermittler in deutschen Konzentrationslagern machte, verstärkten sie nur. „Ich fragte: ›Gott, wo warst du, als Millionen unschuldiger Männer, Frauen und Kinder ermordet wurden?‹ Ich warte immer noch auf eine Antwort.“
In den Straßen von New York
Hell’s Kitchen war ein hartes Pflaster. Die Bevölkerung bestand hauptsächlich aus irischen und italienischen Einwanderern. Der männliche Nachwuchs teilte sich in rivalisierende Banden auf, „deren Lieblingsbeschäftigung darin zu bestehen schien, sich gegenseitig eins aufs Dach zu geben“. Ben navigierte geschickt zwischen den Fronten. „Ich wurde von beiden Seiten als Maskottchen angenommen. Wenn wir uns nicht gerade einen Bandenkrieg lieferten, verübten wir eifrig kleinere Diebstähle. Auf dem Bürgersteig gegrillte Kartoffeln schmeckten erst dann gut, wenn sie zuvor aus einem Gemüseladen stibitzt worden waren.“ Zum Zeitvertreib in diesem Milieu gehörten verschiedene Formen von Geldspielen. „Wenn wir auf dem Asphalt knieten, beteten wir nicht – wir würfelten.“ Bens Aufgabe, die er mit Stolz und einer Portion Durchtriebenheit erfüllte, bestand darin, Wache zu stehen und die kleinen Zocker vor der Polizei zu warnen. Kaum hatte er seinen Warnruf ausgestoßen, rannten sie davon – und der Polizist hinter ihnen her. Kehrte dieser später zurück, um den Gewinn für sich selbst einzustreichen, fand er meist keinen Penny mehr vor. „Ich sammelte alles ein, was die Flüchtenden hastig zurückgelassen hatten. First come, first served.“
Viele vergnügliche Stunden verbrachte er – gern mit seiner Schwester – im Kino „Chalona“ in der neunten Straße. Nicht, dass die Eltern eine besondere cineastische Neigung in ihnen hätten wecken wollen. Der Grund war prosaischer. Einen Babysitter konnten sie sich nicht leisten, und Krippen gab es damals noch nicht. Das Kino bot sich in dieser Situation als preisgünstige Alternative an. Der Eintritt kostete nur einen Dime – also zehn Cents –, und wenn ein Erwachsener die Kinder hineinführte, durften sie anschließend so lange allein drinbleiben, bis sie wieder abgeholt wurden. Es war die Ära des Stummfilms; vorgeführt wurden vor allem Westernstreifen „mit vielen Schießereien und Kämpfen“. „Cowboys jagten Indianer, während der Klavierspieler in der ersten Reihe Musik oder Geräusche produzierte, die die Handlung auf der Leinwand widerspiegeln sollten.“ Einmal geschah es, dass der Vater Ben im Kino nicht mehr fand. Er bedaure – eine Suche im Vorführsaal sei erst möglich, wenn der letzte Film vorüber sei, teilte ihm der Betreiber mit. Es ging auf Mitternacht zu, als Ben schlafend unter einem Sessel gefunden wurde. „Wenn die Szenerie voller Mord und Totschlag ist, kann ein gutes Schläfchen sehr erfrischend sein.“
Im Allgemeinen war er ein aktives Kind, das nie still sitzen konnte. Um ihn davon abzuhalten, irgendwelchen Unfug zu treiben, trugen ihm die Eltern verschiedene häusliche Pflichten auf. Als Hilfskraft seines Vaters, der im Quartier „Joe the Janitor“ („Hausmeister-Sepp“) genannt wurde, beteiligte er sich an der Entsorgung des Abfalls, der mit einem handbetriebenen Lift auf jeder Etage eingesammelt und anschließend weggebracht wurde. „Es gab keinen Kühlschrank in jenen Tagen, und man konnte immer riechen, wenn wir den Müll herunterkurbelten.“ Ein besonderes Augenmerk warf Ben auf die leeren Milchflaschen. Brachte er sie dem Lebensmittelhändler zurück, erhielt er zwei oder drei Cents dafür. Weniger glorreich verlief sein Einstieg ins Pressegeschäft. Nachdem er beobachtet hatte, wie andere Jungen in den Straßen erfolgreich die Daily News verkauften, sagte er sich, das könne er doch auch. Im Keller hatte er Stapel alter Zeitungen aufgehäuft. Er nahm einen Packen voll unter den Arm, stellte sich draußen auf und pries sie als die neuesten Nachrichten an. Die vorbeieilenden Passanten griffen zu, ohne genauer hinzuschauen, und ließen die Pennys in Bens Hand rieseln. Lange ging es nicht gut. Der Schwindel fiel einem Herrn auf, der den falschen Newsboy zur Rede stellte. Der Ertappte setzte ein entschuldigendes Lächeln auf und erstattete den Kaufpreis zurück. Der Gentleman bestand darauf, ihn nach Hause zu begleiten, und berichtete dort, was geschehen war. Vater versprach dem Geprellten, den Übeltäter zu züchtigen, und beschlagnahmte sämtliche Einkünfte. „Ich erkannte, dass nicht jedes Unternehmen zum Erfolg führt – besonders wenn man sich nicht an die Regeln hält.“
Die Große Depression
Die Jahre einer entbehrungsreichen, aber glücklichen Kindheit endeten abrupt, als Ben sechs war. „Die Eltern verbrachten die meiste Zeit damit, sich gegenseitig anzuschreien.“ Ihre Ehe war arrangiert worden – sie waren Cousins zweiten Grades –, „und die Armut und die harte Arbeit machten die Dinge nicht einfacher“. Die Mutter hatte schon vor der Geburt von Bens Schwester zwei Fehlgeburten erlitten, jetzt erwartete sie ein weiteres Kind – was die Spannungen zwischen ihr und ihrem Mann noch erhöhte. Damit sie sich in Ruhe auf die Geburt vorbereiten konnte, wurden Ben und Pepi zu Onkel Leppold geschickt, der in Port Jervis im Bundesstaat New York einen kleinen Bauernhof betrieb. Als sie nach einiger Zeit zurückkehrten, rannte Ben in die dunkle Ecke am Ende der Kellerwohnung, um das Neugeborene – es war ein Mädchen – zu begrüßen. „Aber da war keine Spur von ihr. Meine Mutter erklärte sanft, das Baby sei im Himmel und werde nie zurückkehren. Ich weinte und erinnerte mich an die Gläser mit den flackernden Kerzen.“ Die Kleine war an Lungenentzündung gestorben.
Es war der letzte Akt in der Ehe von Bens Eltern. Sie „passten einfach nicht zusammen“ und ließen sich scheiden. Einen Vertrag, der die Eigentumsverhältnisse regelte, brauchte es nicht, „weil kein Eigentum vorhanden war“. Sie einigten sich einvernehmlich darauf, dass die beiden Kinder in die Obhut der Mutter übergingen. Alle zogen aus dem Kellerloch aus. Das Trio musste eine neue Bleibe suchen und sich gleichzeitig irgendwie über Wasser halten. „Öffentliche Gelder zur Unterstützung bedürftiger Kinder gab es nicht, das System der sozialen Sicherheit war noch nicht erfunden worden. In schwierigen Zeiten galt der Leitspruch: ›Hilf dir selbst, so hilft dir Gott.‹“ Glücklicherweise hatte die Mutter eine ältere Schwester, die mit ihrem Mann ein Haus in Brooklyn besaß. Tante Fanny und Onkel Sam Isaac nahmen Ben und Pepi vorübergehend bei sich auf. Ein halbes Jahr nach der Scheidung heiratete Vater eine „hübsche transsilvanische Frau“ mit Namen Rose Fried, die er via Zeitungsinserat kennengelernt hatte. Wenige Wochen darauf vermählte sich auch Mutter wieder. Der Neue hieß Dave Schwartz, stammte aus Budapest und war einst ihr Lieblingsgast in der Kellerunterkunft gewesen.
In Brooklyn begann auch Bens glänzende Schulkarriere – obwohl es am Anfang gar nicht danach aussah. Sein Vater hatte ihn schon mit sechs in Manhattan in eine öffentliche Schule schicken wollen, doch der Rektor lehnte ihn ab, weil er ungewöhnlich klein gewachsen war und fast nur Jiddisch sprach. Als er nun bei Tante Fanny in Brooklyn in die erste Klasse aufgenommen wurde, hatte er immer noch Schwierigkeiten mit der englischen Sprache. Das Lesen fiel ihm schwer; dafür half ihm sein außerordentliches Gedächtnis: „Hatte ich einmal eine Geschichte gehört, konnte ich sie wörtlich wiederholen. Der Lehrer erwischte mich eines Tages dabei, wie ich korrekt von der falschen Seite ›las‹.“
Nachdem Ben und Pepi etwa ein Jahr bei Tante Fanny und Onkel Sam verbracht hatten, konnte sich die Mutter gemeinsam mit Dave Schwartz endlich eine kleine Mietwohnung in der Bronx leisten. Die Kinder kehrten zu ihr zurück. Den Vater und seine wachsende neue Familie – Rose gebar bald zwei Söhne – besuchten sie in unregelmäßigen Abständen. Doch kaum war die private kleine Welt wieder einigermaßen in Ordnung, geriet die große draußen in schwere Turbulenzen. Am 24. Oktober 1929 brach unter den Anlegern an der New Yorker Börse Panik aus. Es begann die Große Depression, die erst 1932 ihren Tiefpunkt erreichte. Millionen Amerikaner verloren ihre Arbeit. Von den Vereinigten Staaten griff die Finanz- und Wirtschaftskrise auf Europa und die ganze Welt über. In Deutschland überließen die ratlosen, den Parlamentarismus verachtenden Eliten um Reichspräsident Paul von Hindenburg dem sendungsbewussten Emporkömmling Adolf Hitler das Feld. Nachdem er am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler ernannt worden war, versetzte der zu allem entschlossene Naziführer der jungen Demokratie den Todesstoß.
Bens Familie bekam die Krise mit voller Wucht zu spüren. Die Mutter suchte vergebens nach einer Stelle als Schneiderin oder Hutmacherin, Dave nach einem Job als Werkzeugmacher, Wachmann oder was auch immer der ausgetrocknete Arbeitsmarkt hergab. Der Vater bot seine Dienste als Flachmaler an; aber wer konnte unter diesen Umständen schon sein Haus renovieren oder gar eines bauen? Um nicht zu hungern, waren viele Amerikaner auf die Fürsorge der Regierung angewiesen, deren Mittel allerdings beschränkt waren. Ben wurde losgeschickt, um rationierte Mengen an Brot, Butter oder Käse zu holen – eine Aufgabe, die er hasste. Einmal wurde ihm ein grüner Wollpullover abgegeben. Doch er benutzte ihn lieber nicht. „Ich schämte mich, ihn zu tragen, weil alle anderen Kinder dasselbe Stück anhatten und die Quelle erkennen konnten.“ Da sie die monatliche Miete nicht mehr bezahlen konnten, zogen sie ständig um – ein verbreitetes Phänomen während der Großen Depression. Manche Vermieter boten deshalb weitreichende Konzessionen: Die ersten paar Monatsraten entfielen. Statt zu bleiben, zogen viele dann aber einfach wieder weiter; so auch Ben mit seinen Verwandten.
Die unstete Lebensweise führte dazu, dass er in kurzer Zeit verschiedene öffentliche Schulen in der Bronx besuchte. Er blieb nie lange genug, um richtige Freunde zu gewinnen. Seine geringe Körpergröße erschwerte seine Teilnahme an populären Sportarten wie Basket-, Foot- oder Baseball. Seine Mutter fand sowieso, solche „gewalttätigen Spiele“ gehörten sich nicht für einen anständigen Judenjungen. Dafür entdeckte Ben seine Leidenschaft für das Lesen. Er besaß eine Mitgliederkarte für öffentliche Bibliotheken, die er ausgiebig benutzte. In ihm war etwas erwacht, was es in seiner Umgebung bisher nicht gegeben hatte: eine ausgeprägte Intellektualität. Das merkten auch seine Lehrer. Obwohl die häufigen Schulwechsel sicher keine idealen Lernvoraussetzungen boten, blieben ihnen seine geistigen Fähigkeiten nicht verborgen. Sie beschleunigten seine Schulkarriere, indem sie ihm erlaubten, einige Klassen zu überspringen.
Ein amerikanischer Traum
Wenn das Versprechen des American Dream in unbeschränkter sozialer Mobilität besteht, dann lebte Ben diesen Traum spätestens, seitdem er das achte Schuljahr an der Public School 80 in der Bronx absolvierte. Damals geschah etwas, das „den Lauf meines Lebens veränderte“. Seine Lehrerin war eine freundliche irische Dame, Mrs. Connelly. „Sie kümmerte sich um alle ihre Schüler, als ob es ihre eigenen Kinder gewesen wären.“ Eines Tages bat sie Ben, seine Eltern mitzubringen – sie sollten den Schulvorsteher treffen. „Ich fürchtete das Schlimmste.“ Er erklärte der Lehrerin, dass sein Vater nicht mehr verfügbar sei; die Mutter werde allein kommen müssen. „Zur vereinbarten Stunde war mein wirres Haar gekämmt, waren meine schmutzigen Schuhe poliert, und Hand in Hand erschienen meine Mutter und ich zum Treffen mit dem Rektor und der Lehrerin meiner Abschlussklasse. Sie sagten, langsam und vorsichtig, dass sie über meine Zukunft reden wollten. Es klang unheilvoll.“ Er sei ein „ungewöhnliches Kind“, sagten sie – und beide, Ben wie seine Mutter, erwarteten eine Lektion, wie der ungezogene Bengel zu disziplinieren sei. Doch es kam ganz anders. Mrs. Connelly und ihr Chef eröffneten ihnen, dass sie Ben in eine spezielle Schule für „begabte Jungen“ schicken wollten.
Gemeint war eine einzigartige Erziehungsinstitution: Die Townsend Harris High School im Stadtteil Queens garantierte – einen erfolgreichen Abschluss vorausgesetzt – einen beschleunigten direkten Zugang zum College of the City of New York. Sie gehörte zu den renommiertesten Highschools in ganz Amerika. Ihr Besuch war – entscheidend für die prekären finanziellen Verhältnisse, in denen Ben aufwuchs – kostenfrei. Das Angebot kam völlig unerwartet. „Niemand in der Familie meiner Eltern hatte je studiert. Alle, die wir kannten, fingen an zu arbeiten, sobald sie einen Job gefunden hatten.“ Die Mutter wirkte überfordert. „Sie drückte ihre Dankbarkeit aus und sagte, sie müsse den Entscheid, welche Schule ihr Sohn besuchen solle, den Lehrern überlassen.“ Auch Ben war überrascht: „Wie und warum ich ausgewählt wurde, wusste ich nicht.“ Die Verantwortlichen ließen jedoch keinen Zweifel daran, dass dies der richtige Weg für ihn sei. Seine Mutter nickte, und Ben strahlte. Nicht seine Herkunft, seine Fähigkeiten entschieden über seine Zukunft. „So etwas ist nur in Amerika möglich! Seither bin ich immer ein dankbarer Patriot gewesen.“
Da die „Townsend Harris High“ in der 23. Straße in Manhattan lag und der tägliche Schulweg zu weit gewesen wäre, wurde ein erneuter Umzug nötig. Die findige Mutter entdeckte ein elegantes Stadthaus in der Nähe in einer guten Nachbarschaft, das sich die Familie eigentlich nicht leisten konnte. Es bestand aus zehn möblierten Zimmern. Sie bewohnten das Erdgeschoss – und vermieteten die übrigen Räume mit Gewinn weiter.
„ Ferencz‘ Biograf Philipp Gut vermeidet Ausrufezeichen. Er will mit der Geschichte keinen Eindruck schinden. Gut verzichtet auf die dramatische Arrondierung seiner das Grauen streifenden Bemerkungen. Das ist gut so.“
„Philipp Gut hat Gespräche mit Ben Ferencz geführt und lässt anhand der Biografie dieses faszinierenden Jahrhundertzeugen die Geschichte des 20. Jahrhunderts lebendig werden.“
„Vielen Dank für dieses Buch!“
„Der Historiker Philipp Gut hat mit ›Jahrhundertzeuge Ben Ferencz‹ eine beeindruckende Biographie über den hundertjährigen Chefankläger bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen geschrieben.“
„Dieses Buch über einen Helden der Gerechtigkeit, der so gut wie alles im blutigsten aller Jahrhunderte gesehen hat, ist eine ebenso aufrüttelnde wie spannende Geschichtsstunde, die auch heute ins Mark trifft.“
„(Philipp Guts) Biografie würdigt nicht nur die große Lebensleistung dieses einzigartigen Zeitzeugen des monströsen 20. Jahrhunderts. Auch der außergewöhnliche Charakter des kleingewachsenen Mannes (…) wird deutlich.“
„Philipp Gut ist ein meisterlicher Erzähler. Gestützt auf die Interviews mit Ferencz und das umfangreiche Privatarchiv, das dieser dem United States Holocaust Memorial Museum in Washington, D.C., als Hauptquellen vermacht hat, lässt das Buch das lange Leben von Ferencz in unterhaltsamer, quasi autobiografischer Weise, revue passieren. Es liest sich geradezu spannend, erschöpft sich darin aber nicht. Vielmehr geht es dem Autor darum, vor dem Hintergrund der Vita von Ferencz aufzuzeigen, wie und wieso er zu dem wurde, der er ist.“
„Sehr lesenswerte Biografie“
„Dieses erstaunliche Leben des Ben Ferencz, dem unermüdlichen Streiter für Recht und Frieden, hat sein Biograph Philipp Gut mit Sachkenntnis und Empathie aufgeschrieben. Ein aufwühlendes Buch, das Mut macht.“
„Ein lebendiges Porträt“
„Intensiv recherchiert, ohne rosarote Brille, ist diese Biografie so spannend wie ein Krimi zu lesen.“
„Ein sehr interessantes, spannend zu lesendes, rundum empfehlenswertes Buch!“
„Der Reiz des Buches liegt im Zugang zu nachgezeichnetem autobiografischem Erleben von Ben Ferencz, nicht im Ablauf mehr oder weniger doch bekannter Fakten. Auf jeden Fall ist es gelungen, diese außergewöhnliche Persönlichkeit ins Rampenlicht zu holen, einen ähnlichen Zeugen tiefster historischer Einschnitte, faktisch und juristisch, dürfte es nicht mehr geben.“
„Dem nunmehr Hundertjährigen hat der Schweizer Autor mit dieser Biographie ein überaus anschauliches literarisches Denkmal gesetzt. Es lebt auch von Ferencz’ Anekdoten und seinem trockenen Humor.“
„In der Biographie von Philipp Gut wird Ferencz' Leben ebenso faktenorientiert wie spannend erzählt, und die Stichworte liefert Ferencz selbst. Denn er hat nicht nur dem Biographen Gut, sondern auch zahllosen anderen Personen Interviews gegeben.“
„Nicht nur für Weltkriegsinteressierte eine interessante Lektüre.“
„Dem Historiker Philipp Gut ist ein berührendes und detailreiches Werk über eine außerordentliche Person der Weltgeschichte gelungen.“


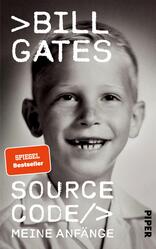
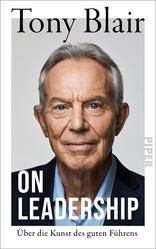

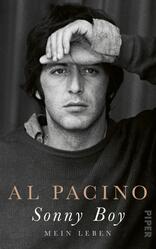

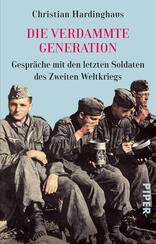


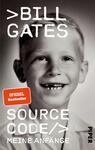

Diese Biografie des faszinierenden Zeitzeugen Ben Ferencz liest sich leicht, ist informativ und unterhaltsam. Die erschütternden Erlebnisse dieses eindrücklichen Anwalts der Gerechtigkeit berührten mich tief. Auch darum, weil Autor Philipp Gut genau den richtigen Ton trifft.
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.