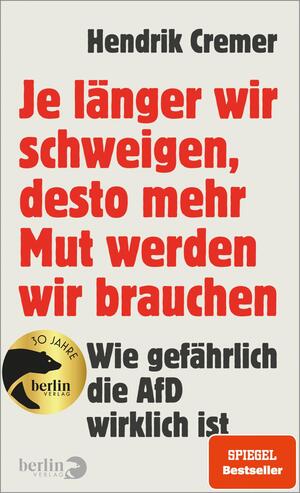
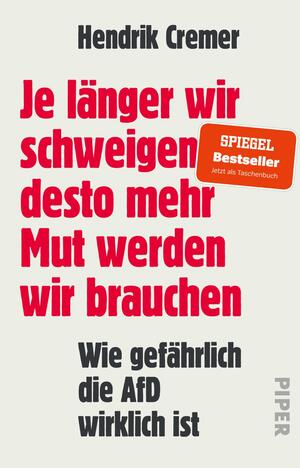
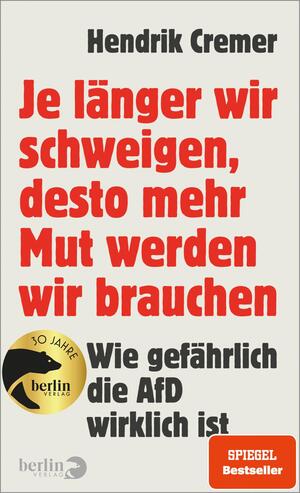
Je länger wir schweigen, desto mehr Mut werden wir brauchen Je länger wir schweigen, desto mehr Mut werden wir brauchen Je länger wir schweigen, desto mehr Mut werden wir brauchen - eBook-Ausgabe
Wie gefährlich die AfD wirklich ist
— „Niemand, der Cremers Buch gelesen hat, kann behaupten, er habe nichts gewusst.“ ZDF "Aspekte"„Die AfD ist gefährlich ›für das friedliche Zusammenleben der Menschen in Deutschland‹. Sie zielt darauf ab, ›die Garantien des Grundgesetzes zu beseitigen‹. Sie will ›die freiheitliche rechtsstaatliche Demokratie als historische Errungenschaft zerstören‹. Hendrik Cremer begründet diese seine Feststellungen klar, verständlich und gut belegt. (...) Wer die Grundrechte liebt, der weiß nach der Lektüre des Buches, warum es sie vor der AfD zu schützen gilt.“ - Süddeutsche Zeitung online
Je länger wir schweigen, desto mehr Mut werden wir brauchen — Inhalt
Deutschland rechts außen – eine Gefahr für uns alle
Die Gefahr, die von der AfD ausgeht, wird im öffentlichen Diskurs nicht abgebildet. Die Partei wird verharmlost, indem sie etwa als „rechtspopulistisch“ bezeichnet wird. Dabei hat sie sich längst zu einer rechtsextremen Partei entwickelt. Ihre Gewaltbereitschaft wird regelmäßig ausgespart. Zugleich erzielt sie hohe Zustimmungswerte, und Vertreter:innen demokratischer Parteien grenzen sich nicht genügend von ihr ab.
Cremer zeigt eine Entwicklung, die angesichts der deutschen Geschichte lange nicht für möglich gehalten wurde. Die Strategie der AfD droht aufzugehen, wenn sich der Umgang mit ihr nicht grundlegend wandelt. Ein fundiertes Aufklärungsstück, um die Dimension des Angriffs auf die freiheitliche rechtsstaatliche Demokratie zu erkennen.
„Käme die AfD an die Macht, würde sie die Prinzipien der Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit abschaffen, wonach jede(r) über eigene Rechte verfügt. Niemand in diesem Land würde mehr sicher sein.“
„Niemand, der Cremers Buch gelesen hat, kann behaupten, er habe nichts gewusst.“ ― ZDF "Aspekte"
- Die wichtigsten Fakten, Argumente und Handlungsempfehlungen für alle, die sich über die AFD informieren wollen
- Basierend auf langjähriger Recherchen am Deutschen Institut für Menschenrechte
Leseprobe zu „Je länger wir schweigen, desto mehr Mut werden wir brauchen“
Nie wieder?
„Wie konnte das alles passieren?“ „Warum habt ihr es nicht verhindert?“ Diese Fragen stellten die Kinder und Enkel der Tätergeneration in Deutschland, als die Verbrechen zur Zeit des Nationalsozialismus nach dem Kriegsende 1945 immer deutlicher zutage traten. Nicht wenige antworteten, sie hätten nicht ahnen können, dass die Nationalsozialisten so grausame und unvorstellbare Verbrechen beabsichtigten – vieles hätten sie auch nicht gewusst.
Seit 2014 ist in der Bundesrepublik Deutschland wieder eine Partei in die Parlamente eingezogen, die die [...]
Nie wieder?
„Wie konnte das alles passieren?“ „Warum habt ihr es nicht verhindert?“ Diese Fragen stellten die Kinder und Enkel der Tätergeneration in Deutschland, als die Verbrechen zur Zeit des Nationalsozialismus nach dem Kriegsende 1945 immer deutlicher zutage traten. Nicht wenige antworteten, sie hätten nicht ahnen können, dass die Nationalsozialisten so grausame und unvorstellbare Verbrechen beabsichtigten – vieles hätten sie auch nicht gewusst.
Seit 2014 ist in der Bundesrepublik Deutschland wieder eine Partei in die Parlamente eingezogen, die die freiheitliche rechtsstaatliche Demokratie beseitigen will: die „Alternative für Deutschland“, kurz AfD. Diese Partei hat sich seit ihrer Gründung 2013 fortschreitend radikalisiert, und ein Ende dieses Radikalisierungsprozesses ist nicht abzusehen. Schon jetzt weist die AfD in ihrer Programmatik klar erkennbare Parallelen zur nationalsozialistischen Ideologie auf.
Im öffentlichen Diskurs über die AfD wird der fortgeschrittene Prozess ihrer Radikalisierung allerdings nicht ausreichend abgebildet. Die Partei wird verharmlost, indem sie etwa als rechtspopulistisch bezeichnet wird. Dabei hat sie sich längst zu einer national-völkischen und damit rechtsextremen Partei entwickelt. Ihre tatsächlichen Ziele werden unzureichend thematisiert, ihr Streben nach Gewalt wird regelmäßig ausgespart. Zugleich erzielt die AfD hohe Zustimmungswerte, und Vertreter:innen demokratischer Parteien grenzen sich nicht oder nicht genügend von ihr ab.
Neben der AfD gibt es in der Bundesrepublik weitere Akteure, die rechtsextremes Gedankengut verbreiten, sei es im öffentlichen und politischen Raum, im Internet und in den sozialen Medien, ebenso auf Flugblättern, die öffentlich verteilt oder in Briefkästen eingeworfen werden, in Zeitschriften, die teilweise kostenlos verbreitet werden, oder in Büchern, die auch den Weg in öffentliche Bibliotheken finden. Mit zahlreichen dieser anderen rechtsextremen Akteure ist die AfD vernetzt.
Die Vehemenz des Angriffs auf die freiheitliche rechtsstaatliche Demokratie ergibt sich insbesondere daraus, dass rechtsextreme Inhalte nicht nur von Akteuren verbreitet werden, die sich in einem klar umrissenen rechtsextremen Milieu bewegen. Es ist vielmehr unverkennbar, dass ein solches Gedankengut gerade dann eine erhebliche Wirkung in der Gesellschaft entfalten kann, wenn Protagonisten bei der Verbreitung rechtsextremer Ideologie publikumswirksame Bühnen eingeräumt werden – insbesondere durch etablierte Medien wie auflagenstarke Magazine, Tagespresse oder öffentlich-rechtliche Sender. Die Protagonisten erhalten damit den Anstrich von Seriosität und können die verharmlosende Normalisierung ihrer Positionen vorantreiben. Damit verschieben sie die Grenzen dessen, was öffentlich gesagt und getan werden kann: Zuerst werden die Menschenrechte diskreditiert – und dann … abgeschafft?
Dieses Buch möchte gegen diese Entwicklung Position beziehen. Es möchte klar aufzeigen, wie die geschriebenen und gesprochenen Positionen formuliert sind, die darauf abzielen, die im Grundgesetz verankerte freiheitliche rechtsstaatliche Demokratie zu beseitigen. Dabei wird zunächst (Kapitel I) skizziert, wie rassistische und antisemitische Positionen als Kernelemente rechtsextremer Positionen in den vergangenen Jahrhunderten konstruiert und begründet wurden und welche Rolle das Konzept der „Rasse“ zur Kategorisierung von Menschen dabei spielte. Auf dieser Grundlage wird dann erläutert, wodurch rechtsextreme Positionen in der Gegenwart gekennzeichnet sind: Sie greifen in der Regel nicht mehr auf die Terminologie der „Rasse“ zurück, ebenso wenig auf biologistische Theorien von Abstammung und Vererbung. Stattdessen nehmen rechtsextreme Akteure heute in der Begründung ihrer Positionen regelmäßig auf „die Kultur“ von Menschen Bezug.[i] Dahinter steht die Strategie, rechtsextreme Positionen zu kaschieren, damit sie in der Gesellschaft möglichst überall Anschluss finden – auch in bürgerlichen und akademischen Milieus. Dabei haben diejenigen, die die Verbreitung dieses Gedankenguts vorantreiben, oftmals selbst einen akademischen Hintergrund: Zu ihnen gehören Richterinnen und Anwälte, Ärztinnen und Lehrer oder Wissenschaftlerinnen, auch Professoren[ii].
Angesichts solcher Entwicklungen wird es immer wichtiger, dass diese im Bereich der Bildung, in den Schulen und Universitäten, in den Medien und auch in Büchern wie diesem aufgegriffen und entsprechend eingeordnet und thematisiert werden. Um mit dem fortgeschrittenen Angriff auf die freiheitliche rechtsstaatliche Demokratie umgehen zu können, braucht es als Grundlage Wissen über gängige Argumentationsmuster und Strategien, die bei der Verbreitung rechtsextremen Gedankenguts eingesetzt werden. Dieses Buch möchte dazu beitragen, dass mehr Menschen rechtsextremes Gedankengut als solches erkennen und die Gefahren verstehen, die insbesondere von der AfD ausgehen.
Ein zentraler Ansatzpunkt ist die Analyse der offiziellen AfD-Programme (Kapitel 2). Sie zeigt, warum die Partei bereits nach ihrem Grundsatzprogramm und ihren bisherigen Wahlprogrammen als rechtsextrem einzuordnen ist. Bestätigt wird dies durch die Positionen von Funktions- und Mandatsträgern, die untermauern, wie gefährlich die AfD für das friedliche Zusammenleben der Menschen in Deutschland ist.
Die AfD ist zwar als demokratisch gewählte Partei in den Parlamenten vertreten. Daraus lässt sich allerdings nicht schließen, dass es sich bei ihr um eine demokratische Partei handelt. Diese immer wieder zu hörende Schlussfolgerung greift deutlich zu kurz und ist schlicht unzutreffend. Richtig ist vielmehr, dass die AfD darauf abzielt, die Garantien des Grundgesetzes zu beseitigen, die das Fundament der freiheitlichen rechtsstaatlichen Demokratie bilden. Sie will die freiheitliche rechtsstaatliche Demokratie als historische Errungenschaft zerstören.
In den Debatten über die AfD ist gleichwohl immer wieder der beschwichtigende Hinweis zu hören, dass die AfD doch nicht verboten sei. Das ist richtig, doch diese Tatsache sagt noch nichts darüber aus, wie gefährlich die AfD tatsächlich ist und ob sie nicht verboten werden könnte. Gemäß Artikel 21 des Grundgesetzes kann das Bundesverfassungsgericht politische Parteien verbieten. Ein solches Verbot setzt allerdings einen Antrag durch den Bundestag, den Bundesrat oder die Bundesregierung voraus.[iii] Ob es zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über ein Verbot kommt, liegt also in der Hand dieser drei Antragsberechtigten.
Im politischen Raum ist hier insgesamt eine starke Zurückhaltung wahrnehmbar – es gibt aber auch einzelne Vorstöße: So hat der sächsische CDU-Bundestagsabgeordnete Marco Wanderwitz, der schon seit einiger Zeit für ein Verbotsverfahren plädiert, Anfang Oktober 2023 eine entsprechende Initiative gestartet. Ziel der Initiative ist ein AfD-Verbotsverfahren durch den Bundestag. Dafür sucht er fraktionsübergreifend Unterstützung durch die Abgeordneten.[iv] „Wir haben es mit einer Partei zu tun, die ernsthaft unsere freiheitliche demokratische Grundordnung und den Staat als Ganzes gefährdet“, erläuterte Wanderwitz.[v] Für den Autor dieses Buches bestehen ebenfalls keinerlei Zweifel, dass die AfD so gefährlich ist, dass sie im Rahmen einer Prüfung vom Bundesverfassungsgericht verboten werden könnte.[vi] Ob es zu einem Verbotsantrag beim Bundesverfassungsgericht kommt, bleibt abzuwarten. Bis ein solcher Antrag entsprechend vorbereitet, begründet und gestellt würde und bis das Bundesverfassungsgericht über ihn entschieden hätte, würde in jedem Fall noch eine erhebliche Zeit vergehen.
Umso dringender wird die Aufklärung über die Partei und ihre sachgerechte Einordnung, an der es eklatant mangelt. Das Wissen darum, wie gefährlich diese Partei wirklich ist, ist die Grundvoraussetzung dafür, ihr im Wege gesellschaftlicher und politischer Auseinandersetzung angemessen begegnen zu können. Die Menschen dieses Landes müssen wissen, welche Partei sie möglicherweise wählen und wie gefährlich die AfD für die freiheitliche rechtsstaatliche Demokratie tatsächlich ist.
Im öffentlichen Diskurs über die AfD wird dies regelmäßig nicht abgebildet, diese Aufklärung nicht ausreichend geleistet. Nicht ohne Grund machte Thomas Haldenwang, bis November 2024 Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, in seiner Amtszeit immer wieder auf die Gefahr aufmerksam, die von der AfD ausgeht.[vii] Schließlich ist zu bedenken, dass die AfD stärker und stärker werden könnte, bis sie nicht mehr aufzuhalten ist und ein Verbot der AfD dann nicht mehr möglich und durchsetzbar wäre.
Warum die AfD im öffentlichen Diskurs regelmäßig verharmlost wird, lässt sich unter anderem auch damit erklären, dass die AfD vom Bundesamt für Verfassungsschutz bisher nicht als „erwiesen rechtsextremistische Bestrebung“ eingestuft worden ist – sondern als „Verdachtsfall“. Diese Einstufung vom März 2021 wurde vom Verwaltungsgericht Köln im März 2022[viii] bestätigt[ix] und ebenso im Mai 2024 vom Oberverwaltungsgericht des Landes Nordrhein-Westfalen.[x] Die bislang noch nicht vorgenommene, aber längst überfällige Einstufung der AfD als „erwiesen rechtsextremistische Bestrebung“ ist ein Grund, warum in der öffentlichen Debatte bisher völlig unzureichend abgebildet wird, was diese Partei für uns alle ist: brandgefährlich.
Dass die AfD nicht bereits längst als „erwiesen rechtsextremistische Bestrebung“ eingestuft worden ist, lässt sich auch darauf zurückführen, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz unter der Leitung von Hans-Georg Maaßen, die von August 2012 bis zu seiner Versetzung in den einstweiligen Ruhestand im November 2018 andauerte, nicht angemessen darauf reagiert hat, wie schnell und stark sich die AfD nach ihrer Gründung radikalisierte.[xi] Erst unter der Leitung des neuen Präsidenten Thomas Haldenwang wurde das Bundesamt für Verfassungsschutz tätig. Unter seiner Leitung dauerte es nicht lange, bis der Schritt erfolgte, der schon viel früher hätte erfolgen müssen: die Einstufung der AfD als „Prüffall“ (Januar 2019), dann als „Verdachtsfall“ (März 2021).[xii] Obwohl sich die Partei auch seitdem deutlich erkennbar weiter radikalisiert hat, erfolgte noch keine Einstufung als „erwiesen rechtsextremistisch“,[xiii] was dazu beiträgt, dass sie im öffentlichen Diskurs und in der Aufklärungsarbeit über die AfD regelmäßig nicht sachgerecht dargestellt wird.[xiv]
Käme die AfD, schleichend oder gewaltsam, an die Macht, so wäre, das wird die folgende Analyse verdeutlichen, niemand mehr in diesem Land sicher. Denn dies wäre die Konsequenz, wenn diese Partei – in Anlehnung an nationalsozialistische Ideologie – ihre Vorstellungen einer „homogenen Volksgemeinschaft“ verwirklichen und damit die Prinzipien der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit abschaffen würde. Das ist tatsächlich ihr Ziel: Die AfD erhebt den totalitären Anspruch, Menschen zu Objekten zu degradieren, nach Gutdünken über sie zu entscheiden und zu verfügen. Sie strebt danach, allein und damit willkürlich bestimmen zu können, wer in Deutschland leben darf und wer nicht – was Deportationen deutscher Staatsangehöriger einschließt.
Und mehr noch: Nach den Vorstellungen von Björn Höcke, Vorsitzender des thüringischen Landesverbandes, würden all diejenigen, die an der konsequenten Durchsetzung der national-völkischen Ideologie der AfD in seinem Sinne nicht mitwirken, zur Zielscheibe tödlicher Gewalt. Die Ausführungen in diesem Buch (Kapitel 3) werden verdeutlichen, dass Höcke den eingeschlagenen Kurs der Gesamtpartei maßgeblich bestimmt hat – zwar ohne Posten auf Bundesebene, aber mit dem Selbstbild eines „Führers“.
Wenn die AfD im öffentlichen Diskurs regelmäßig verharmlost wird und politische Akteure des demokratischen Spektrums sich nicht ausreichend von ihr abgrenzen, könnte eine der wichtigsten Strategien der AfD aufgehen: eine Gewöhnung an ihre rechtsextremen Positionen und deren Normalisierung im öffentlichen Diskurs, sodass sie sich als eine „normale“ Partei etablieren – und aus dieser Position heraus die Demokratie untergraben kann. Deshalb zeigt dieses Buch (Kapitel 4), wie die AfD das Sagbare verschiebt, wie sie sich selbst verharmlost und sogar als Opfer inszeniert, wie sie damit die Öffentlichkeit über ihre Ziele täuscht – und wie andere Parteien, Medien und weitere Akteure auch noch Öl ins Feuer der AfD gießen. (Kapitel 5).
Die Dimensionen der Gefahr aufzuzeigen, die von der AfD ausgeht, Klarheit über die Menschenverachtung, Demokratiefeindlichkeit und Gewaltbereitschaft der AfD zu schaffen sowie Handlungsempfehlungen zu geben – das ist das zentrale Anliegen dieses Buches (Kapitel 6 und 7). Es basiert auf der langjährigen Beschäftigung des Autors mit der AfD, auch im Rahmen seiner wissenschaftlichen Tätigkeit für das Deutsche Institut für Menschenrechte. Die Befunde dieser Analyse sind zutiefst besorgniserregend. Sie zeigen eine Entwicklung auf, die vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte lange Zeit nicht für möglich gehalten wurde. Dieses Buch möchte einen Beitrag dazu leisten, diese Entwicklung in ihren Dimensionen zu erkennen, sie ernst zu nehmen und vor allem: die Dringlichkeit zu verstehen, mit der den Täuschungsmanövern der AfD durch fundierte Aufklärungsarbeit über die Partei entgegenzutreten ist. „Je länger wir schweigen, desto mehr Mut werden wir brauchen.“[xv]
Es ist höchste Zeit: Wenn sich der öffentliche Diskurs über die Partei und der Umgang mit ihr nicht grundlegend wandeln, droht die demokratiezersetzende Strategie der AfD aufzugehen.
1_Was heißt „rechtsextrem“?
Rechtsextremes Gedankengut ist dadurch gekennzeichnet, dass es bestimmte Menschen als „Andere“ kategorisiert und abwertet. Dabei bilden insbesondere rassistische und/oder antisemitische Positionen, die sich gegen die absoluten Garantien der Menschenrechte richten, die Kernelemente rechtsextremer Programmatik. Sie zielen nicht nur auf die fundamentalen Grundlagen des Grundgesetzes und damit auf die Beseitigung der freiheitlichen rechtsstaatlichen Demokratie. Sie laufen erfahrungsgemäß auch auf die Anwendung und Legitimierung von Gewalt hinaus. Woher kommen die absoluten Garantien der Menschenrechte und wie legitimieren sie sich? Um das zu verstehen, müssen wir zunächst noch einen Schritt zurückgehen und fragen: Welches Recht meinen wir, wenn wir über Menschenrechte reden?
„Menschenrechte“ – was heißt das eigentlich?
Beginnen wir mit einem Beispiel: In einem „Sommerinterview“ 2023 sprach sich der Thüringer AfD-Chef und Meinungsführer der Gesamtpartei Björn Höcke dafür aus, behinderte Kinder vom Regelunterricht auszuschließen. Sie seien „Belastungsfaktoren“ und Inklusion nur ein „Ideologieprojekt“. Daraufhin kommentierte die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele: „Inklusion ist ein Menschenrecht und kein ›Ideologieprojekt‹. (…) Heute sind es Migranten und geflüchtete Menschen, Menschen mit Behinderungen und Frauen, denen die AfD dreist und unverhohlen ihre Rechte abspricht, morgen sind es vielleicht schon Seniorinnen und Senioren, Pflegebedürftige und ärmere Menschen.“[i]
Beide Aussagen bringen die gegensätzlichen Haltungen zum Thema Menschenrechte perfekt auf den Punkt: Für Bentele gilt es, die Menschenrechte, so wie sie in unserer Verfassung verankert sind, zu verteidigen. Für Höcke sind Menschenrechte nichts anderes als „Ideologieprojekte“ – die es abzuschaffen gelte –, das widerspricht unserer Verfassung und ist in autoritären Regimen verbreitet.
Menschenrechte sind Rechte, die sich aus der Würde des Menschen herleiten und begründen lassen: Rechte, die unveräußerlich, unteilbar und unverzichtbar sind. Sie stehen allen Menschen zu, unabhängig davon, wo sie leben, und unabhängig davon, wie sie leben.
Die Ursprünge der Menschenrechte reichen weit zurück bis in die Antike. Doch erst in der Mitte des 20. Jahrhunderts begann ein umfassender Prozess ihrer Normierung auf nationaler und internationaler Ebene. Neben nationalen Schutzmechanismen gibt es eine Vielzahl internationaler Übereinkommen, die dem Schutz der Menschenrechte dienen.
Auch in der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland spielen Menschenrechte eine zentrale Rolle. Die im deutschen Grundgesetz verankerten Menschenrechte nennt man Grundrechte. Der Katalog der Grundrechte, der sich am Anfang des Grundgesetzes findet, enthält eine ganze Reihe allgemeiner Menschenrechte – also Rechte, auf die sich jede und jeder berufen kann. Dazu gehört etwa das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit (Artikel 2 Abs. 1 Grundgesetz (GG)), das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit und das Recht auf Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 GG), die Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnisfreiheit (Artikel 4 GG) oder das Recht der freien Meinungsäußerung (Artikel 5 Abs. 1 GG).
Die Grundrechte binden alle staatliche Gewalt, in allen ihren Ausprägungen und Aktivitäten: Der Gesetzgeber muss sie etwa beim Erlass, die vollziehende Gewalt bei der Anwendung und die Gerichte bei der Auslegung von Gesetzen beachten (Artikel 1 Abs. 3 GG). Die Menschen in diesem Land haben zudem die Möglichkeit, von Gerichten überprüfen zu lassen, ob ihre Rechte hinreichend gewährleistet werden. Als wichtiges Instrument des Grundrechtsschutzes existiert auch die Verfassungsbeschwerde. Danach kann sich jede Person an das Bundesverfassungsgericht mit der Behauptung wenden, durch die öffentliche Gewalt in ihren durch das Grundgesetz gewährleisteten Grundrechten verletzt zu sein. Mit diesem außerordentlichen Rechtsbehelf können grundsätzlich alle Akte der gesetzgebenden, vollziehenden und rechtsprechenden Gewalt angefochten werden. Die Verfassungsbeschwerde dient somit dem Schutz der Grundrechte.
Dem Bekenntnis des Grundgesetzes zu den Menschenrechten entspricht, dass die Bundesrepublik Deutschland die zentralen Internationalen Übereinkommen zum Schutz der Menschenrechte unterzeichnet und anerkannt hat. Hierzu gehört auch das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention) von 2006, in dem, wie von Verena Bentele zutreffend hervorgehoben, Inklusion als menschenrechtliches Prinzip verankert ist. Die menschenrechtlichen Konventionen des Europarats und der Vereinten Nationen sind in Deutschland unmittelbar geltendes Recht und gelten für alle staatlichen Stellen. Sie geben außerdem wichtige Anregungen und Impulse für die nationale Gesetzgebung. Das heißt: Sie sind bei der Auslegung des Grundgesetzes, bei der Bestimmung von Inhalt und Reichweite des Rechtsstaatsprinzips und der Grundrechte sowie bei der Auslegung des einfachen Rechts zu berücksichtigen.[ii]
Menschenrechte dienen der Begrenzung staatlicher Macht, sie sollen von Staaten anerkannt, in ihren Rechtssystemen verankert und geschützt werden.
Rechtsextreme folgen demgegenüber ihrer eigenen national-völkischen Ideologie. Sie lehnen universelle Menschenrechte ab – die aber in Demokratien wie der Bundesrepublik Deutschland in der Verfassung verankert sind. Damit stehen Rechtsextreme nicht auf dem Boden des Grundgesetzes.
Artikel 1 Abs. 1 Grundgesetz: Der absolute Kern der freiheitlichen rechtsstaatlichen Demokratie
Den Ausgangspunkt für die Kodifizierung der Menschenrechte im Rahmen verbindlicher Menschenrechtsabkommen auf internationaler Ebene bildete die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948. Dabei ist die Erklärung insbesondere als Reaktion auf die Menschheitsverbrechen des nationalsozialistischen Deutschlands zu verstehen. Die Erklärung weist in ihrer Präambel explizit darauf hin, dass „die Nichtanerkennung und Verachtung der Menschenrechte zu Akten der Barbarei geführt haben“.[i] Vor diesem historischen Hintergrund ist auch die Entstehungsgeschichte der 1950 in Kraft getretenen Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) zu sehen.[ii] Die Menschenrechte wurden ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zum Gegenstand zahlreicher Menschenrechtsverträge und damit zum zentralen Bestandteil des Völkerrechts.
Auch das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland aus dem Jahr 1949 ist als Antwort auf die Verbrechen des Nationalsozialismus zu begreifen.[iii] Es bekennt sich ausdrücklich zu den Menschenrechten als Grundlage einer menschlichen Gemeinschaft und von Frieden und Gerechtigkeit (Artikel 1 Abs. 2 Grundgesetz).
Die Menschenrechte zeichnen sich durch ihren universellen Anspruch aus und enthalten einen absoluten Kern: Es handelt sich um Grundprinzipien, die die Menschenrechte ausmachen und daher für ihre Geltung unabdingbar sind. Diese unabdingbaren Grundlagen der Menschenrechte sind konstitutiv für den freiheitlichen demokratischen Rechtsstaat. Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 fasst sie prägnant zusammen: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.“
Im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland sind diese Grundprinzipien der Menschenrechte in Artikel 1 Abs. 1 verankert, der den Ausgangspunkt und zugleich dessen zentrale Bestimmung bildet.[iv] Dort heißt es: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ Die hier verankerte Garantie bedeutet, dass jeder Mensch allein aufgrund seines Menschseins die gleiche Menschenwürde und gleiche Rechte hat.[v] Das heißt: Menschen dürfen nicht zum Objekt und zum Gegenstand willkürlichen staatlichen Handelns werden. Jedem Menschen steht gleichermaßen ein Achtungsanspruch zu,[vi] wobei der Staat die Menschenwürde umfassend zu achten und zu schützen hat.[vii]
Da die Menschenwürde jedem Menschen aufgrund seines Menschseins zukommt, ist sie nur als gleiche Würde aller Menschen denkbar und damit untrennbar mit dem Diskriminierungsverbot verbunden.[viii] Das Diskriminierungsverbot ist Bestandteil sämtlicher Menschenrechtsverträge, so etwa der Europäischen Menschenrechtskonvention (Art. 14) oder der UN-Kinderrechtskonvention (Art. 2 Abs. 1). Im Grundgesetz ist das Verbot von Diskriminierung in Artikel 3 Abs. 3 verankert.
Zum Zweck des Diskriminierungsverbotes gehört es, die in einer Gesellschaft erfahrungsgemäß von Diskriminierung besonders bedrohten Menschen vor Benachteiligung zu schützen.[ix] Es umfasst das Verbot rassistischer beziehungsweise antisemitischer Diskriminierung,[x] was insbesondere bedeutet, dass Menschen nicht aufgrund physischer Merkmale wie ihrer Hautfarbe[xi], ihrer tatsächlichen oder vermeintlichen Herkunft oder Religionszugehörigkeit benachteiligt werden dürfen.[xii] Kurz: Antisemitische oder rassistische Konzepte sind mit unserem Grundgesetz nicht vereinbar. Sie verstoßen gegen die Garantie der Menschenwürde.[xiii] Wo kommen derartige Konzepte her?
Rassismus und Antisemitismus: Eine Geschichte der Gewalt
So widersprüchlich es erscheinen mag: Die Zeit der Aufklärung war dadurch gekennzeichnet, dass mit wissenschaftlichem Anspruch vertretene Positionen weit verbreitet waren, denen zufolge es verschiedene hierarchisch geordnete menschliche „Rassen“[i] gebe. Sie wurden insbesondere auf der Grundlage von körperlichen Merkmalen wie Hautfarbe oder Gesichtszügen konstruiert und mit charakterlichen Eigenschaften verknüpft.[ii] Dabei führte die mit dem Begriff „Rasse“ einhergehende Kategorisierung und Hierarchisierung von Menschen, an deren Spitze die „weiße Rasse“ stehe,[iii] schließlich zum Begriff und zum Phänomen „Rassismus“. Mit rassistischen Perspektiven wurden ebenso die Verbrechen der Sklaverei und Kolonialpolitik gerechtfertigt.[iv]
Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es zunehmend Veröffentlichungen, in denen das Judentum als „Rasse“ bezeichnet und eingestuft wurde.[v] Die Bewertung des Judentums löste sich dabei von religiösen Begründungsansätzen und verlagerte sich zu einer säkularen Charakterologie, wobei Stereotype der alten christlichen Judenfeindschaft übernommen, aber modern zugeschnitten und ergänzt wurden.[vi] „Dem Juden“ („Juda“) wurden niedrigste Charaktereigenschaften und gefährliche politische Ziele wie Revolution und Weltherrschaft zugeschrieben.
In dieser Zeit entstand auch der Begriff Antisemitismus. Er erschien erstmals 1879 als Eigenbezeichnung deutscher Judenfeinde um den Journalisten Wilhelm Marr, die die Vereinigung „Antisemitenliga“ gründeten und das Schlagwort „Antisemitismus“ zum politischen Programm erhoben. Sie griffen dabei auf die damals verbreitete Bezeichnung von Juden als „Semiten“ zurück, mit der eine Abwertung von Juden einherging.[vii] Die bis ins 18. Jahrhundert zurückreichenden und in der Folgezeit weitergesponnenen „Rassentheorien“ wurden schließlich von den Nationalsozialisten radikalisiert und ins Zentrum ihrer Ideologie gestellt, wobei der Schwerpunkt auf Antisemitismus lag.
Schlüsselbegriff „Volksgemeinschaft“
In diesem Kontext ist auch ein Schlüsselbegriff der Nationalsozialisten zu verstehen: die „Volksgemeinschaft“. Das zentrale Ziel der Nationalsozialisten bestand in der Herstellung eines „homogenen Volkes“ nach ihren national-völkischen Vorstellungen, dessen Mitglieder insbesondere nicht jüdisch, keine Sinti und Roma, weiß, gesund und leistungsfähig sein sollten.[i] Ein Kernelement der nationalsozialistischen Propaganda bildeten Bedrohungsszenarien, denen zufolge das deutsche „Volk“ gefährdet sei durch Juden und Jüdinnen. Bekanntermaßen gipfelte der von den Nationalsozialisten propagierte „Rassenkampf“, in dem die „Arier“ die „Herrenrasse“ bildeten, in der systematischen und monströsen Ermordung von Millionen von Menschen, die nach dem nationalsozialistischen Menschenbild nicht dem Bild der deutschen „Volksgemeinschaft“ entsprachen. „Volksgemeinschaft“ bedeutete auch Gesinnungsgemeinschaft und Gefolgschaftsprinzip, was zu der massiven und gewaltsamen Verfolgung von Oppositionellen führte.[ii]
Warum der Begriff „Rasse“ heute vermieden wird
Vor dem Hintergrund der Verbrechen, die – verbunden mit der Kategorisierung von Menschen nach „Rassen“ – begangen wurden, gab es nach 1945 zahlreiche internationale Erklärungen, die sich vom Konzept der „Rasse“ distanzierten. So wies etwa die UNESCO in ihrem „Statement on Race“ 1950 darauf hin, dass die Terminologie „Rasse“ für einen sozialen Mythos stehe, der ein enormes Ausmaß an Gewalt verursacht habe.[i] Die Generalkonferenz der UNESCO erklärte 1978: „Alle Menschen gehören einer einzigen Art an und stammen von gemeinsamen Vorfahren ab. Sie sind gleich an Würde und Rechten geboren und bilden gemeinsam die Menschheit.“[ii] Im Juni 1995 gaben Anthropologen, Humangenetiker und Biologen während der UNESCO-Konferenz „Gegen Rassismus, Gewalt und Diskriminierung“ eine Stellungnahme ab, nach der das Konzept der »Rasse „völlig obsolet“ geworden sei.[iii]
Es gebe „keinen wissenschaftlichen Grund“, am Begriff der „Rasse“ festzuhalten, da kein wissenschaftlich seriöser Weg existiere, die menschliche Vielfalt mit den starren Begriffen „rassischer“ Kategorien oder dem traditionellen „Rassen-Konzept“ zu charakterisieren. Die Stellungnahme distanziert sich von Rassismus als dem Glauben, menschliche Populationen unterschieden sich in genetisch bedingten Merkmalen von sozialem Wert, sodass bestimmte Gruppen gegenüber anderen höherwertig oder minderwertig seien. In diese Erklärungen reiht sich ebenso die „Jenaer Erklärung“ des Instituts für Zoologie und Evolutionsforschung der Friedrich-Schiller-Universität Jena aus dem Jahr 2019 ein. Sie zeigt auf, wie das Konzept der „Rasse“ in der Geschichte zur Rechtfertigung von Gewalt diente und welchen Beitrag auch die Wissenschaft dabei geleistet hat, dass es zu Menschheitsverbrechen gegenüber „Abermillionen von Menschen“ kam.[iv] Kurz: „Rassen“ wurden konstruiert, um Rassismus und Antisemitismus zu rechtfertigen.
Was rechtsextreme Akteure, die sich heute mit rassistischen beziehungsweise antisemitischen Positionen profilieren, aus alledem gelernt haben? Sie verwenden den Begriff „Rasse“ in ihren Stellungnahmen in Deutschland in der Regel nicht mehr öffentlich.
Doch auch heute sind von rassistischem beziehungsweise antisemitischem Denken geprägte, national-völkische Positionen kennzeichnend für rechtsextremes Gedankengut. Diese Positionen gründen auf der Vorstellung einer „abstammungsbasierten“ Nation, die mit Rassismus[v] beziehungsweise Antisemitismus einhergeht. Sie gehen also davon aus, dass es ein „angestammtes“ und damit vorgegebenes homogenes „Volk“ gebe, dessen Mitglieder als Teile dieses exklusiven Kollektivs unbedingten Vorrang gegenüber Menschen haben, die prinzipiell nicht dazugehören könnten, die als minderwertig und/oder gefährlich betrachtet und dementsprechend abgewertet werden. Demnach müsse – so die rechtsextreme Vorstellung – das „deutsche Volk“ vor einer „Völkervermischung“ bewahrt werden.[vi] Es liegt auf der Hand, dass solche Positionen mit den in Artikel 1 Abs. 1 Grundgesetz verankerten Garantien nicht vereinbar sind.[vii]
Und auch das ist ein typisches Merkmal heutiger rechtsextremer Positionen: Die Verbrechen, die unter nationalsozialistischer Herrschaft verübt worden sind, werden verschwiegen, verharmlost und geleugnet oder die angeblich positiven Leistungen der Nationalsozialisten sogar hervorgehoben.[viii] Schon die Relativierung des Nationalsozialismus läuft auf eine rechtsextreme Positionierung hinaus.[ix] Denn wer einzelne Elemente nationalsozialistischer Politik relativiert, relativiert damit die mit dem Nationalsozialismus untrennbar verbundenen Menschheitsverbrechen.[x] Und mehr noch: Er trägt dazu bei, das national-völkische Gedankengut der Nationalsozialisten (wieder) gesellschaftsfähig zu machen.
Was allerdings oft missverstanden wird: Rechtsextreme Positionen sind nicht nur dann anzunehmen, wenn sie der nationalsozialistischen Ideologie entsprechen, inhaltlich darauf Bezug nehmen oder sprachlich unmittelbar oder assoziativ auf nationalsozialistische Terminologie zurückgreifen.[xi]
Rechtsextreme Positionen laufen auf willkürliches Handeln hinaus, wobei sich rechtsextreme Akteure gegen jegliche Minderheiten richten können. Die für rechtsextreme Akteure typische pauschale Abwertung von bestimmten Gruppen in einer Gesellschaft kann beispielsweise auch auf Menschen zielen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer Geschlechtsidentität eine Minderheit in der Gesellschaft bilden. Sie kann sich gegen alle Andersdenkenden wenden.
Rechtsextreme Parteien oder andere Bestrebungen können mit unterschiedlichen Intensitäten und Positionierungen auftreten: Sie können Drohungen aussprechen und Gewalt ankündigen – oder auch nicht.[xii] Für die Einstufung als „rechtsextremistisch“ nach den Verfassungsschutzgesetzen sind weder die Anwendung von Gewalt noch ein gewaltbereites oder kämpferisch aggressives Vorgehen Voraussetzungen.[xiii] Es ist nicht entscheidend, wodurch oder wie genau der freiheitlich demokratische Verfassungsstaat letztlich außer Kraft gesetzt werden soll,[xiv] sei es etwa durch Wahlen, durch Umsturz oder durch Infiltration der bestehenden Staatsgewalten.[xv] Maßgeblich ist, dass rechtsextreme Akteure dezidiert auf die Beseitigung der freiheitlichen rechtsstaatlichen Demokratie ausgerichtet sind.[xvi]
Angesichts dieser Zielsetzung rechtsextremer Akteure, die freiheitliche Demokratie zu untergraben, wird deutlich, dass national-völkischen Positionen ein politischer Autoritarismus immanent ist. Danach stehen Menschen nicht frei als Individuen und Inhaber individueller Rechte im Mittelpunkt – so wie es in einer freiheitlichen rechtsstaatlichen Demokratie der Fall ist. Auch Demokratieverständnisse, die damit einhergehen, wonach es angeblich einen einheitlichen „Volkswillen“ gebe, der durch eine einzige Partei oder einen Führer repräsentiert werden könne, richten sich fundamental gegen die in der freiheitlichen rechtsstaatlichen Demokratie verankerten Menschenrechte.
National-völkische Positionen zielen insbesondere darauf ab, Menschen aufgrund rassistischer oder antisemitischer und damit willkürlicher Kriterien von dem in Artikel 1 Abs. 1 des Grundgesetzes verbrieften Prinzip der gleichen Rechte auszuschließen. Dies kann beispielsweise durch willkürliche Zuschreibungen nach physischen Merkmalen erfolgen – doch Rassismus und Antisemitismus setzen nicht unbedingt Zuschreibungen nach physischen Merkmalen voraus. Sie setzen nicht unbedingt ein Gedankengut voraus, das auf biologistischen Theorien von Abstammung und Vererbung basiert und auf biologistische Begründungsmuster zurückgreift.[xvii] Rassismus und Antisemitismus sind keine statischen Phänomene. Ihre Begründungsmuster verändern sich. Heute laufen rassistische Positionierungen oftmals unter dem Decknamen „kulturelle Identität“.
[i]„Statement on Race“, Paris 1950, in: Edward Lawson (Hg.), Encyclopedia of Human Rights, Second Edition, Washington 1996, S. 1216 f., para 14.55.
[ii]„Declaration on Race and Racial Prejudice, Paris am 27. 11. 1978, article 1“, in: Edward Lawson (Hg.), Encyclopedia of Human Rights, Second Edition, Washington 1996, S. 1223 ff., in deutscher Übersetzung veröffentlicht in: Vereinte Nationen 2/1980, S. 67 ff.
[iii]Statement on „Race“ von den Teilnehmenden der wissenschaftlichen Arbeitsgruppe der internationalen UNESCO-Konferenz „Against Racism, Violence and Discrimination“, Stadtschlaining am 8. und 9. Juni 1995, verfügbar im Englischen und Deutschen unter: uol.de/ulrich-kattmann/schwerpunkte/rasse-und-rassismus.
[iv]Friedrich-Schiller-Universität Jena, „Jenaer Erklärung. Das Konzept der Rasse ist das Ergebnis von Rassismus und nicht dessen Voraussetzung“, 10. 09. 2019. www.shh.mpg.de/1464864/jenaer-erklaerung.
[v]Rassismus richtet sich weiterhin insbesondere gegen nicht-weiße Menschen. Er trifft in Deutschland Menschen, die hier Schutz suchen, oder Menschen mit Migrationsgeschichte, die selbst oder deren Vorfahren aus anderen Ländern zugewandert sind. Häufig zielt er auch gegen deutsche Staatsangehörige, gegen Menschen, deren Familien mitunter schon seit Generationen in Deutschland leben. Dabei wird in Deutschland als Ersatzbegriff und synonym für den Begriff Rassismus oftmals auch der Begriff der „Fremdenfeindlichkeit“ gebraucht. Hierbei ist zu bedenken, dass Menschen mit dem Begriff eine „Fremdheit“ zugeschrieben wird, wodurch diese Menschen als nicht zugehörig ausgegrenzt werden und implizit als Ursache des Problems erscheinen. Der Gebrauch des Begriffs „Fremdenfeindlichkeit“ führt zudem dazu, dass historische Kontinuitäten von Rassismus verwischt und die gesellschaftliche Dimension von Rassismus relativiert wird. Außerdem ist es schlichtweg unpassend, von einer Feindlichkeit gegenüber Fremden zu sprechen, wenn es um Positionen oder etwa auch um Gewalttaten geht, die sich gegen Deutsche richten – gegen Menschen, deren Eltern oder Großeltern bereits Deutsche waren. Darüber hinaus wird in Deutschland als Ersatzbegriff und synonym für den Begriff Rassismus zudem oftmals auch der Begriff der „Ausländerfeindlichkeit“ gebraucht. Dabei wird verkannt, dass sich Rassismus in der Regel nicht allgemein gegen Menschen wendet, die keine deutsche Staatsangehörigkeit haben; er richtet sich gegen Menschen, die aufgrund äußerer Merkmale beziehungsweise Fremdzuschreibungen kategorisiert werden, unabhängig davon, welche Staatsangehörigkeit sie haben.
[vi]Siehe dazu etwa Bundesministerium des Innern und für Heimat, „Lexikon: Rechtsextremismus“, 2023. www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html.
[vii]Vgl. zum Verständnis rechtsextremer Positionen in diesem Sinne Bundesministerium des Innern und für Heimat, „Lexikon: Rechtsextremismus“, 2023. www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html; Bundeszentrale für politische Bildung, Glossar: Rechtsextremismus, 2023. www.bpb.de/themen/rechtsextremismus/dossier-rechtsextremismus/500806/rechtsextremismus/; Gunter Warg, „Der Extremismusbegriff aus juristischer Sicht – Grundlagen und aktuelle Entwicklungen“, in: Hendrik Hansen/Armin Pfahl Traughber (Hg.), Jahrbuch für Extremismus und Terrorismusforschung 2019/20 (I), Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung, Brühl 2021, insbesondere S. 93 f.; siehe zur Unvereinbarkeit solcher Positionen mit der Garantie aus Artikel 1 Abs. 1 Grundgesetz außerdem Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 17. 01. 2017, Aktenzeichen 2 BvB 1/13, Randnummer 538 – 541, 635; Bundesamt für Verfassungsschutz, „Gutachten zu tatsächlichen Anhaltspunkten für Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung in der ›Alternative für Deutschland‹ (AfD) und ihren Teilorganisationen, Gliederungspunkt B., II., 2., 2.1, 2.1.1 (Menschenwürde), Geheimhaltungsstufe: Verschlusssache – Nur für den Dienstgebrauch, Stand: 15. Januar 2019“. Veröffentlicht von NETZPOLITIK.ORG am 28. 01. 2019. netzpolitik.org/2019/wir-veroeffentlichen-das-verfassungsschutz-gutachten-zur-afd/.
[viii]Siehe dazu ebenso Bundesministerium des Innern und für Heimat, „Lexikon: Rechtsextremismus“, 2023. www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html.
[ix]Siehe etwa Armin Pfahl-Traughber, Die AfD und der Rechtsextremismus. Eine Analyse aus politikwissenschaftlicher Perspektive, Wiesbaden 2019, S. 4.
[x]Vgl. dazu etwa Armin Pfahl-Traughber, Die AfD und der Rechtsextremismus. Eine Analyse aus politikwissenschaftlicher Perspektive, Wiesbaden 2019, S. 20.
[xi]Vgl. dazu etwa Uwe Backes/Patrick Moreau, Europas moderner Rechtsextremismus. Ideologien, Akteure, Erfolgsbedingungen und Gefährdungspotentiale, Göttingen 2021; Armin Pfahl-Traughber, „Vom ›Rassegedanken‹ zum ›Ethnopluralismus‹. Nationalrevolutionäre Intellektuelle der 1970er-Jahre und die Entwicklung des Rassismus-Verständnisses im deutschen Rechtsextremismus“, in: Hendrik Hansen/Armin Pfahl Traughber (Hg.), Jahrbuch für Extremismus und Terrorismusforschung 2019/20 (I), Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung, Brühl 2021.
[xii]Eckhard Jesse, „Rechtsextremismus in Deutschland: Definition, Gewalt, Parteien, Einstellungen“, in Neue Kriminalpolitik 1/2017, S. 17; siehe dazu ebenso Armin Pfahl-Traughber, Die AfD und der Rechtsextremismus. Eine Analyse aus politikwissenschaftlicher Perspektive, Wiesbaden 2019, S. 4, der auch darauf hinweist, dass Absichten zur gewaltsamen Machtergreifung oftmals aus strategischen Gründen verschwiegen werden.
[xiii]Vgl. hierzu auch Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 17. 01. 2017, Aktenzeichen 2 BvB 1/13, Randnummer 570 – 580, wonach auch die Voraussetzungen für ein Verbot einer Partei dies nicht verlangen. Das Bundesverfassungsgericht spricht hier zwar von einer aktiv kämpferischen, aggressiven „Haltung“ gegenüber der bestehenden Ordnung, dies ist aber nicht gleichzusetzen mit einem kämpferischen, aggressiven „Vorgehen“, das sich auf die Handlungsebene bezieht.
[xiv]Vgl. zu diesem Aspekt auch Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 17. 01. 2017, Aktenzeichen 2 BvB 1/13, Randnummer 570 – 580, wonach dies auch bei den Voraussetzungen für das Verbot einer Partei nicht entscheidend ist. Das Bundesverfassungsgericht stellt dazu in Randnummer 578 des Urteils insbesondere klar: „Das Parteiverbot stellt gerade auch eine Reaktion auf die von den Nationalsozialisten verfolgte Taktik der ›legalen Revolution‹ dar, die die Machterlangung mit erlaubten Mitteln auf legalem Weg anstrebte.“
[xv]Wolfgang Roth, »§ 4 BVerfSchG«, in: Wolf-Rüdiger Schenke/Kurt Graulich/Josef Ruthig (Hg.), Sicherheitsrecht des Bundes, 2. Aufl., München 2018, Randnummer 17.
[xvi]Dazu genauer Wolfgang Roth, »§ 4 BVerfSchG«, in: Wolf-Rüdiger Schenke/Kurt Graulich/Josef Ruthig (Hg.), Sicherheitsrecht des Bundes, 2. Aufl., München 2018, Randnummer 14 – 22.
[xvii]Siehe dazu etwa Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI), Allgemeine Politik Empfehlung Nr. 7, 2017, S. 5; Maisha-Maureen Auma, „Rassismus“, Bundeszentrale für politische Bildung. www.bpb.de/themen/migration-integration/dossier-migration/223738/rassismus/; Tarik Tabbara, „Von der Gleichbehandlung der ›Rassen‹ zum Verbot rassistischer Diskriminierung“, in: Der Staat 60 (2021) S. 582 ff.; Susanne Baer/Nora Markard, „Art. 3 Abs. 3“, in: v. Hermann Mangoldt/Friedrich Klein/Christian Starck (Hg.), Kommentar zum Grundgesetz, Band I, 7. Auflage, München 2018, Randnummer 469 f.
[i]Michael Wildt, Volk, Volksgemeinschaft, AfD, Hamburg 2017, S. 116.
[ii]Michael Wildt, Volk, Volksgemeinschaft, AfD, Hamburg 2017, S. 11 f.
[i]Mit dem Gebrauch des Begriffs „Rasse“ war in der Historie stets ein Herrschafts- oder Abhebungsanspruch verbunden, der das Kriterium der Abstammungsgemeinschaft in sich trug. Während der etymologische Ursprung des Begriffs „Rasse“ unklar ist, ist belegt, dass er in den romanischen Sprachen seit dem 13. Jahrhundert als „razza“ (italienisch), „raza“ (spanisch), „raca“ (portugiesisch) und „race“ (französisch) gebraucht wurde. Verstärkt wurde der Begriff erst im 16. Jahrhundert – im Englischen als „race“ – verwendet. In dieser Zeit wurde der Begriff „Rasse“ im Sinne von Abstammung und Zugehörigkeit zu einer bestimmten Familie, einem Haus von „edlem Geschlecht“ oder als Synonym für „Herrscherhaus“ gebraucht. Dabei basierte der Gebrauch des Begriffs auf der Vorstellung einer langen Ahnenreihe, in der sich hervorstechende Qualität vererbt. Der Begriff „Rasse“ hat demnach „Adel“ und „Qualität“ miteinander verbunden, was in romanischer wie auch englischer Sprache belegt ist, gelegentlich auch fürs Deutsche. In Frankreich versuchte der Geburtsadel ab Mitte des 16. Jahrhunderts unter Berufung auf seine „Rasse“ („Race“) den Aufstieg des Amtsadels zu verhindern. Mit dem Hinweis auf die „Reinheit des Blutes“ wurde „Rasse“ („Race“) zu einem politischen Schlüsselbegriff. Siehe dazu Hendrik Cremer, „… und welcher Rasse gehören Sie an?“ – Zur Problematik des Begriffs „Rasse“ in der Gesetzgebung, 2., aktualisierte Auflage, Deutsches Institut für Menschenrechte, Berlin 2009, S. 7, mit weiteren Nachweisen.
[ii]Die vorgenommenen Kategorisierungen nach unterschiedlichen menschlichen „Rassen“ variierten in ihren Erklärungsansätzen. So wurden ihre jeweiligen Merkmale – physische wie auch charakterliche – etwa mit verschiedenen Klimazonen begründet und erklärt. Andere verwiesen auf die historische Entwicklung der Menschheit als Erklärungsansatz: Demnach seien infolge der Völkerwanderung in verschiedene Regionen der Welt unterschiedliche menschliche Merkmale entstanden. Wieder andere stützten sich auf anatomische Untersuchungen wie Schädelmessungen oder kombinierten verschiedene Erklärungsansätze.
[iii]Encyclopedia of Race & Racism, Volume 1, in: John Hartwell Moore (Hg.), Detroit 2008, „Introduction“, S. XI.
[iv]Encyclopedia of Race & Racism, Volume 1, in: John Hartwell Moore (Hg.), Detroit 2008, „Introduction“, S. XII.
[v]Zum ersten Mal in Bezug auf Juden wurde der Begriff der „Rasse“ („Raza“) 1492 im Zwangsbekehrungsedikt der spanischen Reconquista gebraucht. Dabei wurde mit der Forderung nach „Reinheit des Blutes“ zudem ihre Sonderstellung manifestiert, die sie über die Konversion hinaus aus der spanischen Gesellschaft ausschließen sollte. Christian Geulen, Geschichte des Rassismus, München 2007, S. 14.
[vi]Werner Conze, „Rasse“, in: Otto Brunner/Werner Conze/Reinhart Koselleck (Hg.), Geschichtliche Grundbegriffe, Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Band 5, Stuttgart 1984, S. 174; Johannes Zerger, Was ist Rassismus? Eine Einführung, Göttingen 1997, S. 45.
[vii]Siehe zu den Hintergründen des Begriffs Werner Bergmann, „Was heißt Antisemitismus?“ Bundeszentrale für politische Bildung, 2006. www.bpb.de/themen/antisemitismus/dossier-antisemitismus/37945/was-heisst-antisemitismus/.
[i]Siehe dazu etwa Rainer Huhle, „Kurze Geschichte der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“, Bundeszentrale für politische Bildung, 12. 10. 2008. www.bpb.de/themen/recht-justiz/dossier-menschenrechte/38643/kurze-geschichte-der-allgemeinen-erklaerung-der-menschenrechte/.
[ii]Siehe hierzu etwa W. Mark Janis/Richard S. Kay/Anthony W. Bradley, European Human Rights Law, Text and Materials, Third Edition, New York 2008, S. 12 ff. Die EMRK nimmt in ihrer Präambel ebenfalls auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 Bezug, in der Erwägung, dass diese Erklärung bezweckt, die universelle und wirksame Anerkennung und Einhaltung der in ihr aufgeführten Rechte zu gewährleisten.
[iii]Dazu genauer Vincent Klausmann, Meinungsfreiheit und Rechtsextremismus. Das antinationalsozialistische Grundprinzip des Grundgesetzes, Baden-Baden 2019, S. 143 ff.
[iv]Vgl. Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 17. 01. 2017, Aktenzeichen 2 BvB 1/13, Leitsatz 3, Randnummer 538.
[v]Vgl. Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 17. 01. 2017, Aktenzeichen 2 BvB 1/13, Randnummer 538 – 541.
[vi]Vgl. Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 17. 01. 2017, Aktenzeichen 2 BvB 1/13, Randnummer 538 – 541.
[vii]Vgl. Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 17. 01. 2017, Aktenzeichen 2 BvB 1/13, Randnummer 538.
[viii]Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 17. 01. 2017, Aktenzeichen 2 BvB 1/13, Randnummer 541.
[ix]Vgl. Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 10. 10. 2017, Aktenzeichen 1 BvR 2019/16, Randnummer 59; siehe dazu ebenso unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR): Anne Peters/Tilmann Altwicker, „Kapitel 21: Das Diskriminierungsverbot“, in: Oliver Dörr/Rainer Grote/Thilo Marauhn (Hg.), EMRK/GG Konkordanzkommentar, Band II, 3. Auflage, Tübingen 2022, Randnummer 75.
[x]Vgl. Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 2. 11. 2020, Aktenzeichen 1 BvR 2727/19; Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 17. 01. 2017, Aktenzeichen 2 BvB 1/13, Randnummer 541.
[xi]Siehe dazu etwa Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 21. 04. 2016, Aktenzeichen 7 A 11108/14; Verwaltungsgericht Dresden, Urteil vom 01. 02. 2017, Aktenzeichen 6 K 3364/14.
[xii]Siehe hierzu etwa Susanne Baer/Nora Markard, „Art. 3 Abs. 3“, in: Hermann v. Mangoldt/Friedrich Klein/Christian Starck (Hg.), Kommentar zum Grundgesetz, Bd. I, 7. Auflage, München 2018, Randnummer 469 f.; Hendrik Cremer, Das Verbot rassistischer Diskriminierung. Vorschlag für eine Änderung von Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz, Deutsches Institut für Menschenrechte, Berlin 2020, S. 19 ff., mit weiteren Nachweisen.
[xiii]Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 17. 01. 2017, Aktenzeichen 2 BvB 1/13, Randnummer 541; siehe dazu ebenso Gunter Warg, „Der Extremismusbegriff aus juristischer Sicht – Grundlagen und aktuelle Entwicklungen“, in: Hendrik Hansen/Armin Pfahl Traughber (Hg.), Jahrbuch für Extremismus und Terrorismusforschung 2019/20 (I), Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung, Brühl 2021, S. 93 f.
[i]News4Teachers. Das Bildungsmagazin, „›Belastungsfaktoren‹: Thüringer AfD-Chef Höcke will behinderte Kinder vom Regelunterricht ausschließen.“ www.news4teachers.de/2023/08/belastungsfaktoren-thueringer-afd-chef-hoecke-will-behinderte-kinder-vom-regelunterricht-ausschliessen/.
[ii]Siehe zu alledem Bundesministerium der Justiz, „Menschenrechte“,
2023. www.bmj.de/DE/themen/menschenrechte/menschenrechte_node.html.
[i]Das gilt insbesondere für öffentlich kommunizierte Positionen, daneben gibt es bis heute rechtsextreme Milieus, in denen weiterhin von „Rasse“ gesprochen wird.
[ii]Siehe dazu beispielhaft und zugleich sehr eindrücklich: Daniel Peters/Matthias Lemke, „›Ethno-religiöse Brückenköpfe‹, ›postheroische Handlungseunuchen‹ und die ›Selbsterhaltung des Volkes in seiner optimalen Form‹“. Neurechte Positionen und ihre Verbreitungsstrategie in den Schriften des Bundespolizei-Professors Stephan Maninger«, In: Martin H. W. Möllers/Robert Chr. van Ooyen (Hg.), Jahrbuch Öffentliche Sicherheit 2022/2023, S. 53 – 113.
[iii]Vgl. § 43 Bundesverfassungsgerichtsgesetz (BVerfGG).
[iv]Erforderlich ist dafür, dass die Mehrheit des Bundestags für die Einleitung eines Verbotsverfahren stimmt. Dazu haben zahlreiche Abgeordnete im Zuge der Wanderwitz-Initiative, kurz vor Ende der 20. Legislaturperiode, im Bundestag einen Antrag auf den Weg gebracht, Deutscher Bundestag, Drucksache 20/13750 vom 13.11.2014, dserver.bundestag.de/btd/20/137/2013750.pdf. Ob es darüber noch zu einer Abstimmung kam, war bei Fertigstellung dieses Buches noch offen.
[v]Sebastian Friedrich/Nils Schniederjann, „CDU-Abgeordneter will AfD-Verbot beantragen“, Tagesschau, 05. 10. 2023. www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/afd-verbot-cdu-wanderwitz-100.html.
[vi]Siehe hierzu bereits: Hendrik Cremer, Warum die AfD verboten werden könnte. Empfehlungen an Staat und Politik, Deutsches Institut für Menschenrechte, Berlin 2023.
[vii]Siehe dazu etwa Spiegel online, „Ende des Parteitags: AfD verleugnet laut Verfassungsschutz die Würde des Menschen“, 07. 08. 2023. www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-verleugnet-laut-verfassungsschutz-die-wuerde-des-menschen-a-4d6f8f5e-6011-47cc-b837-f754c0a8e919.
[viii]Verwaltungsgericht Köln, Urteil vom 08. 03. 2022, Aktenzeichen 13 K 326/21. www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/vg_koeln/j2022/13_K_326_21_Urteil_20220308.html.
[ix]Dabei beziehen sich die Ausführungen des Gerichts insbesondere auf die Jugendorganisation der Partei „Junge Alternative“ (Verwaltungsgericht Köln, Urteil vom 08. 03. 2022, Aktenzeichen 13 K 326/21, Randnummer 216 – 530) und den mittlerweile offiziell aufgelösten „Flügel“ (Randnummer 531 – 842) als Teilorganisationen der Partei (Randnummer 843). Das Gericht geht aber auch auf die AfD als Gesamtpartei ein (Randnummer 844 – 927). Es kommt zu dem Ergebnis, dass, auch mit Blick auf die Gesamtpartei, ausreichende tatsächliche Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen innerhalb der AfD vorliegen, die sich gegen die in Artikel 1 Abs. 1 Grundgesetz verbriefte Garantie der Menschenwürde richten, um sie als Verdachtsfall einzustufen (Randnummer 928 – 965).
[x]Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, „Bundesamt für Verfassungsschutz darf AfD und JA als Verdachtsfall beobachten“, Pressemitteilung, 13. 05. 2024. www.ovg.nrw.de/behoerde/presse/pressemitteilungen/23_240513/index.php.
[xi]Siehe dazu auch Ronen Steinke, Verfassungsschutz. Wie der Geheimdienst Politik macht, Berlin 2023, S. 175 – 198.
[xii]Siehe zu den erfolgten Einstufungen Deutschlandfunk, „Verfassungsschutz: Die AfD und der Verdachtsfall“, 06. 03. 2021. www.deutschlandfunk.de/verfassungsschutz-die-afd-und-der-verdachtsfall-100.html.
[xiii]Ausnahmen bilden die Landesverbände Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen, die vom jeweiligen Landesamt für Verfassungsschutz bereits als „erwiesen rechtsextremistisch“ eingestuft worden sind.
[xiv]Angemerkt sei hier noch Folgendes: Bei den Maßstäben des Bundesverfassungsschutzgesetzes zur Einstufung einer Partei und bei dem Maßstab für das Verbot einer Partei gemäß Artikel 21 GG gibt es Überschneidungen, und zwar bei der Frage, ob eine Partei das Ziel verfolgt, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beseitigen. Überschneidungen gibt es ebenfalls hinsichtlich der Frage, ob eine Partei zur Verwirklichung dieses Ziels aktiv vorgeht. Anders als beim Parteiverbot kommt es nach den Maßstäben des Bundesverfassungsschutzgesetzes nicht darauf an, ob es konkrete Anhaltspunkte dafür gibt, dass die Partei Erfolg haben könnte, ihre verfassungsfeindlichen Ziele zu verwirklichen. Die Einstufung einer Partei als „erwiesen rechtsextremistische Bestrebung“ durch das Bundesamt für Verfassungsschutz ist im Übrigen kein Erfordernis dafür, beim Bundesverfassungsgericht einen Antrag auf Prüfung der Verfassungswidrigkeit der Partei zu stellen. Siehe zu alledem genauer Hendrik Cremer, Warum die AfD verboten werden könnte. Empfehlungen an Staat und Politik, Deutsches Institut für Menschenrechte, Berlin 2023, S. 11 – 19.
[xv]So lautete der Titel eines Essays von Michel Friedman, der im Juni 2023 im Stern online erschienen ist. Michel Friedman: „›Je länger wir schweigen, desto mehr Mut werden wir brauchen‹“ – der Publizist Michel Friedman über den Aufstieg der AfD«, Stern, 28. 06. 2023. www.stern.de/politik/deutschland/michel-friedman-ueber-den-aufstieg-der-afd--dann-packe-ich-meine-koffer-33596374.html. Im Übrigen war das die Stern-Ausgabe mit Alice Weidel auf dem Cover, dazu mehr in Kapitel 5. In der Printausgabe lautete der Titel von Friedmans Essay: „Dann packe ich meine Koffer. Der jüdische Publizist Michel Friedmann über die Gefahr durch die AfD und die Schwäche der Demokraten“, Stern, Nr. 27, 29. 06. 2023, S. 40 – 45.
„Um mit dem fortgeschrittenen Angriff auf die freiheitliche rechtsstaatliche Demotkratie umgehen zu können, braucht es als Grundlage Wissen über gängige Argumentationsmuster und Strategien, die bei der Verbreitung rechtsextremen Gedankenguts eingesetzt werden.
Dieses Buch möchte dazu beitragen, dass mehr Menschen rechtsextremes Gedankengut als solches erkennen und die Gefahren verstehen, die insbesondere von der AFD ausgehen." Hendrik Cremer
„Niemand, der Cremers Buch gelesen hat, kann behaupten, er habe nichts gewusst.“
„Die AfD ist gefährlich ›für das friedliche Zusammenleben der Menschen in Deutschland‹. Sie zielt darauf ab, ›die Garantien des Grundgesetzes zu beseitigen‹. Sie will ›die freiheitliche rechtsstaatliche Demokratie als historische Errungenschaft zerstören‹. Hendrik Cremer begründet diese seine Feststellungen klar, verständlich und gut belegt. (...) Wer die Grundrechte liebt, der weiß nach der Lektüre des Buches, warum es sie vor der AfD zu schützen gilt.“
„Man kann dem Juristen Hendrik Cremer nur dafür danken, mit welcher Klarheit er in seinem Buch ›Je länger wir schweigen, desto mehr Mut werden wir brauchen‹ diese Desinformationsbemühungen ein ums andere Mal konterkariert und die antidemokratischen, antisemitischen und insgesamt menschenverachtenden Inhalte der Partei offen legt.“
„Cremers ›Je länger wir schweigen, desto mehr Mut werden wir brauchen‹ ist nun ein leidenschaftlicher Appell und von der Aussage her sehr deutlich: Die AfD ist brandgefährlich, ideologisch absolut gefestigt und gewaltbereit – und wird von großen Teilen der Bevölkerung unterschätzt. Daher schlägt der Jurist und Menschenrechtler einen engagierten Ton an, möchte mit seinem Buch Aufklärungsarbeit leisten.“
„Das Buch klärt nicht nur auf, es gibt dem Laien auch Argumente in die Hand, um den Parolen der Rechtspopulisten und Extremisten zu begegnen.“
„Das Buch warnt davor, die AfD als ›rechtspopulistisch‹ zu verharmlosen, betont ihre Gewaltbereitschaft – und benennt auch sehr klar, wie verbreitet der Antisemitismus in der Partei ist.“
„Hendrik Cremer zeigt auf, wie sich der Kurs der AfD radikalisiert hat.“












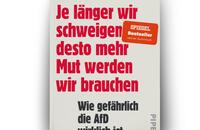

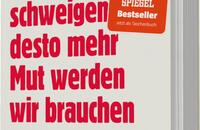
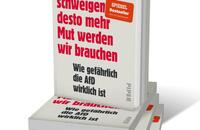



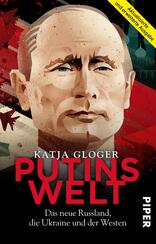
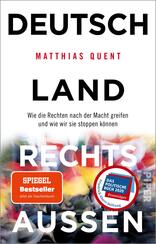
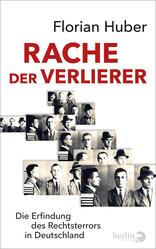
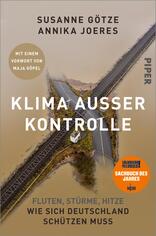
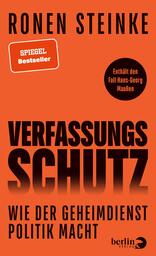
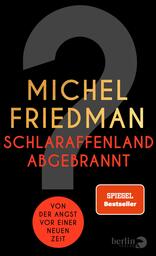
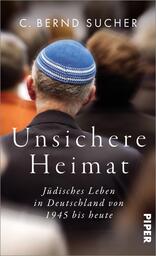
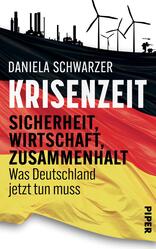
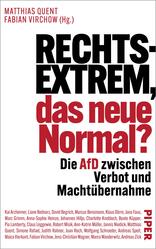
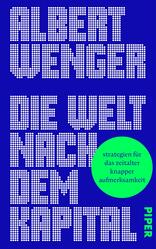



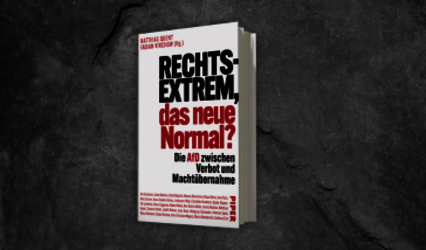


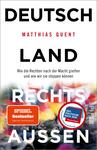
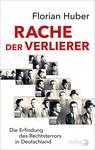
Sehr geehrter Herr Cremer Es ist leicht ,in einer bevorzugten Position über die rechte Gefahr ein Buch zu schreiben. Gehen Sie den Hintergründen nach. Das "Volk" ist empört über die Ungleichbehandlung der Gesellschaft. Haben Sie eine "Proletarier " Krankenversicherung? Sitzen Sie stundenlang beim Arzt,um nach 2 Minuten wieder "draussen " zu sein.? Oder können Sie den Service geniessen, als Privatpatient behandelt zu werden? Haben Sie sich die Gehälter der Vorstände angeschaut? Warum eine Toilettenfrau ,ohne die die ganze Hygiene in öffentlichen Toiletten, oder auch z b im Bundestag zusammenbrechen würde, in unserer Gesellschaft deklassiert wird. Es hat sich ein neuer Status bei uns eingeschlichen. Bestimmte studierte Berufe treten an die Stelle des Adels. Dass ein handwerklicher Beruf auch mit dem Kopf ausgeführt werden muss,ist nicht relevant. Es wäre nützlich,darüber ein Buch zu schreiben. Gruss, Monika Schütte
Ein aktuelles, gründlich recherchiertes politisches Sachbuch, mit dem sich aus unsicherer Meinung zur AfD sicheres Wissen über diese schein-demokratische Partei gewinnen lässt. Mädler
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.