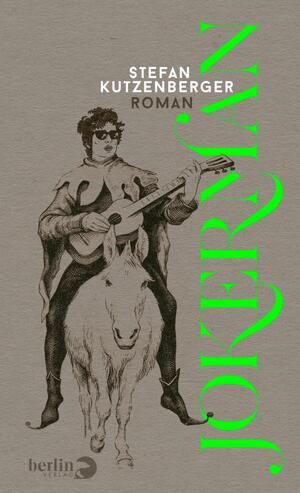
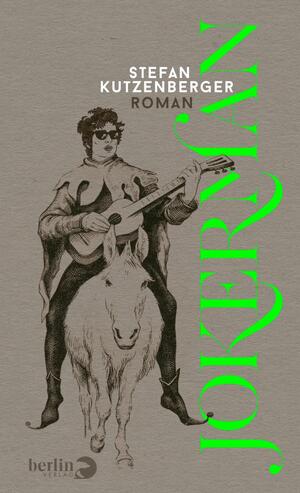
Jokerman Jokerman - eBook-Ausgabe
Roman
— Ein spannender und witziger Roman über eine Weltverschwörung und Bob Dylan„Eine Art Schelmen-Thriller, der mindestens im doppelten Wortsinn komisch ist.“ - Wiener Zeitung
Jokerman — Inhalt
„Jokerman dance to the nightingale tune ...“ Bob Dylan
Sein Name ist Kutzenberger, Stefan Kutzenberger. Der melancholische Österreicher hat den Auftrag, die Welt zu retten, denn er ist der Jokerman. Schuld daran ist kein Geringerer als Bob Dylan, auch wenn der gar nichts davon weiß. All die Menschen, die das Werk des Musikers und Literaturnobelpreisträgers seit Jahrzehnten wie eine heilige Schrift deuten, haben den Jokerman auserkoren, die Wiederwahl eines der bizarrsten Tyrannen unserer Tage ins Weiße Haus zu verhindern.
Mit Verve und Witz zeigt dieser Roman, wie Verschwörungsszenarien entstehen und sich so gut wie alles erklären lässt mit einer „wahren“ Lehre ... Ein entlarvender Spiegel der Gegenwart, eine literarische Entdeckung und ein Riesenspaß
„Es rockt, es swingt; gut wär’s, wenn man ›Jokerman‹ in der Hosentasche mit sich herumtragen könnte, um bei jeder Gelegenheit wieder darin zu lesen.“ Michael Köhlmeier
„Stefan Kutzenberger weiß: Es ist Bob Dylans Welt, wir leben nur darin.“ Maik Brüggemeyer
Leseprobe zu „Jokerman“
I know words, I have the best words.
Donald Trump
Well, well, well.
Bob Dylan
PORTUGAL
I
Das erste Mal hörte ich Bob Dylans Jokerman im Auto eines deutschen Austauschstudenten. Viele Jahre später sollte mir einer der großen Schriftsteller unserer Zeit sagen, dass der erste Satz eines Romans zwar wichtig sei, aber doch meist überschätzt. Nur, um dann etwas gönnerhaft hinzuzufügen: Keine Sorge, dein Anfang ist gut. Aus einer eitlen oder kindischen Reaktion heraus war ich daraufhin versucht gewesen, die ersten Sätze dieses Romans umzuschreiben oder gar zu [...]
I know words, I have the best words.
Donald Trump
Well, well, well.
Bob Dylan
PORTUGAL
I
Das erste Mal hörte ich Bob Dylans Jokerman im Auto eines deutschen Austauschstudenten. Viele Jahre später sollte mir einer der großen Schriftsteller unserer Zeit sagen, dass der erste Satz eines Romans zwar wichtig sei, aber doch meist überschätzt. Nur, um dann etwas gönnerhaft hinzuzufügen: Keine Sorge, dein Anfang ist gut. Aus einer eitlen oder kindischen Reaktion heraus war ich daraufhin versucht gewesen, die ersten Sätze dieses Romans umzuschreiben oder gar zu streichen, vor allem, da es mir ohnehin zu weit hergeholt erschien, meine Geschichte, die mich schließlich bis ins Weiße Haus führte, mit einer Erinnerung aus der Studentenzeit zu eröffnen. Andererseits sollte mir gerade durch die hier zu berichtenden Ereignisse ein für alle Mal klar geworden sein, dass es nichts gibt, das zu weit hergeholt ist, dass alles mit allem auf wenig nachvollziehbare schicksalhafte – oder perfid manipulierte – Weise verbunden ist. Deshalb ließ ich den Anfang meines Texts dann doch so wie ursprünglich geplant, beginne mit dem ersten Satz und setze fort mit dem zweiten und dritten und so weiter, immer weiter, bis wir schließlich an die Stelle gelangen, an der der weltberühmte, indischstämmige Autor den Beginn meines Romans lobt, und es mich, bereits im letzten Viertel dieses Buchs, gar nicht mehr wundert, woher er diesen kannte. Er hatte damals auch den Titel Jokerman für gut befunden und abgesegnet. Diesen Song hatte ich also das erste Mal in Portugal, im Auto von Marcel, gehört. Und hier kommt nun der zweite Satz:
Es war dies in der Version Caetano Velosos, dessen Stimme Stine später, in Island, als die schönste des zwanzigsten Jahrhunderts bezeichnen sollte, womit sie nicht ganz unrecht hatte, bedenkt man das so frei schwebende und sanfte Timbre, das gelenkig alle Areale der Harmonie und der Seele mühelos zu erreichen vermag. Die Freiheit der Straße war so überwältigend, dass wir, Lissabon im Rücken, die Fenster hinunterkurbelten und laut johlend der Zukunft entgegenflogen. Als uns die Puste ausging, drückte Marcel eine Kassette in den Schlitz am Autoradio, und eine zaghafte Gitarre begann zu einem blubbernden Bongo-Rhythmus ein paar Töne zu zupfen, begleitet von einem kratzenden Cello, bis ich zum ersten Mal Caetanos Stimme hörte: Standing on the waters casting your bread / While the eyes of the idol with the iron head are glowing, und das glooooowing streckte er wackelnd und tremolierend in die Länge, sodass es den Anschein hatte, es ginge nahtlos in das blooooowing des nächsten Verses über, auch wenn da viele Wörter dazwischenlagen. Marcel sang mit, denn er konnte immer alle Texte aller Strophen aller Lieder auswendig und ich dagegen nie, nicht einmal die leichtesten und bekanntesten Refrains schafften es in meinen Kopf. Doch als Caetano dann mit dem Chorus loslegte: ohohohohoh Jokerman, und das ohohohohoh kein Ende nehmen wollte und wie das verzweifelte Jodeln eines liebestrunkenen Senners oder Seemanns aus den Lautsprechern dröhnte, stimmte ich einfach ein, auch wenn ich das Lied noch nie zuvor gehört hatte, und die portugiesische Frühlingsluft wirbelte in unser Auto, und die Plattenbauten trauriger portugiesischer Vorstädte tanzten an uns vorbei. Jokerman dance to the nightingale tune.
Das war noch im letzten Jahrhundert, 1997, ich war in Lissabon gewesen, um dort an meiner Dissertation zum Einfluss der europäischen Philosophie auf den brasilianischen Modernismus zu arbeiten. Die Wiener Bibliotheken gaben zu diesem Thema nicht besonders viel her, also hatte ich ein Erasmus-Stipendium beantragt, in der irrigen Annahme, dass es in Portugal durch die sprachliche und historische Verbindung leichter wäre, zu einem brasilianischen Thema zu forschen. Ich hätte nach Berlin gehen sollen, wie ich ein paar Jahre später erkannte, als ich dort in drei Tagen in der Bibliothek des Ibero-Amerikanischen Instituts all die Literatur fand, die ich selbst auf einer Forschungsreise durch Brasilien nicht hatte auftreiben können, wo, wie ich in der Universität von Fortaleza verwirrt feststellen musste, die Bücher nach den Vornamen der Autoren aufgestellt waren. In Lissabon waren die Bibliotheken gleich ganz geschlossen, da es regnete. Die Portugiesen vergessen jeden Sommer, dass es im Winter regnet, und dichten daher ihre Dächer nicht ab, weswegen im Winter die Bibliotheken nicht benutzbar sind. Da auch viele Schulen bei Regen nicht geöffnet werden können, ist es schwierig, sich in dieser Stadt weiterzubilden, was zur Folge hat, dass alle ahnungslos bleiben und im Sommer wieder vergessen, dass es winters regnet. Ein Teufelskreis, der zumindest bis 1997 nicht durchbrochen worden war.
Ich suchte also verzweifelt Literatur zum brasilianischen modernismo der 1920er-Jahre, sah das nasskalte Chaos um mich herum ziemlich humorbefreit und wurde melancholisch und gemütskrank, anstatt wie alle anderen Erasmus-Studenten einfach zu feiern. Die anderen Erasmus-Studenten waren vor allem Erasmus-Studentinnen und da wiederum meist Deutsche. Einheimische lernte ich nicht kennen, aus den verschiedensten Gründen. Der wesentlichste war aber wohl, dass ich nie ausging und wenn doch, mit niemandem sprach, am wenigsten mit den Portugiesen, die mir stoisch, stur und stupid vorkamen. Das Haus, in dem ich ein Zimmer bezogen hatte, lag am wunderschönen, zentralen Largo da Graça, weswegen trotz meines leicht als abweisend und arrogant misszuverstehenden Verhaltens immer wieder deutsche Studentinnen vorbeikamen, um mich auf verschiedene Veranstaltungen mitzuschleppen. So lernte ich langsam doch ein paar Lokale, ein ziemlich gutes Programmkino und auch andere Stadtteile kennen. Einmal unternahmen wir sogar einen Ausflug an die Algarve, wo wir badeten und einen berühmten Leuchtturm besuchten. Es hätte schön und unbeschwert sein können, doch ich konnte und wollte nicht. Die meiste Zeit blieb ich in meinem feuchtkalten Zimmer und starrte auf den Laptop, der heutzutage einen Platz im Technischen Museum verdient hätte, so wenig hat er gemein mit mobilen Endgeräten von heute. Auf den Laptop starrte ich vor allem deshalb, weil ich versuchte, herabfallende Spielsteine so platzschonend wie möglich anzuordnen. Ob mein Tetris-Rekord (12 434 Punkte) gut war, konnte ich mangels Vergleichsmöglichkeit nicht herausfinden. Weihnachten verbrachte ich in einem Shoppingcenter, um wenigstens kurz einmal so etwas wie blank geputzte Zivilisation zu erleben. Silvester wurde ich um drei Uhr nachts in einem Hinterhof von vier Männern mit einem Tischbein oder Baseballschläger verprügelt. Anstatt wegzulaufen, schrie ich immer wieder: Por que? Warum? Erst als eine alte Frau ihr Fenster öffnete, zu uns nach unten blickte und mir zurief: Lauf doch, mein Sohn, so lauf doch!, gelang es mir, mich von meinen Angreifern zu lösen. Sie raubten mir Uhr und Portemonnaie. Nach zehn Tagen im Bett erkannte ich, dass ich nicht ewig liegen bleiben konnte. Die Wunden im Gesicht waren so weit geheilt, ich konnte wieder essen, die Quetschungen der Oberschenkel sollten noch monatelang schmerzen, doch hinderten sie mich nicht daran, aufzustehen oder einem normalen Tagesablauf nachzugehen. Von einer Erasmus-Studentin, die mich mehrmals am Krankenbett besucht hatte, erfuhr ich, dass Marcel, ein deutscher Student, den ich nicht kannte, mit dem Auto in den Norden zurückfahren wolle, da man ihm in Hamburg einen Job angeboten habe. Ich beschloss, ihn zu fragen, ob ich bis Madrid mitfahren könnte, ich musste raus aus dieser elenden, untergehenden Stadt, Spanien war meine Rettung, dort verstand ich die Sprache, dort gab es Kultur, dort gab es logisches Denken, dort gab es Leben, das diese Bezeichnung verdiente.
Das Einzige, das Portugal der Welt geschenkt hatte, war das große Erdbeben von Lissabon im Jahr 1755, das eine so entsetzliche Verwüstung anrichtete, dass man sich die Frage stellte, ob Gott gut sein konnte. Warum hatte das Beben die Hauptstadt eines streng katholischen und die ganze Welt missionierenden Landes getroffen? Und warum zu Allerheiligen? Warum war die Zerstörung über so viele Kirchen gekommen, ausgerechnet das Rotlichtviertel Lissabons, die Alfama, aber verschont geblieben? Gelehrte wie Kant, Lessing und sogar der junge Goethe diskutierten diese Fragen. Und dann schrieb Voltaire seinen Candide, und Portugal hatte erstmals, zumindest auf indirekte Weise, eine große kulturelle Leistung ermöglicht. Wir lebten nicht in der besten aller möglichen Welten, war seine Aussage, Portugal sei der Beweis dafür. Ich musste weg, Marcel war meine Rettung.
Zwei Tage später saßen wir in seinem blau-metallic glänzenden Renault 9. Marcel war zwei Jahre jünger als ich, im Gegensatz zu mir allerdings bereits kurz vor Fertigstellung seiner Dissertation über João Guimarães Rosa, angeblich der wichtigste Schriftsteller Brasiliens des zwanzigsten Jahrhunderts, auch wenn ich von ihm noch nie gehört hatte. Als ich verlegen das Thema meiner Doktorarbeit nannte, hielt mir Marcel einen geschliffenen Vortrag über die europäischen Einflüsse auf den brasilianischen Modernismus. Nach einer halben Stunde geballten Wissens sagte er, eigentlich kenne er sich da aber gar nicht so aus. Natürlich war es ihm aufgefallen, wie blank ich war, auch, dass ich kaum Portugiesisch konnte. Er selbst sprach wie ein Einheimischer. Sicher dachte er sich seinen Teil über das österreichische Unisystem, das Leute wie mich bis zur Dissertation durchließ. Trotzdem fühlte ich mich nicht unwohl neben ihm auf dem Beifahrersitz. Mit jedem Satz, den wir wechselten, bewegten wir uns weiter weg von Lissabon, das war es, was für mich zählte.
Wir wollten die erste Nacht in Coimbra verbringen, der ältesten Universitätsstadt Portugals. Marcel parkte das Auto in einer kleinen Nebengasse des Zentrums, und wir landeten nur Minuten später auf einem turbulenten Studentenfest. War es diese sehr attraktiv wirkende Umgebung, die solche Wunder ermöglichte, die unschuldige Neugier zweier unbekümmert Durchreisender oder doch einfach Marcels Sprachkenntnis? Wir stürzten uns in die Party, wurden gleichsam von ihr aufgesogen, im Wirbel voneinander getrennt, durch verschiedene Korridore, Zimmer, Kammern, Stiegen, Schächte und Gänge gespült und fanden uns schließlich weit nach Mitternacht in einem Extraraum des Studentenheims wieder, dessen Möbel von großen weißen Laken verhüllt waren. Ich saß betrunken und erleichtert auf einem der mit diesen weißen Tüchern bedeckten Sessel. Betrunken vom aus kleinen Tassen getrunkenen Zuckerrohrschnaps, erleichtert, dass ich anscheinend doch noch Spaß haben konnte, sorglos zu lachen vermochte, das Leben als Oberfläche wahrnehmen durfte, so wie es die anderen auch taten, ohne zwanghaft auf den Grund blicken zu müssen.
In meinem Zimmer in Lissabon war eine Kaffeetasse längst keine Kaffeetasse mehr gewesen, ich hatte sie nur mehr sehen können, wie sie einem Ochsen oder einem Außerirdischen erscheinen musste, ich hatte sie angesehen, ohne ihre Bestimmung zu verstehen, als ein unverständliches Gebilde aus Keramik, eine um einen Hohlraum errichtete Wand, von der außen ein Wulst abstand. In Coimbra aber nahm ich ein solches Ding einfach in die Hand und schenkte es randvoll mit Zuckerrohrschnaps, und da war es wieder eine Tasse.
Drei Mädchen waren mit uns in dem weißen Zimmer. Eine große Brasilianerin, eine blonde Portugiesin und eine kleine Dunkelhaarige. Sie saßen alle drei um mich herum und amüsierten sich in aller Freundlichkeit über meine rudimentären Sprachkenntnisse. Marcel saß ebenfalls auf einem mit weißem Tuch bedeckten Lehnstuhl und sagte, er müsse sich wohl auch einen Akzent zulegen. Von der Tanzfläche im Nebenzimmer war laute Musik zu hören, Show me from behind the wall, sang Caetano Veloso auf Englisch. Dann gingen wir wieder durch das Haus, die Stiegen hinauf, in ein Zimmer hinein und auf der anderen Seite wieder hinaus in das nächste. Matratzen mit offensichtlich ungewaschenen Leintüchern lagen in beiden Räumen am Boden, daneben Aschenbecher, Weinflaschen, Bücher. Eine Weltkarte mit vielen bunten Ländern hing an der Wand, dahinter war im nächsten Raum eine Küche, am Tisch saßen ein paar rauchende Studenten, niemand beachtete uns. Wie bei einem Kindertanz oder einem Trinkspiel nahmen wir uns bei der Hand und gingen in einer langen Reihe weiter. Vorne die Brasilianerin, dann Marcel, dann das große blonde Mädchen, dann ich, dann die Kleine. Das nächste Zimmer war das Badezimmer, auch hier konnte man durchgehen, auf der anderen Seite kam die Waschküche. Anscheinend gehörte diese dem ganzen Haus, drei Waschmaschinen standen an der Wand, gegenüber lehnte ein Staubsauger neben einem Regal mit Haushaltssachen. Hier blieben wir stehen. Die Brasilianerin setzte sich auf die mittlere Waschmaschine.
Ihr müsst hierbleiben, sagte sie auf Portugiesisch.
Müssen wir ohnehin, denn wir haben noch gar kein Hotel gesucht, sagte Marcel.
Nein, wir meinen für immer!, rief die kleine Braunhaarige, die noch immer meine Hand hielt.
Immer ist lang, sagte jemand.
Dann begannen wir uns wieder in einer Reihe aufzustellen, nahmen uns bei den Schultern und gingen in der Waschküche im Kreis.
Stefan kann dableiben, sagte Marcel. Ich muss heim nach Deutschland.
Por que?, fragten alle im Chor, und Marcel erklärte, dass er eine Assistentenstelle an der Hamburger Uni angeboten bekommen hatte, um seine Forschungen zur brasilianischen Literatur weiterzuführen. Und dann erzählte er uns lallenden, im Kreis wankenden Gestalten von seinen Studien zur Kulturtransferforschung, seinen Theorien zum sozialen Feld der Literatur, von seinen Arbeiten zum Werk von João Guimarães Rosa, dem großartigsten und wichtigsten brasilianischen Autor des zwanzigsten Jahrhunderts, wie er wiederholte, und wir wussten alle, dass er recht hatte, er, der uns voranging, obwohl wir uns im Kreis ohne Anfang und Ende bewegten, er, der noch solche Sachen von sich geben konnte, obwohl er mindestens so viel getrunken hatte wie wir. Und dann schliefen wir entweder kurz danach oder viel später auf einer der Matratzen ein.
Als Marcel mich weckte, war es zehn Uhr. Ich hatte entsetzliche Kopfschmerzen und einen unglaublichen Durst. Halb auf mir lagen die Brasilianerin und die kleine Portugiesin im Tiefschlaf, mich mit ihren Armen fest umschlungen haltend. In der Küche nahm ich irgendein herumstehendes Glas und schüttete, ohne abzusetzen, zwei, drei, vier Ladungen Wasser in mich hinein.
Ich fahre jetzt, sonst geht sich das alles nicht aus, sagte Marcel. Aber ich verstehe natürlich, wenn du bleiben möchtest, du müsstest dann nur deine Sachen aus dem Auto holen.
Nichts hätte ich lieber getan, als mich wieder hinzulegen, mich zwischen die warmen, weichen Mädchenkörper zu zwängen und weiterzuschlafen, bis aller Schmerz verschwunden war. Hinter dem scharfen Stechen in meinem Kopf spürte ich, dass es mir eigentlich gut ging. So gut wie seit Monaten nicht mehr, eine heitere Leichtigkeit hatte die stumpfe Schwere Lissabons verdrängt. Wie schön wäre es, ein paar Tage in diesem Haus zu verbringen. Hier könnte ich endlich Portugiesisch lernen, mit Menschen reden, eine Hand in der meinen halten.
Nein, nein, gerne fahre ich noch ein Stück mit dir mit. Bis nach Madrid, wie ausgemacht, sagte ich, und bis heute weiß ich nicht, warum.
Nach ein paar Kilometern mussten wir anhalten, weil ich eine Kopfwehtablette aus dem Kofferraum brauchte. Mittags machten wir bei römischen Ausgrabungen eine Pause. Außer uns ging nur ein älteres Ehepaar von Mosaik zu Mosaik. Ich hörte, dass sie österreichisch sprachen, und grüßte. Er stellte sich mit Schubert vor. Nicht der Komponist, sondern der Burgschauspieler, sagte er. Dann ging es die Berge hinauf. Im letzten Haus vor der spanischen Grenze legten wir in einer kleinen, gottverlassenen Taverne einen weiteren Halt ein. Ich konnte bereits wieder feste Nahrung zu mir nehmen, und wir teilten uns eine Vorspeisenplatte. Als der Wirt fragte, ob wir Rotwein dazu haben wollten, war ich sogar wieder versucht, doch Marcel blieb als Chauffeur vernünftig und bestellte uma Coca, ich schloss mich dem an. Ein Mann am einzigen anderen besetzten Tisch begann auf einer Gitarre zu spielen und sang, They say ev’ry man needs protection / They say ev’ry man must fall. Seine wunderschöne Freundin klatschte den Rhythmus und begann beim Refrain eine aberwitzig hohe zweite Stimme zu singen: Any day now, any day now / I shall be released. Ich glaubte ihr. Bald hätte ich es geschafft, bald wäre ich befreit. Erstens weg aus Portugal und zweitens überhaupt. I see my light come shining / From the west unto the east. Das entsprach genau unserer Route. Die beiden Musiker sangen noch ein paar Lieder, Neil Youngs Heart of Gold und eine langsame, sehr zärtliche Version von Lou Reeds Sweet Jane, die das Mädchen alleine darbrachte, während ihr Freund behutsam den zweitbesten Riff der Rockgeschichte immer und immer wieder spielte. Danach klatschten wir, und sie kamen herüber zu unserem Tisch. Sie waren Holländer auf dem Weg zu einem Musikfestival in der Nähe. Wir sollten doch mitkommen! Aber Marcel wollte weiter, und ich musste mit.
Als wir an Salamanca vorbeifuhren, erzählte er mir über Napoleons Feldzug durch die Iberische Halbinsel, wie die portugiesische Krone vor dem französischen Heer nach Brasilien flüchtete und wie sich damit alles umdrehte: Rio de Janeiro wurde zur Hauptstadt von Portugal, und die große, reiche, friedliche Kolonie herrschte über das kleine, arme, vom Krieg verwüstete Land in Europa. Als Dom Pedro schließlich wieder nach Lissabon zurückkehrte, blieb sein Sohn in Rio, ließ sich krönen, und Brasilien war ohne Unabhängigkeitskrieg ein selbständiges Kaiserreich geworden. Zwei Stunden später setzte mich Marcel mitten im Zentrum von Madrid an der Puerta del Sol aus. Obwohl es bereits dunkel war, hatte er vor, noch ein paar Stunden weiterzufahren, es war schließlich noch ein ganz schönes Stück bis Hamburg, und er wollte so schnell wie möglich ankommen. Wir verabschiedeten uns sehr herzlich, ich hatte das Gefühl, einen Freund fürs Leben gewonnen zu haben, doch die sozialen Netzwerke der Zukunft waren noch nicht erfunden, und so kam es anders. Wir schrieben uns nicht, bald waren auch unsere Adressen nicht mehr aktuell, und schließlich wurde diese magische Reise aus dem Herzen der Dunkelheit bis zum Sonnentor Madrids von so vielen Schichten Alltag und anderen Erlebnissen überlagert, dass ich aufhörte, daran zurückzudenken. Bis ich über zwanzig Jahre später eine Einladung nach Island bekam, mit dem Auto von Wien bis zur Fähre nach Norddänemark fahren musste und mir ausrechnete, dass eine Übernachtung in Hamburg fein wäre. Doch dazu später.
Dass Jokerman ein Song von Bob Dylan war, erfuhr ich bereits in Madrid, als ich in einem Plattenladen nach dem im Auto mit Marcel gehörten Lied suchte und in den Credits des Live-Albums Circuladô Vivo las, dass der Song gar nicht von Caetano war. So stieß ich auf Dylans Album Infidels. Gleich der erste Song war Jokerman. Ich ließ mir die CD einlegen, setzte die Kopfhörer auf und war sofort enttäuscht. Es war zwar derselbe Song wie der im Auto gehörte, aber Dylans Version, das Original also, klang wie mit einer Plastikfolie überzogen, in ein Meer von billigem Synthesizerklang getaucht. Heute weiß ich, dass es analoge Instrumente waren, Dylan aber ähnlich denkt wie ich. That could have been a good song, sagte er einmal in einem Interview. Jokerman war also besser als das von ihm eingespielte Lied. Damals in Madrid nahm ich den Kopfhörer wieder ab, bevor der Track zu Ende war, und ging ernüchtert hinaus auf die Straße. Das war alles, mehr Beziehung hatte ich nicht zu diesem Song, auch wenn ich später eine Zeit lang viel Dylan hörte, aber nie besonders fokussiert, immer nur im Hintergrund während des Lesens oder Schreibens oder Wäscheaufhängens. Meine Bewunderung für Bob Dylan war allerdings bereits kurz vor dem Studium groß genug gewesen, um am 15. Juni 1991 sein Konzert in der Linzer Sporthalle zu besuchen, wo er mich mit von ihm unkenntlich gemachten, gekrächzten Songs so überfordert hatte, dass es für mich ein vorläufiges Ende meiner Begeisterung bedeutet hatte.
WIEN
II
Viele Jahre nach meinem Auslandssemester in Portugal lernte ich Eugen, einen jungen und engagierten Anglisten, auf einem Fest meines Cousins Simon-Philipp kennen. Ich war so betrunken, dass ich begann Rotweinflaschen aus dem Fenster zu leeren und dabei das Gefühl hatte, etwas Göttliches zu vollbringen. Eugen war der Einzige, der nicht auf mich einschrie, damit aufzuhören, sondern etwas von Hard Rain und Blood on the Tracks sagte, was ich als Dylan-Zitate erkannte, die mir in diesem Moment als ungemein weise erschienen, sodass ich von meiner Mission abließ. Wir kamen ins Gespräch, und er lud mich ein, einen Beitrag für ein Buch über Bob Dylan in Österreich zu verfassen, das er gerade konzipierte. Ich hatte tatsächlich eine passende Idee: Zu Beginn der Neunzigerjahre waren im Wiener Stock-im-Eisen-Platz in einer Kunstaktion die Verse They said it was the land of milk and honey / Now they say it’s the land of money / Who ever thought they could ever make that stick in den Boden eingelassen worden. Das waren Zeilen aus Dylans Song Unbelievable. Ich schrieb einen Artikel darüber, und der Band mit dem schönen Titel AustroBob erschien 2014. Eugen war es schließlich auch, der mich einlud, bei der größten Literaturkonferenz der Welt, die 2016 in Wien stattfand, in dem von ihm organisierten Bob-Dylan-Panel vorzutragen. Ich versprach, mir etwas zu überlegen, auch wenn ich eigentlich einen Essay zu Egon Schiele und Oscar Wilde fertigbringen musste, den ich dem Leopold Museum verwegen für einen Ausstellungskatalog zur Décadance angeboten hatte, allein auf die Beobachtung gestützt, dass Egon Schiele und The Picture of Dorian Gray beide im Juni 1890 das Licht der Welt erblickt hatten. Da es außer dieser Koinzidenz nichts zu dem Thema zu sagen gab, begann ich langsam zu verzweifeln und immer panischer wahllos durch die Bücher Wildes zu blättern. Dabei stieß ich in Salome auf Johannes den Täufer, den Wilde Jokanaan nannte. Jokanaan – Tschokanan – Jokerman. Das war es. Ich klickte mich durch meine digitale Musiksammlung bis zu Infidels und dann auf das erste Lied. Tatsächlich, so wie Bob Dylan Jokerman aussprach, konnte es genauso gut Jokanaan heißen. Schnell schrieb ich ein paar Zeilen zu Johannes dem Täufer und dem Jokerman im Song, was bei all den Bibelallusionen und tanzenden Nachtigallen ein Leichtes war.
Bald darauf war Montag, der 25. Juli 2016, und ich war im Hauptgebäude der Universität Wien auf der größten Literaturkonferenz der Welt, die internationaler wirkte, als ich mir das vorgestellt hatte: mit in bunte Saris gekleideten Inderinnen, laut diskutierenden afrikanischen Vortragenden und verirrten Chinesen. Studierende schenkten Kaffee aus, gaben touristische Informationen und fingen die Chinesen wieder ein. Um den Seminarraum Geschichte 3 zu finden, musste auch ich bei einer hilfsbereiten Studentin in einem weinroten Universität-Wien-Shirt nachfragen. Trotz kompetenter Auskunft platzte ich in einen falschen Saal. John Updikes Romane sind nur Illustrationen der Philosophie Kierkegaards, sagte eine Professorin. Das klang interessant, war Kierkegaard doch der einzige Philosoph, den ich eine Zeit lang intensiver studiert hatte. Doch ich musste weiter, musste Dylan-Experte spielen. Schließlich fand ich den kleinen Hörsaal, der im letzten Winkel des labyrinthischen Gebäudes versteckt lag und gleichzeitig als Erste-Hilfe-Raum diente. Eugen war bereits da und sprach angeregt mit einem großen, über ihn gebeugten, weißhaarigen Mann mit rahmenloser Brille, deren dicke Gläser die Augen stark verkleinerten. In einer enormen Spannweite breitete er die Arme über seinen Gesprächspartner und wirkte, als wollte er den perfekten Armzug für das Delfinschwimmen erklären oder einen Albatros imitieren.
Mein Vortrag war der letzte von zwei Dreierpanels, von denen ich nichts mitbekam, da ich immer nervöser wurde. Völlig belanglos kam mir meine Präsentation plötzlich vor, ich hätte am Vortag daran schreiben sollen, anstatt sinnloserweise zur Konferenzeröffnung zu gehen. Salman Rushdie hatte den großen Festvortrag gehalten, und ich hatte ihn unbedingt sehen wollen, war aber ohnehin zu spät und deshalb nicht einmal zur Tür des Auditoriums Maximum hineingekommen. Ohne auch nur einen Blick auf Rushdie geworfen zu haben, hatte ich mich wieder auf den Heimweg gemacht. Jetzt versuchte ich verzweifelt, irgendwie noch einen Dylan-Bezug einzubauen, viel zu spät. Die größten Dylanologen der Welt saßen um mich herum, einige davon kannte sogar ich. All diese Koryphäen schauten allerdings ihrerseits offensichtlich uneingeschränkt zum Albatros auf. Wann immer er sich in die leidenschaftlichen Diskussionen zu den Vorträgen einbrachte, wurde es sofort still im Saal, und alle schrieben gebannt seine Worte mit. Schließlich kam ich an die Reihe. Meine Präsentation war erschreckend sinnbefreit, unkoordiniert und erratisch. In eingerostetem Englisch stammelte ich Gemeinplätze über Johannes den Täufer, seine Beziehung zu Jesus, der sein Cousin war und der in ihm den wiedergekehrten Propheten Elias des Alten Testaments zu erkennen glaubte. Mein vorbereitetes Skript half mir in keiner Weise weiter. Verzweifelt versuchte ich, einen roten Faden zu finden, zusätzliche Berührungspunkte mit dem Werk des Meisters herzustellen, doch umsonst. War meine Beobachtung, dass Dylan das Wort Jokerman ähnlich wie Jokanaan aussprach, das Einzige, das mit dem Thema des Panels zu tun hatte? Um mir eine kurze Verschnauf- und Nachdenkpause zu verschaffen, kündigte ich an, ein Bild von Johannes dem Täufer zu zeigen, googelte diesen schnell am bereitstehenden Computer, und schon projizierte der Beamer Leonardos Porträt des Propheten an die Wand: Johannes der Täufer, mit erhobenem Finger, Fell und Kreuzstock, sagte die Bildunterschrift. John the Baptist with raised finger, fur and a cross on a stick, übersetzte ich improvisierend. Und das war es dann auch schon. Stick war das letzte Wort meines Vortrags und auch das letzte, das ich an jenem Tag sprechen sollte.
Nach langem, drückendem Schweigen erhob sich endlich zaghafter Applaus. Beschämt und verwirrt blieb ich versteckt hinter dem Bildschirm des Computers sitzen. Schnell leerte sich der kleine Saal, es gab wirklich nichts zu diskutieren oder nachzufragen, das Publikum war ebenso sprachlos wie ich. Einige besonders eifrige Jünger, darunter Eugen, sammelten sich um den Albatros, der wieder mit großen Gesten etwas zu erklären schien. Fasziniert folgten ihm seine Zuhörer. Ich konnte nichts von dem verstehen, was die kleine Gruppe bei der Tür, durch die ich so gerne in den Wiener Hochsommer geflüchtet wäre, besprach.
Shut the door, hörte ich plötzlich deutlich, und Eugen tat einen Schritt auf die Tür zu und warf mir einen etwas verunsicherten Blick zu.
Are you sure?, fragte er, die Hand auf der Klinke.
Der Albatros antwortete nahezu triumphierend, jede Silbe lang gezogen nach oben ziehend, fragend, aber doch gewiss: Absolutely?
Der Rest der noch Anwesenden hatte in der Zwischenzeit begonnen, Sessel und Bänke an die Wände zu schieben. Anscheinend hatten sie noch ein Meeting des Vorstands der Bob-Dylan-Society oder Ähnliches auf der Agenda und mich mittlerweile vergessen.
Ich klickte auf das Wikipedia-Fenster und schloss den Artikel über Johannes den Täufer. Dann fuhr ich den Computer herunter und schaltete den Beamer aus. Der Lichtstrahl erlosch, die Lüftung des Projektors summte weiter. Zwei Damen, die mir bisher nicht aufgefallen waren, trugen die mit dunkelgrünem Plastik bezogene Arztliege aus einer Ecke in die Mitte des Raums. Vielleicht stellten sie auch nur den ursprünglichen Zustand wieder her.
Come?, sagte oder fragte der Albatros jetzt und fixierte mich mit seinen verkleinerten Augen. Es klang wie eine Frage, war aber ganz klar ein Befehl. Mit wackeligen Beinen erhob ich mich. Ungeduldig oder amüsiert winkte er mich herbei. Lay down?, hörte ich, und er zog dabei seine hohe und weiche Stimme wieder nach oben, ohne auch nur die Idee einer Widerrede zuzulassen.
Ich legte mich hin, teilweise erleichtert, nicht selbst entscheiden zu müssen, was ich als Nächstes zu tun hatte, dankbar, mich nach der Anstrengung des missglückten Vortrags auf die weich gepolsterte Liege legen zu dürfen, und schließlich doch beunruhigt, von der durch meine Rede beleidigten Dylan-Gesellschaft nun hingerichtet zu werden.
Rund um mich rückten die mir plötzlich sehr zahlreich erscheinenden Anwesenden näher, dunkel zeichneten sich ihre Körper gegen das von Neonröhren beleuchtete Weiß der Hörsaaldecke ab. Dieselben Platten hatte es auch am Plafond meiner Schulklasse gegeben, schoss es mir durch den Kopf. Der Albatros beugte sich stehend von hinten über mich, sodass sein bebrilltes Gesicht verkehrt herum über dem meinen schwebte.
So, Jokanaan?, fragte oder sagte er.
Wartete tatsächlich die Todesstrafe? Hatte ich die versammelten Dylanologen durch meinen schlechten Vortrag und meine Ignoranz gar zu sehr beleidigt? Ich versuchte, mich aufzurichten.
Doch mit einem gezischten, and the stick?, presste mich der Albatros ohne eine Berührung wieder auf die Bahre, als hätte er mich mit einem durchsichtigen Bleiumhang zugedeckt. Flach atmete ich ein und aus.
Again? The stick?, fragte er drohend, nur Zentimeter von meinem Gesicht entfernt. Die Worte singend nach oben ziehend schien die weiche Stimme gar nicht aus seinem Mund zu kommen, sondern füllte von allen Seiten gleichzeitig den Raum.
Jemand zu meiner Rechten sagte flapsig: He sticks to the stick.
Alle lachten auf, und es klang wie ein unheilschwangerer Chor aus einer Passion, in der die Römer Jesus stampfend vorsangen, dass er des Todes war.
Und wir glaubten, to stick heißt kleben bleiben!, johlte eine weibliche Stimme an meinem Fußende, woraufhin jetzt kreischendes Lachen ausbrach.
Es kam mir vor, als ob alle noch einen Schritt näher an mich herangerückt waren.
Now they say it’s the land of money / Who ever thought they could ever make that stick, rief jemand auf der Höhe meines linken Knies.
Wieder lachten alle im Chor, und wieder war mir, als hörte ich Kettenrasseln und stampfende Schritte, die die dunklen Gestalten noch näher an mich heranbrachten, in mich hinein, meine Grenzen auflösend.
Wir dachten, Bob Dylan habe sich gewundert, wie sie es jemals schaffen konnten, mit dem kapitalistischen System durchzukommen, doch Kutzenberger meint, dass sie einen Stock gemacht hätten! It is the stick!, rief die weibliche Stimme vom Fußende.
Plötzlich ging mir auf, was sie meinten. Ich hatte tatsächlich in meinem Artikel für das AustroBob-Buch über den von Dylan erwähnten Stock in dem Vers Who ever thought they could ever make that stick geschrieben. Dieses stick war aber ein to stick, ein Klebenbleiben, kein Stock. Oh Schande! Warum war das niemandem aufgefallen? Eugen hätte als Herausgeber etwas sagen können, sagen müssen! Ich suchte ihn unter den mich anstarrenden Gesichtern, konnte jedoch keine Züge erkennen, nur fratzenhaft dunkle Schädel vor hellem Deckenlicht.
And now Jokanaan’s stick?, fragte der Albatros hinter mir, und sofort wurde es ruhig, und es war mir klar, dass das keine Frage war und auch kein Befehl, sondern eine unwiderrufliche Wahrheit. Good?, sagte er, über mich gebeugt, nur Zentimeter von meinem Kopf entfernt. Ich spürte seinen geruchlosen Atem, die scharfen, verkleinerten Augen hinter der Brille. Jäh richtete er sich auf, das Gleißen des Deckenlichts blendete mich schmerzhaft. Wer kann die Trumpf-Karte stechen?, fragte der Albatros auf Englisch, und ich sah, dass er seine Flügel nun in ganzer Spannweite über seine Jünger ausgebreitet hatte. Wer sticht den Trumpf?, wiederholte er, und das war nun tatsächlich eine Frage, denn im Chor antwortete der ganze Raum vibrierend: The Joker, und die Armee stampfte dumpf schallend auf, die Ketten rasselten, und die mich umzingelnde Menschenmauer kam noch einen Schritt näher, auch wenn das unmöglich war. Who can beat the trump?, sang der Albatros.
The Joker hallte es nochmals wider, noch lauter und bedrohlicher aus den Untiefen der labyrinthischen Gänge der Wiener Universität, die als Ganzes erzitterte, sodass die Wände selbst näher rückten.
Who can beat Trump?, rief der Albatros jetzt wie in Trance mit noch höher fliegender Stimme, die Töne in das Universum ziehend, die Augen nun wieder über mir, stechend verkleinert hinter den dicken, starken Brillengläsern. Wie die Schwingen des größten Vogels der Welt breiteten sich seine Arme über uns, der Vogel, der selbst im Schlaf weiterflog, der über den Weltmeeren schwebte und nur zum Brüten an Land kam, um einmal im Jahr seine Flügel einzufalten.
Trump?, hallte es hoch und fern in der Luft, und wie ein Donner polterte in einem schweren Beben der Schall auf mich herunter, so gewaltig, so mächtig, dass er von meinen winzigen Trommelfellen nicht eingefangen werden konnte, es brauchte größere Organe dazu, die Lunge bebte, das Herz brauste, die Haut schwang, die Seele löste sich auf: The Jokerman!
Ein Rest von mir starrte auf das leuchtende Weiß. Heller als die Sonne soll die Mutter Gottes gestrahlt haben, als sie drei Hirtenkindern in Fatima erschien. Nun war es ihr Neffe, Jokanaan, der den Seminarraum Geschichte 3 in so gleißendes Licht tauchte, dass alles davon verzehrt wurde. Über mir und rund um mich war alles weiß und leer.
So it’s Kutzenberger?, hörte ich eine weibliche Stimme weit weg von meinen Füßen in den ewigen weißen Wüsten des Raums versteckt meinen Namen sagen.
Yes, Stine, it is him?, kreiste die Stimme des Albatros über mir, ganz weit oben, sich im schrecklichen Weiß des unendlichen Nebels von Lima auflösend. It’s him?, hallte es wider, und die Stimme setzte ein letztes Mal an, sich sanft nach oben ziehend, als wäre es eine Frage, dabei war es doch eine Feststellung, und zwar eine ganz einfache, klare und logische: Our Jokerman?
III
Eugen hatte mich zwar zum Bob-Dylan-Symposium im Rahmen der Literaturkonferenz in Wien eingeladen, doch waren wir einander kaum bekannt. Seit dem Fest meines Cousins hatten wir nur ein paar E-Mails gewechselt, in denen es um meinen Artikel für sein Dylan-Buch oder um den Vortrag gegangen war. Im Hörsaal Geschichte 3 hatte er mir zwar noch einen verwirrten Blick zugeworfen, als die Geschehnisse ihren Lauf zu nehmen begannen, sich dann aber vollständig in der anonymen Masse der Gesichter aufgelöst. Umso mehr freute es mich, als ich ein paar Tage nach meiner Präsentation eine Mail von ihm erhielt, ob wir uns nicht einmal treffen wollten. Das sollten wir, unbedingt sogar, ganz dringend wollte ich mit jemandem über die Ereignisse im Hörsaal sprechen, denn ich war mir nicht mehr sicher, was davon tatsächlich passiert war und was ich mir bloß einbildete, welche Trugvorstellungen die Scham mir vorgaukelte, um mich von der akademischen Niederlage abzulenken. Nachdem man mich vor den umstehenden Menschen als Jokerman bezeichnet hatte, war alles wie in einem Nebel versunken. Als ich zu mir gekommen war, hatte sich die Gruppe der Dylan-Gesellschaft gerade in Auflösung befunden, und ein junger Sanitäter fühlte mir den Puls. Er maß meinen Blutdruck, zeigte sich nicht besorgt und schickte mich heim.
Am Samstag, dem 30. Juli 2016, traf ich Eugen also zum Mittagessen in der Chinabar. Es wurde ein eigenartiges Treffen. Zuerst plauderten wir ewig über meinen Cousin, der uns zwar miteinander bekannt gemacht hatte, den wir aber beide kaum sahen. Erstaunlich, wie lange er dennoch als Gesprächsthema herhielt, alles war anscheinend besser, als zum eigentlichen Grund unseres Treffens vordringen zu müssen. Mein Auftritt auf der Literaturkonferenz stand unausgesprochen und mächtig zwischen uns wie ein ungeöffnetes Kuvert von der Prüfungskommission.
Erst als die Kellnerin unsere Speisen brachte, sah Eugen mich nachdrücklich an, und ich wusste, dass es jetzt genug war mit Small Talk.
Du hast wahrscheinlich einige Fragen wegen der Sache letztens, sagte er.
Oh ja, die hatte ich, nur, wo beginnen? Ich nickte nur. Eugen lachte. Wieder stockte das Gespräch. Schließlich fuhr er fort:
Was war nur los mit dir? Dein Beitrag zu Dylan und dem Stock-im-Eisen-Platz war damals einer der besten überhaupt, und hier an der Uni hast du nur ein paar Sätze gestammelt.
Wieder sagte ich nichts, was gab es auch zu entgegnen? Eine Schande war das, Eugen hatte völlig recht.
Wenn du es mit Absicht gemacht hast, dann war es genial. Guðjónsson war auf jeden Fall überzeugt von dir.
Guðjónsson?, fragte ich.
Ja, Guðjónsson, antwortete Eugen.
Ich sah ihn fragend an.
Sag nicht, dass du Guðjónsson nicht kennst!
Konnte er den Albatros meinen? Wen sonst? Aber warum sollte ich den Albatros, der mich wohl am liebsten hingerichtet hätte, mit meinen hingestammelten Sätzen beeindruckt haben?
Eugen zuckte die Schultern und sagte leichthin: Ist ja auch egal. Und sonst, was läuft sonst so bei dir?
Das konnte doch nicht wahr sein, wollte er wirklich wieder zum belanglosen Teil übergehen? Warum hatte er mich dann überhaupt kontaktiert? Sag mir, insistierte ich tapfer, was ist da abgelaufen, was war das mit der Liege und dem Licht und dem allen?
Er sah mich an, drehte seine Tasse mit Jasmintee in der Hand und nahm einen Schluck. Da war nichts, sagte er schließlich. Guðjónsson wird mit dir noch darüber reden, aber wenn du nicht willst, dann war da überhaupt nichts.
War das eine Antwort? Ich dachte zurück an die stampfende Meute, das gleißende Strahlen, die von allen Seiten gleichzeitig kommende Stimme des Albatros. Eugen hatte mittendrin gestanden, er konnte jetzt doch nicht einfach sagen, dass da nichts gewesen war. Wie mochte es sonst an seinem Institut zugehen? Anstatt nachzubohren, fragte ich aber nur: Der Albatros wird sich bei mir melden?
Eugen lachte. Albatros nennst du ihn? Das ist gut! Er hat ja wirklich lange Arme, wenn er sie ausbreitet. Sehr treffend. Die Möwe Jonathan, das muss ich ihm sagen! Oder besser, sag du es ihm, wenn du ihn triffst.
Wie stellte Eugen sich das vor? Lieber Herr Guðjónsson, ich habe sie für mich Albatros genannt, da ich ihren Namen nicht kannte, und Eugen hat dann die Möwe Jonathan daraus gemacht? Das wäre sicher kein guter Einstieg. Und ich wollte den Albatros auch gar nicht wieder treffen, ich wollte hier und jetzt erfahren, was da abgegangen war, was das Ganze sollte.
Eugen aber redete sich raus, er sei nur ein Literaturwissenschaftler, der zufällig auch zu Bob Dylan forsche, ganz bestimmt also kein Dylanologe wie all die anderen, die sich um Guðjónsson versammelt hatten. So viel aber stehe fest, dass Guðjónsson von meiner Jokerman-Theorie und der stick-Sache total begeistert gewesen sei.
Warum ist meine Erwähnung des Stocks denn eine so große Sache?, wollte ich wissen.
Keine Ahnung, ehrlich, keine Ahnung, wiederholte Eugen. Guðjónsson hat uns gefragt, ob wir Night After Night kennen würden, einen Song, der 1987 auf dem Soundtrack von Hearts of Fire zu hören war und danach nie wieder aufgelegt wurde. Darin käme die Zeile Just another stick of dynamite vor. Wir würden schon sehen, sagte er dazu, wir würden schon sehen.
Ich schüttelte ratlos den Kopf.
Nach einer kurzen Pause fuhr Eugen fort: Es wäre übrigens fein, wenn irgendwann einmal eine Dylan-Ausstellung in Wien stattfinden könnte, du hast doch tolle Kontakte zu den Museen, oder? Er hat viel gemalt in den letzten Jahren und auch schon in wichtigen Häusern ausgestellt. Wär das nichts?
War das also der eigentliche Grund, weshalb Eugen mich hatte treffen wollen? Meine kaum vorhandenen Kontakte in die Wiener Museumsszene? Ich kannte zwar ein paar Kuratoren, doch war ich Lichtjahre davon entfernt, den Direktoren Themen diktieren zu können. Meine Kontakte sind nicht besonders toll, sagte ich.
Wie zu Studienzeiten schlug ich mich als Kunstvermittler durch die Museen der Stadt: Kinderführungen, Seniorenführungen, Sonntagnachmittagsführungen. Nie hatte ich gedacht, dass diese Tätigkeit einmal mein Leben bestimmen würde. Als Student hatte ich mein Studium mit Reiseleitungen nach Südamerika finanziert: Ecuador, Peru, Bolivien und Brasilien in drei Wochen mit österreichischen Pensionisten. Eine elegante Art, die Welt zu sehen und gleichzeitig Geld zu verdienen. Als dann aber die Kinder gekommen waren, hatte ich mit der Kunstvermittlung in Museen begonnen. Doch bald waren aus Kleinkindern Schulkinder geworden, und sie hatten plötzlich fixe Stundenpläne, sodass auch ich mir eine regelmäßigere Arbeit suchte und eine Stelle als Halbtagsbibliothekar in der Wiener Stadtbibliothek fand. Doch so ideal das klang: Nach einem Jahr hatte ich entkräftet kündigen müssen. Obwohl ich nur zwanzig Stunden pro Woche arbeitete, war ich mir in dem starren Bürosystem eingekerkert vorgekommen und hatte die Flexibilität und Freiheit der Ausstellungsführungen vermisst.
Ich habe einmal kurz als Bibliothekar gearbeitet und schließlich wegen Bob Dylan gekündigt, erzählte ich Eugen. Er sah mich interessiert an, also fuhr ich fort: Eines Tages hatte ich frei, es war Allerheiligen und warm wie im Sommer. Ich dachte, dass das wohl der letzte sonnige Herbsttag des Jahres sein würde, legte mich in einen Park, kramte nach meinem iPod, setzte mir die Kopfhörer auf, rückte den Rucksack hinter meinen Kopf und drückte auf play. Der Zufallsgenerator wählte Dylans Going, Going, Gone aus, die Sonne strahlte mir ins Gesicht, ich schloss die Augen und lauschte. Beim ersten Refrain, als sich das Gone in einen Mollakkord auflöste, sah ich plötzlich wie auf einer Puppenbühne vor mir, wie klein mein Leben als Halbtagsbibliothekar war. Das konnte nicht der Sinn des Ganzen sein. Mir war klar, dass ich kündigen musste.
Und das hast du tatsächlich gemacht?, fragte Eugen.
Ja, ich nahm mir den Allerseelentag frei, draußen war es auf einmal kalt und regnerisch, und ich wägte alle Argumente für und wider ab, in der Wohnung im Kreis gehend wie ein eingesperrter Panther. Es blieb bei meiner Entscheidung. Ich wollte einfach nicht weiter im Büro verkommen. Jeder, der das kann, ist ein Held, eine Heldin. Ich konnte es nicht. Das war nicht mein Leben.
All das, was ich Eugen sagte, stimmte, es war tatsächlich Zeit gewesen, den Halbtagsjob aufzugeben. Der wahre Grund aber, weshalb ich mich plötzlich traute, diesen überfälligen Schritt zu tun, war, dass mein Debütroman erscheinen sollte. Friedinger hieß das Buch. Es war großartig, einen Roman zu veröffentlichen, bestätigten mich der Verlag und alle anderen, die von dem Projekt wussten. Genauso einstimmig warnte man mich aber auch, dass ich finanziell nichts davon erwarten sollte. Und natürlich behielt der Verlag recht, das Geld, das ich durch den Roman verdiente, entsprach in etwa einem Monatsgehalt als Bibliothekar mit halber Stelle. Das war zu wenig, auch für den Verlag, der dieses Debakel nicht überlebte und aufgelöst wurde.
Da hast du also eine fixe Anstellung aufgegeben, nur weil dir der von Dylan skizzierte Lebensentwurf spannender schien?
Ja, richtig. Und das Lustige ist, dass ich erst viel später draufgekommen bin, dass der Songtext auch genau das sagte, ich damals aber nur auf die plötzliche Mollharmonie reagiert hatte. Sie hatte gewirkt, als hätte sich eine Tür geöffnet und mir den Blick freigegeben auf all das, was möglich wäre, wenn ich mich endlich von der Stechuhrmentalität des Arbeitslebens befreien würde.
And I don’t really care / What happens next, heißt es weiter, nicht wahr?, bemerkte er.
Du hast deinen Dylan ja wirklich gut drauf, ich bin beeindruckt. Aber wie gesagt, das wusste ich damals nicht, ich höre fast nie auf die Lyrics. What happened next war auf jeden Fall, dass ich wieder mit meinem alten Studentenjob als Kunstvermittler anfing.
Wow, das ist mutig, sagte Eugen.
Heute weiß ich, dass es das Gegenteil von Mut war. Es war feige, sich in eine Studentenexistenz zu flüchten, dieselben Jobs, dieselben Träume wie als Zwanzigjähriger. Andererseits war es auch nicht lächerlicher, als Urlaubsanträge auszufüllen, Überstundenpauschalen abzusitzen und auf die Pensionierung zu warten. Das lag hinter mir. I’m going, I’m going, I’m gone. Und das gone in Moll, in eine völlig neue Welt, ein Paralleluniversum führend, das ohne Stechuhr, Kernzeitverletzung und automatisch abgezogener Mittagspause auskommt. Mutig oder feige war nicht die Frage, es war richtig, das wusste ich.
Dass du den Sinn von Dylans Song nur durch die Melodie gespürt hast, ist schon außergewöhnlich, sagte Eugen. Vielleicht hat Guðjónsson ja recht mit dir.
Recht mit was?, fragte ich.
Weiß ich nicht genau, wich er wieder aus. Er wird sich in der ersten Oktoberwoche bei dir melden.
„Eine Art Schelmen-Thriller, der mindestens im doppelten Wortsinn komisch ist.“
"Ganz schön frech wie der echte Stefan Kutzenberger hier die Genres mischt, wie er Autofiktion und Thriller zur Actionsatire vermengt und aufkocht und so eine ziemlich einzigartige Kunstfigur schafft [...], die mit Kafka und Kirkegaard auf den Spuren James Bonds wandelt."
„Skurrile Gesellschaftssatire […] unterhaltsam, brandaktuell.“
„›Jokerman‹ ist, ganz ohne Wortwitz, ein Politthriller im Kleid einer Verschwörungstheorie im Kleid eines Schelmenromans, und diese Verschachtelung macht den Roman so klug und unterhaltsam zugleich.“
„Großartiger Roman“
„Bemerkenswert ist, wie Kutzenberger seinen Roman bei aller literarischer Selbstreferenzialität und Abstrusität der Handlung eine Leichtigkeit gibt, die ihresgleichen sucht. Die feine Selbstironie, die Zweifel, die der Protagonist durchstehen muss und die geschickten Plot-Twists machen aus diesem Schelmenroman ein großes Lesevergnügen.“
„Erfrischend hirnrissig, witzig, verspult und versponnen, eine abstrus-wilde Story mit haarsträubenden Wendungen, flott runtergeschrieben (Vermutung) und flott zu lesen.“
„Der zweite Roman verdient es noch mehr als der erste, gekauft, gelesen, besprochen und weltweit diskutiert zu werden.“
„Abenteuerlich komischer, rasant erzählter und unterhaltsamer Roman“
„Eine pointierte und humorvolle Gesellschaftssatire mit diversen musikalischen Verweisen, veröffentlicht auf dem Höhepunkt des US-Wahlkampfes.“
„Skurril und witzig (...). Es macht wahnsinnig viel Spaß und du kannst es fast nicht aus der Hand legen.“
„Das Buch ist ein witziges Lesevergnügen zwischen Gesellschaftssatire, absurden Verschwörungsmythen und autofiktionalen Spielen voll literarischer und musikalischer Verweise.“
„Ein witziger Roman, der u.a. das Entstehen von Verschwörungsszenarien aufs Korn nimmt.“
„Vergessen Sie am besten die altbekannten Mythen um Illuminaten oder Freimaurer und lesen Sie Stefan Kutzenbergers neuen Roman, der uns Verirrte und Verblendete endlich ans Licht führen wird.“
„Der zweite Roman gilt als der schwierigste – vor allem, wenn der Erstling glückte. Diese Bewährungsprobe hat Stefan Kutzenberger grandios bestanden. Sein Zweitwerk ›Jokerman‹ schickt den Ich-Erzähler gleichen Namens auf eine temporeiche Reise zwischen Wien, Island und Washington und erzählt dabei mehr über die Kraft der Literatur als es ein Lehrbuch je könnte.“
„Für Bob-Dylan-Fans ist Kutzenbergers ›Jokerman‹ ein Muss! Für Liebhaber des skurrilen und schwarzen Humors ebenfalls.“
„Ein entlarvender Spiegel der Gegenwart, eine literarische Entdeckung und ein Riesenspaß weit über die schicksalhaften US-Wahlen vom 3. November hinaus.“
„Dieses Werk empfehle ich aus vollster Überzeugung, weil es einfach Spaß macht!“
„›Jokerman‹ ist ein Buch, das in seinem Grundthema – Verschwörungstheorien – den Nerv unserer Zeit trifft.“
„In seinem Roman spielt Stefan Kutzenberger geschickt mit Realität, Fiktion, und alternativen Wirklichkeiten.“
„›Jokerman‹ ist nicht nur unterhaltsam, intelligent und mit Verve geschrieben, sondern auch verblüffend brandaktuell.“
„Ein wunderbarer Lesespaß, der ab der ersten Seite ob der Kreativität und sprachlichen Brillanz des Autors ein geradezu diebisches Lesevergnügen bereitet.“
„Entlarvend, klug und ein Riesenspaß – weit über die US-Wahlen im November hinaus.“
„Kutzenberger, der nebenbei gesagt, einiges auf seinem literarischen Kasten hat, erklärt in seinem neuen Roman mit Verve und Witz, wie Verschwörungsszenarien so gut wie alles erklären können; ein lustiger und kluger Lesespaß.“










DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.