

Kämpferin gegen den Krebs (Bedeutende Frauen, die die Welt verändern 22) Kämpferin gegen den Krebs (Bedeutende Frauen, die die Welt verändern 22) - eBook-Ausgabe
Mildred Scheel – Sie gründete die Deutsche Krebshilfe und veränderte das Leben von Millionen
— Romanbiografie„Gut recherchiert und spannend aufgearbeitet“ - Stadtradio Göttingen
Kämpferin gegen den Krebs (Bedeutende Frauen, die die Welt verändern 22) — Inhalt
Krebs: vom Tabu zum wichtigen Vorsorgethema
In ihrem Beruf als Radiologin hat Mildred Scheel es immer wieder mit Krebspatienten zu tun und ist entsetzt von den tragischen Schicksalen. Nicht nur gibt es kaum Therapiemöglichkeiten, Krebs gilt auch als Tabu und wird oft bis zum bitteren Ende verheimlicht. Als ihr Ehemann und FDP-Politiker Walter Scheel Bundespräsident wird, sieht Mildred ihre Chance: Sie gründet die Deutsche Krebshilfe und sagt so dem Krebs in aller Öffentlichkeit den Kampf an. Unter Ärzten stößt sie auf Skepsis und Widerstand, doch sie bleibt fest entschlossen. Es ist höchste Zeit für ein Umdenken beim Thema Krebs!
Bedeutende Frauen, die die Welt verändern
Mit den historischen Romanen unserer Reihe »Bedeutende Frauen, die die Welt verändern" entführen wir Sie in das Leben inspirierender und außergewöhnlicher Persönlichkeiten! Auf wahren Begebenheiten beruhend erschaffen unsere Autor:innen ein fulminantes Panormana aufregender Zeiten und erzählen von den großen Momenten und den kleinen Zufällen, von den schönsten Begegnungen und den tragischen Augenblicken, von den Träumen und der Liebe dieser starken Frauen.
Leseprobe zu „Kämpferin gegen den Krebs (Bedeutende Frauen, die die Welt verändern 22)“
Kapitel 1
Sorgfältig studierte Mildred Wirtz die Röntgenbilder, die vor ihr am Leuchtschirm hingen. Gelegentlich nahm sie die Lupe zur Hand, um einen Bereich noch besser erkennen zu können. Auch wenn die Diagnose hier offensichtlich war, wollte sie nichts übersehen. Vor allem wenn ein Merkmal geradezu ins Auge sprang, war die Gefahr groß, dass man etwas anderes, vielleicht ein kleines Detail, nicht beachtete. Eine der schlimmsten Vorstellungen für sie als Ärztin war, vor ein oder zwei Jahre alten Röntgenbildern zu stehen und sich eingestehen zu müssen, [...]
Kapitel 1
Sorgfältig studierte Mildred Wirtz die Röntgenbilder, die vor ihr am Leuchtschirm hingen. Gelegentlich nahm sie die Lupe zur Hand, um einen Bereich noch besser erkennen zu können. Auch wenn die Diagnose hier offensichtlich war, wollte sie nichts übersehen. Vor allem wenn ein Merkmal geradezu ins Auge sprang, war die Gefahr groß, dass man etwas anderes, vielleicht ein kleines Detail, nicht beachtete. Eine der schlimmsten Vorstellungen für sie als Ärztin war, vor ein oder zwei Jahre alten Röntgenbildern zu stehen und sich eingestehen zu müssen, dass man einen Befund, der das Leben des Patienten erheblich einschränken oder sogar verkürzen würde, bereits auf den ersten Aufnahmen hätte sehen können. Also zu einem Zeitpunkt, als die therapeutischen Optionen noch vorhanden oder wenigstens größer gewesen wären. Solch einen Fehler würde sie sich nicht verzeihen. Niemals. Also machte sie ihre Arbeit gründlich. Immer und ohne Ausnahme.
Die Bilder am Leuchtschirm zeigten in mehreren Abschnitten den rechten und linken Oberschenkelknochen von der Hüfte bis zum Kniegelenk. Ihr fiel der Professor für Pathologie an der Universität in Innsbruck ein, der seinen Studenten immer eingeschärft hatte: „Was gesund ist, sieht schön aus.“ Tatsächlich traf diese Aussage auch im Umkehrschluss zu, gerade in der Radiologie. Ein gesunder, unverletzter Knochen war ästhetisch: Die feine Zeichnung der Trabekel, der inneren Knochenstruktur, die wie ein dickes Polster schützende Knorpelschicht an den Gelenkflächen und schließlich die Knochenhaut, die sich wie eine zarte Hülle um den Knochen schmiegte – ein Wunderwerk der Natur. In diesem Fall aber sah gar nichts mehr schön aus.
Beide Hüft- und Kniegelenke auf den Aufnahmen wiesen alle Anzeichen einer fortgeschrittenen Arthrose auf. Es gab Ausziehungen am Rand der Gelenkflächen, zahlreiche Defekte, die aussahen, als hätte eine Maus kleine Stücke vom Knochen abgenagt. Außerdem war die Knorpelschicht kaum oder überhaupt nicht mehr vorhanden, und die Gelenkspalte waren an allen Gelenken bis auf Bruchteile eines Millimeters zusammengeschrumpft. Mildred musste nicht auf das Geburtsdatum schauen, um zu wissen, dass die Bilder von einem alten Menschen stammten. Einem Menschen, der sich in seinem Alltag nur noch mühsam bewegen konnte, weil in Hüften und Knien Knochen auf Knochen aneinanderrieben, statt von Knorpel und Gelenkflüssigkeit geschützt zu werden. Entzündungen und ständige Schmerzen waren die Folge. Zusätzlich zur fortgeschrittenen Arthrose gab es aber noch einen zweiten Befund.
Auf den Aufnahmen des linken Oberschenkels sprang eine spiralförmige Bruchkante am Schenkelhals in der Nähe des Hüftkopfes ins Auge. Die beiden Knochenfragmente waren um etwa zwei Zentimeter gegeneinander verschoben. Mildred sah förmlich, wie die Patientin eingeliefert worden war – auf dem Rücken liegend, das linke Bein nach innen verdreht und optisch kürzer als das rechte. Sie warf einen Blick auf die Anamnese, die der Kollege in der Notaufnahme auf den Anforderungsschein gekritzelt hatte. Die achtundsiebzigjährige Dame war beim Verlassen der Kirche auf den Stufen ausgerutscht und auf die linke Hüfte gefallen. Mildred überlegte, wie die Behandlung dieser Fraktur aussehen könnte. Eine Versorgung mit Schrauben und Nägeln dürfte an dieser Stelle schwierig bis unmöglich sein. Doch sie hatte schon einiges über die neue Behandlung von Schenkelhalsfrakturen gelesen. Bei der sogenannten Totalendoprothese wurde das Hüftgelenk durch ein Gelenk aus Stahl ersetzt, das mit medizinischem Zement im Oberschenkelknochen verankert wurde. Auch schon hier an der Klinik hatten die chirurgischen Kollegen den Hüftgelenksersatz mit Erfolg durchgeführt. Ob man in diesem Fall die Operation wagen würde, hing allerdings von der allgemeinen Konstitution der alten Frau ab – ihrer Herz-, Lungen- und Nierenfunktion, ihrem Ernährungszustand, dem Blutbild, möglichen Infekten. Informationen, die sie den Röntgenbildern des Oberschenkels beim besten Willen nicht entnehmen konnte. Aus diesem Grund hatten die Chirurgen noch eine Aufnahme des Brustkorbs angefordert, von vorne und von der Seite, wie es sich gehörte.
Mildred hängte die Thoraxaufnahmen an den Leuchtschirm, betrachtete sie, maß ab, erst mit den Fingern und dann, zur Sicherheit, auch noch mit einem Lineal.
„Das Herz ist nur geringfügig verbreitert“, murmelte sie vor sich hin. „Lungenzeichnung regelrecht, keine Anzeichen für Stauung.“ Ein ausgezeichneter Befund für eine fast achtzigjährige Dame. Mildred nahm wieder ihre Lupe zur Hand.
„Frau Dr. Wirtz!“
Sie wandte sich der Sekretärin zu, die im Mantel und mit Handtasche im Türrahmen stand. Sie war eine der drei jungen Frauen, die im Schreibzimmer am Ende des Flurs die diktierten Befunde der Medizinalassistenten der radiologischen Abteilung abtippten. Der Chef der Abteilung, Professor Doktor Hainmayr, hatte selbstverständlich eine eigene Sekretärin, eine Mittfünfzigerin mit grauem Haarknoten und Hornbrille, von den jungen Frauen als „Drachen“ bezeichnet – natürlich nur hinter ihrem Rücken.
„Was kann ich für Sie tun, Fräulein Huber?“
„Es ist schon zehn nach zwei. Ich würde gern gehen, wenn es Ihnen nichts ausmacht, Frau Doktor.“
„Warum sollte es mir etwas ausmachen? Schließlich ist Freitag. Gehen Sie ruhig in Ihr verdientes Wochenende. Die beiden Befunde hier können auch noch Montag getippt werden. Die Kurzbefunde bringe ich gleich selbst noch in die chirurgische Abteilung.“
„Ach, das ist aber nett von Ihnen.“ Die junge Frau strahlte. „Dann auch Ihnen ein schönes Wochenende, Frau Doktor, und bis Montag!“
„Danke, ebenso. Aber am Montag ist der Dr. Bergmüller aus dem Urlaub zurück.“
„Oh, dann sind die zwei Wochen schon um? Das ist aber schade! Hoffentlich kommen Sie wieder?“
„So wie es aussieht, ja. In vier Wochen geht Dr. Vogl in den Urlaub, dann werde ich wieder die Vertretung übernehmen.“ Mildred lächelte. „Sie dürfen sich also schon bald wieder über meine Diktate ärgern.“
„Ärgern? Ach wo, Frau Doktor. Sie diktieren so deutlich, das ist eine wahre Freude. Da gibt es ganz andere, die nuscheln, die Hälfte der Worte verschlucken oder ständig schnaufen.“ Fräulein Huber hängte sich die Handtasche über die Schulter. „Dann alles Gute für Sie, Frau Doktor, und bis in vier Wochen.“
„Für Sie auch, Fräulein Huber.“
Einen Moment lauschte Mildred dem Geräusch der Absätze auf dem Linoleum, die sich rasch entfernten. Offenbar hatte Fräulein Huber es eilig, in ihr Wochenende zu kommen.
Es war schön zu wissen, dass der Chef ihre Arbeit schätzte; er hatte ihr aus freien Stücken die Urlaubsvertretung für den nächsten Kollegen angeboten. Dass sie mit den meisten ärztlichen Kollegen und medizinisch-technischen-Assistenten der Abteilung wirklich gut auskam, war keineswegs selbstverständlich. Doch mindestens ebenso froh war sie, dass die Sekretärinnen aus dem Schreibzimmer sie mochten. Das vereinfachte das Arbeiten.
Die Sekretärinnen waren es, die im Klinikalltag einer radiologischen Abteilung für einen reibungslosen Ablauf sorgten. Ärzten, die sie nicht mochten oder über die sie sich ärgerten, konnten sie jederzeit Steine in den Weg legen: ständige Nachfragen zum Diktat wegen unverständlicher Passagen, nicht sofort abgetippte Befunde oder gar verlorene Bänder. Die Möglichkeiten waren subtil und vielfältig, und die Ärzte konnten nichts dagegen tun.
Mildred widmete sich wieder dem Leuchtschirm, schaute sich Lunge, Herz und die sichtbaren Rippen sorgfältig an, fand aber nichts, was ihr Sorgen bereitet hätte. Die alte Dame hatte eine Schwiele am Zwerchfell, was darauf hinwies, dass sie irgendwann in ihrem Leben eine Lungenentzündung durchgemacht hatte, aber das war bei Geburtsjahr 1889 nichts Ungewöhnliches. Sie nahm das Mikrofon in die Hand und schaltete die Stenorette ein. Zehn Minuten später hatte sie die Befunde von den Oberschenkeln und dem Brustkorb diktiert. Die Kurzbefunde, mit deren Hilfe die Kollegen der Chirurgie ihre Therapieentscheidung treffen würden, schrieb sie mit der Hand auf die dafür vorgesehenen Zeilen der Anforderungsscheine. Dann nahm sie die Röntgenbilder vom Leuchtschirm und steckte sie in zwei Tüten, die sie mit Namen und Geburtsdatum der Patientin beschriftete.
Mildred holte das Band aus der Stenorette, legte es zusammen mit einer kleinen Schachtel Pralinen in den Ablagekorb für die Sekretärinnen und ging in den kleinen Raum, in dem ein Bett für den diensthabenden Radiologen stand und jeder Medizinalassistent einen schmalen Schrank für die persönlichen Sachen hatte. Der einzige Schrank ohne Namensschild war ihrer. Sie öffnete ihn, leerte die Taschen ihres Kittels, steckte Füller, Bleistifte, Lineal und die Anstecknadel mit ihrem Namen in ihre Handtasche und ließ den Kittel in den bereitstehenden Wäschesack fallen. Mit einem Griff in das obere Schrankfach vergewisserte sie sich, dass dort nichts mehr lag, dann nahm sie ihren Mantel und verließ den Raum. Auf dem Weg nach draußen ging sie an Professor Hainmayrs Büro vorbei. Mildred klopfte.
„Ja?“
Frau Büchner, die Sekretärin des Chefs, stand über ihren Schreibtisch gebeugt und sortierte Akten. Der Blick, den sie Mildred über den Rand ihrer dunklen Hornbrille zuwarf, war streng und missbilligend. Diese Frau war ihr nicht grün, das wusste Mildred seit ihrer ersten Begegnung. Ob sie ihr mit einem Wort oder unangemessenem Verhalten auf die Füße getreten war oder ob es an ihrem Haar oder ihrer Kleidung lag, wusste Mildred nicht. Wahrscheinlich gab es gar keinen konkreten Grund für diese Abneigung. Vielleicht war Frau Büchner einfach der Meinung, dass Frauen entweder berufstätig oder Mutter sein sollten, aber auf keinen Fall beides. Dass Mildred es sogar wagte, ihr Kind allein großzuziehen, ohne jemals den Kindsvater geheiratet zu haben, brachte viele Menschen an die Grenzen ihrer Toleranz, möglicherweise auch Frau Büchner. In der Schlange beim Bäcker oder Metzger hätte Mildred sie entweder überhaupt nicht beachtet oder ihr mit einer schlagfertigen Antwort die Stirn geboten. Doch leider bewachte diese Frau den Zugang zum Chef.
Wieso nennen die anderen Sekretärinnen sie eigentlich einen Drachen?, fragte sich Mildred nicht zum ersten Mal. Zerberus würde viel besser passen …
„Guten Tag, Frau Büchner.“ Mildred schob ihre Mundwinkel nach oben und lächelte. Sie mochte die Frau mindestens ebenso wenig wie diese sie, doch das war noch lange kein Grund, die Regeln der Höflichkeit zu vergessen. „Ist der Herr Professor kurz zu sprechen? Ich habe heute meinen letzten Tag und würde mich gern von ihm verabschieden und ihm danken.“
Das Wunder geschah, und das Gesicht der Sekretärin wurde weicher, fast milde – was bestimmt nicht an Mildred lag. Tatsächlich verhielt Frau Büchner sich dem Chef gegenüber, als wäre sie allein für sein Wohlergehen verantwortlich.
„Der Professor hat sehr viel zu tun und muss in zehn Minuten bei einer Besprechung mit Herrn Professor Neugebauer von der internistischen Abteilung sein. Aber ich kann ihn fragen, ob er ein paar Minuten erübrigen kann.“
„Danke. Ich brauche auch nicht lange.“
Frau Büchner rauschte davon. Mildred hörte ein beinahe zärtliches Klopfen, das Murmeln von Stimmen. Dann war die Sekretärin auch schon wieder zurück.
„Der Herr Professor erwartet Sie.“
Das Zimmer von Professor Hainmayr erinnerte Mildred immer ein bisschen an das Sprechzimmer ihres Vaters: Die Regale waren vollgestopft mit medizinischer Fachliteratur unterschiedlicher Disziplinen und gebundenen Jahrgängen der wichtigsten medizinischen und radiologischen Fachzeitschriften. Der Schreibtisch war zwar etwas größer als der ihres Vaters, aber ebenfalls aus Palisander gefertigt, und hatte die gleiche Form und die gleichen schlichten Verzierungen, bis hin zur eingearbeiteten schwarzen Lederauflage.
Professor Hainmayr erhob sich, schob sich die runde Brille im Gesicht zurecht und kam auf Mildred zu.
„Frau Dr. Wirtz!“ Er schüttelte ihr herzlich die Hand. „Die Büchner sagte mir gerade, dass Sie sich verabschieden wollen. Sind denn die zwei Wochen Vertretungszeit schon um?“
„Ja, Herr Professor, leider. Ich möchte Ihnen herzlich für die freundliche Aufnahme in Ihrer Abteilung danken.“
„Ach, nicht der Rede wert. Wir haben zu danken. Sie sind eine hervorragende Diagnostikerin, Frau Dr. Wirtz. Ich hätte Sie wirklich gern dauerhaft in meiner Abteilung. Leider wird auf absehbare Zeit keine Stelle frei, aber die nächste ist bereits für Sie reserviert. Solange müssen wir uns eben mit Urlaubsvertretungen trösten. Wann sind Sie denn wieder bei uns?“
„In vier Wochen, Herr Professor. Ich vertrete dann Herrn Dr. Vogl.“
„Jetzt erinnere ich mich wieder. Das freut mich. Wo arbeiten Sie in der Zwischenzeit?“
„Im Alpenpark-Sanatorium am Tegernsee.“
Professor Hainmayr hob eine seiner buschigen Augenbrauen.
„Das Alpenpark-Sanatorium. So, so. Da werden Sie bestimmt den ein oder anderen prominenten Gast aus Wirtschaft, Kultur und Politik kennenlernen. Wer weiß, vielleicht finden Sie so viel Gefallen am Umgang mit der illustren Gesellschaft, dass es Ihnen in einer Klinik wie der unserigen langweilig wird?“
Mildred lachte. „Das glaube ich kaum, Herr Professor.“
„Ganz ehrlich, das kann ich mir bei Ihnen auch nicht vorstellen.“ Der Professor lächelte und streckte ihr seine Hand entgegen. „Alles Gute, Frau Dr. Wirtz. Wir sehen Sie dann in vier Wochen.“
„Auf Wiedersehen, Herr Professor.“
Sie verließ das Sprechzimmer und nickte Frau Büchner zu, die auf einer Bibliotheksleiter stand und sie von oben herab streng durch ihre Brillengläser musterte.
„Falls jemand fragt, die Befunde von heute sind alle diktiert. Und diese Kurzbefunde und die Bilder“, sie winkte leicht mit den gelben Formularen, „bringe ich jetzt gleich direkt in die Chirurgie, Sie brauchen sich also um nichts zu kümmern. Auf Wiedersehen und bis in vier Wochen.“
Frau Büchner antwortete nicht, aber es klang, als seufzte sie. Glücklicherweise hielt Professor Hainmayr deutlich mehr von ihr als seine Sekretärin.
Mildred musste schmunzeln und machte sich auf den Weg in die Abteilung für Chirurgie.
Nur wenige Minuten später war sie auf dem Weg zum Kindergarten, in dem ihre vierjährige Tochter betreut wurde. Es regnete, und natürlich hatte sie am Morgen den Regenschirm zu Hause vergessen, doch das machte ihr nichts aus. Sie hielt sich einfach die Freitagsausgabe der Tageszeitung über den Kopf. Wegen des Anzeigenteils war sie so umfangreich, dass sie sie fast so gut schützte wie ein Schirm. Außerdem war der Regen warm und der Weg zum Kindergarten nicht weit. Während sie einer Frau mit Schirm auswich, dachte sie darüber nach, was der Professor über die nächste frei werdende Assistentenstelle gesagt hatte.
Dauerhaft im Innenstadt-Klinikum zu arbeiten, würde manches erleichtern – die ständige Suche nach Vertretungsstellen in Kliniken und Praxen in und um München herum würde wegfallen. Eine Festanstellung bedeutete auch ein geregeltes Einkommen. Außerdem lag die Klinik wirklich günstig. Weder zu ihrer Wohnung noch zum Kindergarten war es weit, und das Cornelchen fühlte sich dort wohl. Sie hatte Freundinnen gefunden, und die Betreuerinnen waren nett. Allerdings bedeutete eine feste Stelle auch, dass sie an den Nacht- und Wochenenddiensten teilnehmen und auch kurzfristig für erkrankte Kollegen einspringen musste. Das blieb ihr jetzt erspart, sodass sie die Betreuung ihrer kleinen Tochter leichter organisieren konnte. Darüber hinaus plante sie ihre Vertretungen so, dass zwischendurch ein paar Tage bis zu zwei Wochen Zeit war, die sie gar nicht arbeitete, sondern sich stattdessen voll und ganz auf Cornelia konzentrieren konnte. Sie verbrachten dann Stunden auf Spielplätzen, im Zoo und in Eisdielen, besuchten für einige Tage Mildreds Mutter in Amberg oder unternahmen kleine Reisen an den Rhein oder in die Berge. Sie saßen im Wohnzimmer auf dem Boden und spielten Memory, Mensch ärgere Dich nicht oder verarzteten Cornelias Teddy. Sie lasen und hörten gemeinsam Musik.
Mildred genoss diese Tage mit Cornelia, sie waren ihr kostbar. Wollte sie diese Freiheit wirklich aufgeben? Dann war da natürlich auch noch die finanzielle Seite: Vertretungen wurden sehr gut bezahlt, besser als die meisten Medizinalassistentenstellen, und mittlerweile hatte sie sich einen Stamm von Praxen und Kliniken erarbeitet, die bei ihr nachfragten, anstatt umgekehrt. Es gab also einiges zu bedenken.
Aber das sind alles noch ungelegte Eier, dachte sie und überquerte die Straße.
Vor ihr lag die Kirche aus rotem Backstein, direkt daneben der quadratische Neubau, in dem der Kindergarten untergebracht war. Vielleicht wurde in den nächsten drei Jahren in Professor Hainmayrs Abteilung keine Stelle frei. Dann wäre das Cornelchen sieben, ginge zur Schule und sie müssten ihren Alltag ohnehin neu ordnen. Es hatte also keinen Wert, sich jetzt schon den Kopf darüber zu zerbrechen.
Mildred rollte die durchweichte Zeitung zusammen und lief die Stufen zum Kindergarten hinauf. Es war gerade erst zwanzig vor drei, sie lag fantastisch in der Zeit. Mildred zog die schwere Eingangstür auf. Im Flur war es still, keine Kinderstimmen waren zu hören, kein Singen, kein Klappern von Spielzeug. Es roch nach Mittagessen, grüner Seife und Bohnerwachs, und an der Garderobe hingen nur noch wenige Jacken und Mäntelchen – ausnahmslos Kleidung von Kindern mit berufstätigen Müttern. Die anderen, deren Mütter sich zu Hause um Küche, Wäsche, Kinder und Haustiere kümmerten, wurden freitags meistens schon eher abgeholt.
Mildred ging leise zu dem Raum, in dem die vierjährigen Kinder betreut wurden, und schaute durch die in der Tür eingelassene Glasscheibe. Es war ein seltener Anblick, denn Cornelia saß ganz ruhig hinten im Raum, an einem der niedrigen Tische in der Nähe des Fensters. Vor ihr lag ein Blatt Papier, gleich daneben ein ganzes Bündel Wachsstifte. Sie hatte ihren Kopf tief über das Blatt geneigt, malte mit äußerster Konzentration und ließ sich auch durch das andere kleine Mädchen nicht stören, das einen Puppenwagen durch den Raum schob und dabei Kommt ein Vogel geflogen sang.
Eine junge Nonne in der Tracht der Novizinnen half einem kleinen Jungen, bunte Bauklötze vom Boden in eine Holzkiste zu räumen. Als Mildred gegen die Scheibe klopfte, schaute sie hoch, lächelte ihr zu und kam zur Tür.
„Guten Tag, Frau Doktor!“ Schwester Christine hatte eine wohlklingende, sanfte Stimme. Die Kinder, Cornelia eingeschlossen, liebten sie. Auch Mildred war sie die Liebste der sieben Nonnen, die neben den weltlichen Erzieherinnen hier im Kindergarten tätig waren. „Sie sind heute früh dran, Cornelia malt noch.“
Mildred legte einen Zeigefinger an die Lippen und schlich sich an ihre Tochter heran, die ihre Anwesenheit immer noch nicht bemerkt hatte. So leise wie möglich ging sie hinter dem Mädchen in die Hocke.
„Hallo, mein Cornelchen!“, flüsterte sie ihm ins Ohr.
Cornelias Kopf flog herum. Sie sah Mildred aus großen Augen an, dann begann sie zu strahlen, ließ den Wachsstift auf die Tischplatte fallen, sprang auf und breitete die Arme aus. „Mama!“
Sie schlang die Arme um Mildreds Hals und bedeckte ihr Gesicht mit feuchten Küssen, die nach Vanillepudding schmeckten.
„Wie sieht es aus? Bist du fertig mit deinem Bild? Können wir los?“
Cornelia runzelte die Stirn und betrachtete aufmerksam ihr Bild. Dann nickte sie ernsthaft. „Ja, bin fertig.“ Sie lächelte. „Das ist ein Geschenk für Tante Irene. Das bist du.“ Sie deutete mit ihrem bunt beschmierten Zeigefinger auf ein Strichmännchen mit einer wilden gelben Haarpracht, die Mildred spontan an einen Stubenbesen erinnerte. „Das ist Tante Irene.“ Das Strichmännchen hatte einen braunen Mopp auf dem Kopf. „Und das bin ich. Wir gehen in den Tierpark.“
„Das hast du toll gemacht. Die Tante Irene wird sich freuen.“ Mildred drückte ihre Tochter an sich. „Jetzt räum schnell auf, und wasch dir die Hände. Dann ziehst du dich an, und wir machen uns auf den Weg. Tante Irene wartet bestimmt schon auf uns.“
Cornelia gab Mildred das Bild, schob die Wachsstifte in die Schachtel und brachte sie zusammen mit der Malunterlage aus dicker Pappe zum Bastelschrank. Dann stürmte sie ins Bad. Mildred musste schmunzeln: Das war eher die Gangart, die sie von ihrer Tochter gewohnt war – hüpfen, rennen oder klettern.
Als Cornelia wieder herauskam, hob sie ihre Hände hoch und zeigte sie ihr.
„Schau, alles sauber.“ Cornelia strahlte.
„Dann komm, anziehen.“ Mildred schob ihre Tochter in den Flur. Cornelia setzte sich auf die niedrige Bank unter ihrem Haken und zog ihre Hausschuhe aus. „Schwester Christine …“
„Ja, Frau Doktor?“
„Nächste Woche bringt Frau Jäschke das Cornelchen in den Kindergarten und holt sie auch wieder ab. Ich arbeite außerhalb von München.“
„Cornelia hat uns schon davon erzählt“, sagte Schwester Christine und lächelte. „Aber gut, dass Sie das auch noch bestätigen, Kinder denken sich ja zuweilen die abenteuerlichsten Geschichten aus und halten sie für wahr. Ich trage es gleich in unser Buch ein, dann wissen alle Bescheid.“
„Danke.“
„Cornelia scheint sich jedenfalls schon sehr auf den Übernachtungsbesuch bei Frau Jäschke zu freuen.“
„Ja, zum Glück kommen die beiden sehr gut miteinander aus.“
„Den Eindruck habe ich auch immer, wenn Frau Jäschke sie abholt.“
Mildred half Cornelia, die Schleife an den Schuhen zu binden. Meistens war sie so locker, dass sie schon nach wenigen Schritten wieder aufging. Aber Cornelia gelang es von Tag zu Tag besser. Nicht mehr lange, und sie konnte es ganz allein. Und das war ebenfalls Schwester Christine zu verdanken, die mit nie enden wollender Geduld diese kleinen alltäglichen Dinge mit den Kindern übte – Knöpfe schließen, Pullover oder Bluse anziehen, Schuhe zubinden.
Mildred half ihrer Tochter in den Regenmantel und nahm dann die Reisetasche und den Kinderkoffer, den sie schon gestern gemeinsam gepackt hatten mit allem, was Cornelia unentbehrlich schien: Wachsstifte, ihre beiden Lieblingsbücher, den kleinen Arztkoffer und ihren Teddy. Das, was Mildred unentbehrlich schien – Schlafanzug, Wäsche, Kleidung, Zahnputzzeug –, befand sich in der Reisetasche.
„Auf Wiedersehen, Schwester Christine!“ Cornelia winkte der Nonne zu, dann nahm sie Mildreds Hand, und gemeinsam verließen sie den Kindergarten.
Der Bus, mit dem sie zu Irenes Wohnung fahren konnten, hielt nicht weit entfernt, und zum Glück hatte es aufgehört zu regnen. Mildred warf die feuchte Zeitung in einen Mülleimer an der Bushaltestelle. Unterdessen erzählte Cornelia alles, was an diesem Tag im Kindergarten vorgefallen war – dass Susanne sich das Knie auf der Rutsche aufgeschürft und Andreas seine Milch umgeworfen hatte, dass sie ein neues Lied gelernt und Blumen aus Papier gebastelt hatten und dass es Pfannkuchen zu Mittag gegeben hatte und zum Nachtisch Vanillepudding. Mildred schmunzelte. Wenn Cornelia mit Erzählen fertig war, hatte sie immer den Eindruck, selbst den Vormittag im Kindergarten verbracht zu haben.
„Und was hast du heute getan, Mama?“
„Ich habe Röntgenbilder gemacht, sie mir genau angesehen und den anderen Ärzten erzählt, woran der Mann oder die Frau erkrankt ist.“
„Zum Beispiel?“
„Da war zum Beispiel eine alte Frau, die auf einer Treppe ausgerutscht ist und sich das Bein gebrochen hat.“
„Oh. Tut das sehr weh?“
„Ja. Das tut sogar ganz fürchterlich weh. Deshalb ist sie ja auch ins Krankenhaus gekommen.“
„Und wie wird sie wieder gesund?“
„Weißt du, im Grunde könnten Knochen auch ganz von selbst wieder zusammenwachsen. Aber manchmal werden sie dann krumm. Deshalb kümmern sich die Chirurgen um diese Frau.“
„Was sind Chirurgen, Mama?“
„Das sind die Ärzte, die gebrochene Beine oder Arme eingipsen. Und manchmal operieren sie auch, um die Leute wieder gesund zu machen.“
„Was werden die Chi … Chigur …“
„Chirurgen.“
„Was werden die Chirurgen mit der Frau machen?“
„Das entscheiden sie anhand der Röntgenbilder, die wir gemacht haben. Ich nehme an, dass sie die Frau operieren werden.“
Cornelia nickte ernsthaft, dann hüpfte sie über die Gehwegplatten. Schließlich hob sie den Kopf. „Mama! Der Bus kommt!“
Kapitel 2
Darf ich drücken?«, fragte Cornelia, kaum dass sie vor dem Haus standen, in dem Mildreds Freundin Irene Jäschke wohnte.
„Natürlich.“ Sie hielt ihrer Tochter die schwere Haustür auf, und das Mädchen hüpfte an ihr vorbei auf den Fahrstuhl zu. Wenn Mildred ihre Freundin um etwas beneidete, dann die Annehmlichkeiten, die das moderne Apartmenthaus bot. Während sie selbst eine Wohnung in einem Haus Baujahr 1895 bewohnte und alles, egal ob Einkaufstüten, Kinderwagen, ein schlafendes Mädchen oder sich selbst, nach einem langen Arbeitstag in den vierten Stock hochschleppen musste, konnte Irene ganz bequem mit dem Fahrstuhl fahren. Dass Irenes Wohnung dafür sehr viel kleiner war und lediglich aus einem Raum mit Bettnische sowie einem winzigen Bad und ebenso kleiner Küche bestand, war allerdings ein Nachteil, den nicht einmal ein Fahrstuhl wieder wettmachen konnte. Es gab eben immer irgendeinen Haken.
Der Fahrstuhl sauste heran, und Mildred öffnete die glänzende Edelstahltür. Cornelia nahm ihre Hand und trat vorsichtig in den Fahrstuhl. Egal, wie gern sie mit dem Gerät fuhr – der schmale Spalt zwischen dem Treppenhaus und der Fahrstuhlkabine war ihr nicht geheuer. Sobald sie aber in der Kabine standen, kehrte ihre Lebendigkeit zurück.
„Ich drücke!“ Cornelia musste sich auf die Zehenspitzen stellen, um an den Knopf mit der großen schwarzen Drei zu gelangen. Ihr Zeigefinger schaffte es eben gerade, die nötige Kraft aufzuwenden. Dann begann der Knopf zu leuchten, die innere Tür schloss sich, und mit Ruckeln und Summen setzte sich der Fahrstuhl in Bewegung.
Im dritten Stock angekommen, rannte Cornelia durch den langen Flur zu Irenes Wohnung.
Die Klingel schrillte. Licht fiel in den Hausflur, als sich die Tür öffnete.
„Cornelchen!“ Irene hob das Mädchen hoch und wirbelte sie einmal herum. „Ihr seid schon da!“
„Heute bin ich tatsächlich pünktlich losgekommen.“ Mildred stellte die Reisetasche auf die Fußmatte und umarmte ihre Freundin.
„Und ich bin natürlich noch nicht fertig.“ Irene lachte. „Aber vielleicht kannst du mir beim Tischdecken helfen?“ Sie streichelte Cornelia über den Kopf.
„Was gibt es denn?“
„Kaffee, Streuselkuchen vom Bäcker und für dich Kakao.“
„Hurra!“
Irene schaute dem Mädchen nach und lachte.
„Dieses Kind kann sich nicht langsam bewegen, oder?“ Dann verzog sie das Gesicht und seufzte. „Wieder diesen kindlichen Elan haben! Das würde ich mir wünschen.“
Mildred sah die Freundin prüfend von der Seite an. Unter dem dunkelbraunen Pony wirkte Irene etwas blasser als sonst, vielleicht sogar schmaler. Sie sah müde aus, abgekämpft.
„Ist alles in Ordnung, Irenchen?“ Besorgt berührte Mildred die Schulter der Freundin. „Wenn es dir zu viel wird, kann ich das Cornelchen auch mitnehmen an den Tegernsee …“
„Ach was. Willst du mich etwa beleidigen? Seit einem Monat freue ich mich auf die Woche mit der Kleinen!“ Sie lächelte. „Da werde ich doch jetzt keinen Rückzieher machen. Außerdem fehlt mir nichts.“
„Wirklich?“
„Ja. Wir haben ein paar Krankheitsfälle unter den Kollegen. Nichts Ansteckendes, sonst hätte ich dir wegen dem Cornelchen natürlich Bescheid gesagt. Nur eine Verkettung unglücklicher Zufälle – der eine Kollege hatte einen Herzanfall. Zum Glück war es nur ein Warnschuss, dennoch ist er vier Wochen lang ausgefallen. Ein weiterer Kollege musste zu seiner kranken Mutter nach Hamburg eilen, und der dritte ist in seinem Garten über einen Rechen gestolpert und hat sich den rechten Arm gebrochen.“ Sie hob resigniert die Schultern. „Du weißt ja, wie das ist, die Arbeit wird nicht weniger, nur weil drei Ärzte fehlen. Zum Glück ist der Kollege mittlerweile aus Hamburg zurück, und der mit dem Herzanfall fängt nächste Woche wieder an zu arbeiten. Ich kann meinen Urlaub also wie geplant am Montag antreten. Und ganz unter uns – ich brauche die freien Tage!“ Irene lächelte. „Ich freue mich schon auf den Tiergarten Hellabrunn, den Englischen Garten und kiloweise Eiscreme.“
„Sicher?“
„Ganz sicher.“
„Also gut.“ Mildred nickte erleichtert. Der Alltag in der Internistischen Abteilung eines Krankenhauses war auch ohne krankheitsbedingte Personalausfälle anstrengend genug. Dass Irene nach vier Wochen doppeltem Einsatz nicht gerade wie das blühende Leben aussah, konnte sie nachvollziehen. Und wenn ihre Freundin sagte, dass Cornelia bei ihr bleiben konnte, dann stimmte das. Sie hatten keine Geheimnisse voreinander und schwindelten einander auch nicht an, das hatten sie nicht nötig. Sie und Irene waren seit den ersten Tagen des Studiums miteinander befreundet. Dass sie beide gebürtige Kölnerinnen waren, hatte sie schnell zueinanderfinden lassen, sie hatten sich sogar lange Zeit eine Wohnung geteilt.
Irene war erst zum Studium nach München gekommen. Ihr Vater war einer der ungezählten Männer, die aus dem Russlandfeldzug nicht zurückgekehrt waren, und ihre Mutter arbeitete als Bürokraft in einer Tischlerei. Das Geld bei den Jäschkes war deshalb knapp. Mildred hingegen lebte bereits seit dem Krieg mit ihrer Familie in Bayern. Doch trotz der mehr als zwanzig Jahre hatte sie sich den bayrischen Dialekt nicht angewöhnt, man hörte ihr die Rheinländerin immer noch an. Und egal, wie gern sie in München lebte und arbeitete, der Kölner Dom, der Rhein, das offene, ehrliche Wesen der Kölner, das Außenstehende oft als schroff empfanden, die Kölner Mundart und – vor allem – der Karneval fehlten ihr. Natürlich feierte man den – als „Fasching“ – auch in Bayern. Sowohl in Amberg, wo sie mit ihren Eltern und ihrer Schwester Lilian ein paar Jahre gelebt hatte und ihre Mutter immer noch wohnte, als auch in München gab es im Fasching Umzüge und zahlreiche Festlichkeiten. Aber das war nichts im Vergleich zu den närrischen Tagen in Köln, die immer schon am Donnerstag vor Rosenmontag mit der Weiberfastnacht begannen. Mildred und Irene hielten sich „in der Fremde“, wie sie es scherzhaft nannten, aneinander fest, quatschten Kölsch miteinander und reisten jedes Jahr zum Karneval in die Heimat. In den letzten Jahren hatten sie bei Irenes Mutter übernachtet, doch die lebte nun auch seit Kurzem in München. Sie war chronisch herzkrank, und Irene wollte sie lieber in ihrer Nähe haben, damit sie sich um sie kümmern konnte.
Mildred und Irene vertrauten einander bedingungslos, halfen sich gegenseitig, wann immer es nötig war, waren ehrlich zueinander, feierten, lachten und weinten gemeinsam. Als Mildred aus Berlin zurückkam, schwanger von einem verheirateten Mann, war es Irene, die, wie sie selbst auch, davon überzeugt war, dass Mildred keinen Ehemann brauchte, um das Kind großzuziehen. Irene hatte ihr auch beigestanden, als Mildreds Mutter und andere Verwandte sie bedrängten, das Kind doch wenigstens zur Adoption freizugeben. Irene war Cornelias Patin und kümmerte sich liebevoll um die Kleine, wenn Mildred zu einer abendlichen Fortbildung gehen wollte oder – so wie jetzt – einen Vertretungsauftrag außerhalb von München übernahm. Irene selbst war aus eigener Entscheidung unverheiratet und kinderlos und freute sich über ihre „Wochenend-und-Ferien-Tochter“, und Cornelia liebte ihre Tante Irene heiß und innig.
Mildred hängte ihren Mantel an die Garderobe und ging in das Zimmer, das Ess-, Arbeits-, Wohn- und Schlafzimmer zugleich war. Mit dem ihr eigenen Sinn fürs Praktische hatte Irene ihre kleine Wohnung so eingerichtet, dass all ihre Bedürfnisse erfüllt wurden und die Wohnung trotzdem nicht vollgestellt wirkte. Die Möbel waren modern und übernahmen meistens mehrere Funktionen. So war der Esstisch zugleich der Schreibtisch, der sich bei Bedarf in die zierliche Regalwand klappen ließ, in der sich auch noch eine Bar verbarg. Der Couchtisch war zugleich Bücher- und Schallplattenregal, und das Sofa konnte mit wenigen Handgriffen in ein Gästebett verwandelt werden. Ein überaus bequemes Bett, wie Mildred aus eigener Erfahrung wusste.
„Wo soll ich schlafen, Tante Irene?“
„Dieses Mal schläfst du in meinem Bett, Cornelchen.“
„Juhu!“ Mildred konnte sie verstehen. Für ein Kind war die Nische, in der Irenes Bett stand, vor Licht und Blicken geschützt von einem schweren, geschmackvollen Vorhang, ein Traum. Wie eine eigene kleine Höhle. „Danke.“
Cornelia umarmte ihre Patin, und Irene wirkte gerührt. Sie goss Wasser in den Kaffeefilter.
„Der Kaffee ist gleich fertig, und die Milch sollte jetzt auch heiß genug sein.“
Mildred holte Teller und Tassen aus dem Küchenschrank und deckte den Tisch, Cornelia half Irene, den Kuchen anzuschneiden.
„Ich hoffe, dass er schmeckt. Ich habe ihn heute aus einer anderen Konditorei geholt als sonst.“
Das kleine Mädchen beugte sich über den Kuchen und sog die Luft ein.
„Er riecht schon mal gut.“
„Außerdem ist es Kuchen!“ Mildred lachte. „Da ist es dir doch beinahe egal, wie er schmeckt.“
Der Kuchen war aufgegessen, und Cornelia richtete sich in Irenes Bettnische häuslich ein. Mildred konnte hören, wie sie hinter dem Vorhang mit ihrem Teddy flüsterte. Sie und Irene saßen noch bei einer Tasse Kaffee zusammen.
„Wann musst du los?“, fragte Irene.
„In ein paar Minuten. Mein Zug geht um sechs, und vorher muss ich noch meinen Koffer von zu Hause holen.“
„So spät? Ist dann noch jemand in der Klinik? Und wo hast du dein Quartier?“
„Irgendjemand wird schon noch da sein.“ Mildred lachte. „Ich werde jedenfalls am Bahnhof abgeholt und erhalte ein Zimmer in der Klinik. Und morgen früh um neun treffe ich mich mit Frau Klitzsch, der Inhaberin des Sanatoriums, und dem Ärztlichen Direktor und werde in meine Aufgaben eingewiesen. Ich denke, du kannst nachvollziehen, dass ich morgen nicht vor fünf aufstehen will, um rechtzeitig um neun in Bad Wiessee zu sein.“
„Vollstes Verständnis.“ Irene nickte. „Alpenpark-Sanatorium … Ist das nicht die Kurklinik für Prominente?“
„Ja.“ Mildred seufzte und fuhr sich durchs Haar. „Und du bist, weiß Gott, nicht die Erste, die das anspricht. Dabei ist es doch völlig wurscht, ob vor mir ein Showmaster liegt oder ein Maurer. Krank ist krank. Und auf dem Röntgenschirm sind Herkunft und Beruf sowieso egal. Da sehen alle gleich aus.“
„Trotzdem.“ Irene schmunzelte. „Wenn du mal nicht mit einem berühmten Schauspieler oder Künstler an deiner Seite aus der Vertretungszeit zurückkommst!“
„Irene!“ Mildred wusste nicht, ob sie lachen oder sich ärgern sollte. „Deine Fantasie möchte ich haben! Das wäre bestimmt lustig.“
„Wir werden sehen. Wollen wir wetten?“
„Nein.“ Mildred warf einen kurzen Blick auf ihre Armbanduhr und stand auf. „Außerdem muss ich jetzt los. Kann ich dich mit dem Abwasch allein lassen?“
„Selbstverständlich. Ich habe ja heute Hilfe.“
Mildred ging zu der Bettnische. „Klopf, klopf!“
Der Vorhang wurde ein Stück zur Seite gezogen, und dahinter kam Cornelias Gesicht zum Vorschein. „Guten Tag, was wünschen Sie?“
„Ich bin die Mama und möchte mich von meinem Cornelchen verabschieden.“
Das Mädchen sprang vom Bett und ihr in die Arme.
„Tschüss, mein Schatz! Viel Spaß in der Woche und tanz der Tante Irene nicht auf der Nase herum.“
„Mach ich nicht.“
„Glaub ich dir sogar. Ich werde versuchen, jeden Abend anzurufen. Ob das klappt, kann ich aber nicht versprechen, je nachdem, wie krank die Leute dort sind und wie viel ich arbeiten muss. Ich werde dir aber schreiben. Und am nächsten Sonntag bin ich schon wieder da.“
„Ich freue mich schon, Mama!“ Cornelia schlang ihre Arme um Mildreds Hals, und sie trug ihr Töchterchen durch den Hausflur bis zum Fahrstuhl.
„Tschüss, Cornelchen.“ Mildred gab ihrer Tochter noch einen Kuss, dann umarmte sie Irene. „Danke, dass ich sie dir wieder einmal anvertrauen darf.“
Der Fahrstuhl hielt. Das war immer der Moment, in dem es für sie am schwersten war, Cornelia zurückzulassen – egal ob nur für einen Abend oder eine ganze Woche.
„Sehr gerne, Mildred. Du weißt, wie gern ich Cornelia bei mir habe. Mach dir keine Sorgen, wir beide kommen zurecht.“
„Ich weiß.“ Mildred ging in den Fahrstuhl und drückte den Knopf ins Erdgeschoss. „Dann bis nächsten Sonntag!“
Cornelia und Irene winkten, Mildred winkte zurück, dann schloss sich die Fahrstuhltür, und sie fuhr nach unten.














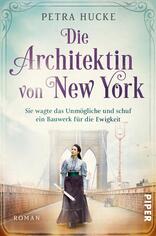
























DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.