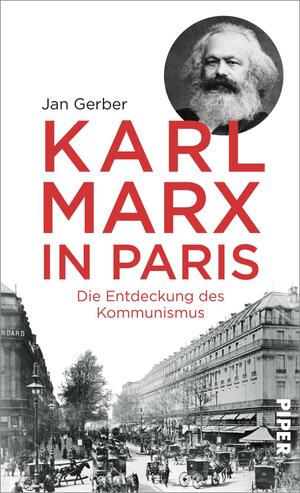
Karl Marx in Paris - eBook-Ausgabe
Die Entdeckung des Kommunismus
„In Jan Gerbers vorzüglichem Essay ›Karl Marx in Paris‹ wird der frühe Marx und vor allem der erste Paris-Aufenthalt von Oktober 1843 bis Februar 1845 untersucht.“ - glanzundelend.de
Karl Marx in Paris — Inhalt
Seitdem sich die Elendszonen des Weltmarkts erneut ausweiten und die westlichen Metropolen erreichen, wird auch dort wieder verstärkt von Arbeit und Kapital, der Klasse und ihrem Kampf gesprochen: Im 200. Jahr nach seiner Geburt hat Marx erneut Konjunktur. Jan Gerber legt eine Auseinandersetzung mit dem Leben und dem Werk von Karl Marx vor, die neuste Forschungen berücksichtigt. Einen besonderen Schwerpunkt bildet der erste Paris-Aufenthalt von 1843 bis 1845. Denn in dieser Zeit entwickelte Marx die zentralen Begriffe seines Denkens: Er traf als Radikaldemokrat in Paris ein und verließ die Stadt als überzeugter Klassenkämpfer und Kommunist.
Leseprobe zu „Karl Marx in Paris“
Prolog
Karl Marx am Pazifik
Im Februar 1945 traf Bertolt Brecht eine ungewöhnliche Entscheidung: Der Dichter, den es bei seiner Flucht vor dem Nationalsozialismus bis an die amerikanische Pazifikküste verschlagen hatte, entschloss sich, das Kommunistische Manifest neu zu schreiben. Dieser wohl bedeutendste Text der internationalen Arbeiterbewegung, den Karl Marx und Friedrich Engels fast 100 Jahre zuvor im Auftrag des Bunds der Kommunisten verfasst hatten, sollte in die Form eines Lehrgedichts gebracht werden.
Nur wenige Tage zuvor, am Morgen des 27. [...]
Prolog
Karl Marx am Pazifik
Im Februar 1945 traf Bertolt Brecht eine ungewöhnliche Entscheidung: Der Dichter, den es bei seiner Flucht vor dem Nationalsozialismus bis an die amerikanische Pazifikküste verschlagen hatte, entschloss sich, das Kommunistische Manifest neu zu schreiben. Dieser wohl bedeutendste Text der internationalen Arbeiterbewegung, den Karl Marx und Friedrich Engels fast 100 Jahre zuvor im Auftrag des Bunds der Kommunisten verfasst hatten, sollte in die Form eines Lehrgedichts gebracht werden.
Nur wenige Tage zuvor, am Morgen des 27. Januar 1945, war die Rote Armee bei ihrem Vormarsch 60 Kilometer westlich von Krakau auf ein riesiges Sperrgebiet gestoßen. Gegen neun Uhr erreichte eine Aufklärungseinheit der 1. Ukrainischen Front das erste Tor. Es dauerte fast drei Stunden, bis die Minen geräumt waren, die von den Deutschen bei ihrer Flucht hinterlassen worden waren. Als Major Anatoli Schapiro das Gelände betrat, sah er überall Leichen.1 Zwischen ihnen bewegten sich ausgehungerte Menschen in gestreifter Häftlingskleidung. Sie trugen trotz der Minustemperaturen und des Schnees keine Schuhe, sondern liefen barfuß. Es waren die letzten Insassen des Konzentrationslagers Auschwitz. Der Wind bedeckte die Uniformen der Befreier mit Asche; die Schneedecke färbte sich schwarz. Der Rauch aus den seit 1941 betriebenen Krematorien hatte sich auf sämtliche Dächer gelegt, kurz vor ihrem Rückzug hatten die Wachmannschaften zudem einige Baracken in Brand gesetzt.
Einer anderen Einheit der Roten Armee hatte sich schon im Juli 1944 ein ähnliches Bild geboten. In den Verbrennungsöfen von Majdanek, kurz vor den Toren Lublins, fanden die Soldaten menschliche Überreste; die Gaskammern waren im Unterschied zu denen von Auschwitz noch intakt. In den Effektenkammern lagerten die Kleidungsstücke Tausender Ermordeter, darunter die zahllosen „Kinderschuhe aus Lublin“, denen Brechts Dichterkollege Johannes R. Becher 1944 seine gleichnamige Ballade widmete. Spätestens seit dieser Zeit konnten die Gerüchte über den Massenmord an den europäischen Juden, die die Emigranten im Exil ab Ende 1941 erreicht hatten, nicht mehr als Übertreibung abgetan werden. Die Bilder aus den Todesfabriken ließen zur Gewissheit werden, dass sich die Nazis zum Ziel gesetzt hatten, buchstäblich alle Juden, egal welchen Alters, welcher sozialen Herkunft und welcher politischen Überzeugung, zu vernichten.
Es ist nicht überliefert, ob Bertolt Brecht die Tagesberichte von der 1. Ukrainischen Front verfolgte. Dennoch besteht kein Zweifel daran, dass er mit seiner Entscheidung, das Kommunistische Manifest neu zu schreiben, auf die Erfahrung reagierte, für die der Begriff des gerade befreiten Vernichtungslagers Auschwitz bald zur – wenn auch ungenauen – Chiffre wurde. In Pacific Palisades, wo der Dichter in der unmittelbaren Nachbarschaft Hanns Eislers, Lion Feuchtwangers, Max Horkheimers und Theodor W. Adornos wohnte, hatte sich seit Anfang der 1940er-Jahre eine schwere Depression ausgebreitet.
Die Nachrichten aus Europa, die nach und nach an der amerikanischen Westküste eintrafen, betrafen nicht nur enge Freunde und Verwandte der Emigranten. Durch die Meldungen vom Kontinent wurde zugleich ihr Weltbild erschüttert. Ein Nachbar Brechts, Friedrich Pollock, der engste Vertraute Max Horkheimers, hatte schon im Dezember 1941 auf einem Thesenpapier, das er während eines Aufenthalts in New York anfertigte, notiert: „In den Marxschen Begriffen stimmt etwas nicht.“2 Er ergänzte, dass man herausfinden müsse, „was das ist“.
In der Tat versagten die Kategorien der Arbeiterbewegung bei der Erklärung des Nationalsozialismus. Mehr noch, sie wurden durch die braune Revolution, die Integration der Arbeiterschaft in das Regime und das Ausmaß der Verbrechen dementiert. Wer im Exil, im Zuchthaus oder im Konzentrationslager ungebrochen an der Idee der Revolution festhalten wollte, musste ignorieren, dass die Nazis ihr eigenes Vorgehen nicht ganz zu Unrecht mit diesem ehrwürdigen Begriff umschrieben: Die alten Eliten des Deutschen Reichs waren spätestens im Schicksalsjahr 1938 politisch entmachtet worden; die Sozialstruktur wurde durch das System aus Vierjahresplänen, „Kraft durch Freude“ und Egalisierung auf rassischer Grundlage tiefgreifend verändert.3
Vor allem aber wurde der Begriff des Proletariats beschädigt. So war die Geschichte des Nationalsozialismus weder eine Abfolge von Klassenkämpfen, wie es Marx und Engels in den 1840er-Jahren für die gesamte Geschichte der Menschheit behauptet hatten, noch war die Arbeiterschaft eine ernsthafte Bedrohung des Regimes. Im Gegenteil: Anders als von den Vordenkern des „Historischen Materialismus“ vorhergesagt, entledigte sich das Proletariat nicht seiner Ketten, sondern seiner jüdischen Nachbarn. Angehörige der Arbeiterschaft, der Mittelschichten und des Bürgertums verschmolzen zum Wohle des Ganzen, zum Wehe der Juden zu einer großen weltanschaulichen Einheit. Der Widerstand gegen den Nationalsozialismus war zumindest in Deutschland, dessen Arbeiterbewegung schon im 19. Jahrhundert zur marxistischen Musterschülerin erklärt worden war, weder ein Massenphänomen noch an die soziale Herkunft gebunden. Er ging stattdessen auf das Konto kleiner Gruppen und Einzelner, die aus den unterschiedlichsten Bevölkerungsschichten kamen.
Damit wurde auch der fortschrittsfromme Geschichtsoptimismus der Arbeiterbewegung angefressen. War der Glaube an einen roten Faden der Geschichte schon mit dem Ersten Weltkrieg in Mitleidenschaft geraten, lässt sich spätestens seit Auschwitz kein Zusammenhang mehr zwischen Geschichte, Fortschritt und Vernunft herstellen. Warum der Nationalsozialismus und Auschwitz notwendige Voraussetzungen für eine Gesellschaft der Freien und Gleichen sein sollen, wie Marx es noch für den Prozess der Industrialisierung konstatiert hatte, ist mit den Mitteln der Vernunft nicht zu erklären.
Die von den Diskussionen in Pacific Palisades überlieferten Protokolle und die Notizen Bertolt Brechts zeigen zwar, dass der Dichter der Infragestellung der Marx’schen Kategorien durch Friedrich Pollock skeptisch gegenüberstand. Dennoch blieb er weder unbeeinflusst von diesen Gesprächsrunden noch von den Nachrichten, die ihnen zugrunde lagen. Schon 1942 formulierte er zaghafte Zweifel an der bisherigen Klassenkampfrhetorik der Arbeiterbewegung: „Auch der Begriff der Klasse ist, vielleicht, weil er uns vorliegt in der Konzeption des vorigen Jahrhunderts, heute viel zu mechanisch im Gebrauch.“4 Sein Entschluss, das Kommunistische Manifest zu aktualisieren und in Gedichtform zu bringen, war Ausdruck dieser Zweifel. Er setzte sich an die Nachdichtung, weil er ahnte, dass die „Bibel der Arbeiterbewegung“, wie der schmale Band gelegentlich genannt wurde, an Ausstrahlungs- und Geltungskraft verloren hatte.5
Brecht gelang es nicht, sein Vorhaben zu realisieren. Zwar griff er die Idee, das Manifest zu erneuern, bis an sein Lebensende immer wieder auf. Mehr als ein paar Verse kamen jedoch nicht zustande. Der Grund hierfür mag im Zufall oder in Brechts fehlender Zeit zu suchen sein: Er erlag bereits im August 1956 einem Herzinfarkt. Vielleicht scheiterte das Vorhaben jedoch auch, weil es nach den Maßgaben der von Brecht propagierten Kunst, die stets auch Reflexion auf historische Erfahrung sein sollte, nicht umzusetzen war. Zumindest waren die leninistischen Kategorien, um die der Dichter die Ursprungsfassung des Manifests ergänzen wollte, nicht im Geringsten dazu geeignet, den Erfahrungen der 1930er- und frühen 1940er-Jahre künstlerisch Ausdruck zu verleihen: Der Nationalsozialismus und der Holocaust ließen sich weder unter Verweis auf den neuen „staatsmonopolistischen Kapitalismus“ noch auf den Imperialismus erklären, dessen Zeitalter erst in Marx’ letzten Lebensjahren begonnen hatte.
Brechts Freund Hanns Eisler, der in Pacific Palisades an den Diskussionen über die Integration der Arbeiterschaft in das nationalsozialistische Regime teilgenommen hatte, riet jedenfalls sowohl aus künstlerischen als auch aus inhaltlichen Gründen ab. Die Voraussetzung dafür, das Kommunistische Manifest verstehen zu können, so rekapitulierte der Komponist seine Einwände viele Jahre später, sei der „praktische Klassenkampf“. Der aber, so ergänzte er, habe in Nazideutschland nicht stattgefunden.6
Der Kalte Krieg dürfte schließlich dazu beigetragen haben, dass Brecht die Bearbeitung des Kommunistischen Manifests bald nicht mehr als seine dringlichste Aufgabe empfand. Durch die schon kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs anhebende Blockkonfrontation wurden neue Fragen auf die Tagesordnung gesetzt. Vor allem die drohende Vernichtung der Menschheit durch ein atomares Aufeinandertreffen der Supermächte ließ die Diskussionen der Kriegszeit als überholt erscheinen. Einige der sozialen Konfliktlinien des 19. Jahrhunderts, auf die der Marxismus stets bezogen war, schienen durch den Ost-West-Konflikt hingegen reaktiviert zu werden. Der Widerspruch zwischen Bourgeoisie und Proletariat, Freiheit und Gleichheit erfuhr im Gegensatz von West und Ost eine erweiterte Neuauflage. So wurden die Debatten über die Geltungskraft der Marx’schen Kategorien, die während des Zweiten Weltkriegs auf breiter Ebene geführt worden waren, abrupt abgebrochen. Nur einige wenige Intellektuelle diskutierten weiter über die „Integration der Arbeiterklasse“ (Herbert Marcuse), verstanden darunter aber bald weniger deren Beteiligung an den Verbrechen des Nationalsozialismus als ihre soziale Befriedung durch den neuen Massenkonsum.7
In diesem Buch sollen die Diskussionen der Exilzeit, die wegen des aufziehenden Kalten Kriegs beendet wurden, wieder aufgegriffen werden. Ausgehend von der historischen Erfahrung, dass die zukunftsfrohen Kategorien der Arbeiterbewegung vor der Wirklichkeit des Nationalsozialismus versagten, wird der Frage Friedrich Pollocks nachgegangen, was in den Marx’schen Topoi nicht „stimmt“. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei den Begriffen Klasse, Revolution und Geschichte entgegengebracht, die im Marxismus zu einer Einheit verschmolzen: Revolutionen wurden als die Schrittmacher der Geschichte begriffen, das Proletariat galt als revolutionäres Subjekt, dem eine historische Mission zukomme.
Zwar spricht einiges dafür, dass Marx der Klasse am Ende seines Lebens nicht mehr dieselbe Bedeutung beimaß wie noch in den 1840er-Jahren. Einen „Abschied vom Proletariat“, wie er von André Gorz knapp 100 Jahre nach Marx’ Tod verkündet wurde, vollzog er jedoch nie.8 Für die Arbeiterbewegung selbst blieb die Klasse stets die wichtigste Bezugsgröße. Marx’ Wertformanalyse und seine Fetischkritik wurden weder innerhalb der Sozialdemokratie noch von linkssozialistischer und kommunistischer Seite im größeren Maß zur Kenntnis genommen.9 Das Fetischkapitel des Kapitals oder die Ausführungen über den Geld- und den Kapitalfetisch in den Theorien über den Mehrwert blieben, wie Franz Mehring, der große alte Historiker der Sozialdemokratie, schon vor mehr als 100 Jahren konstatiert haben soll, „Literatur für wissenschaftliche Experten“.10
Vor dem Hintergrund der Faszination, die gerade die Rede von der Klasse, der Revolution und der mit „eherner Notwendigkeit“ auf eine bessere Gesellschaft zulaufenden Geschichte auf die Arbeiterbewegung ausübte,11 stellt sich eine Reihe von Fragen: Wie kam Marx auf die Idee, dass die Geschichte, wie es im Kommunistischen Manifest heißt, die „Geschichte von Klassenkämpfen“ sei? Warum glaubte er, dass die historische Entwicklung mit geradezu naturgesetzlicher Dynamik auf eine „Gesellschaft der Freien und Gleichen“ zusteuere? Und aus welchem Grund ernannte er ausgerechnet das Proletariat, sprich: die moderne Industriearbeiterschaft, zum revolutionären Subjekt? Wenn die neue Klasse auch die „Verkommensten der Verkommenen“ unter sich versammelt, von denen Friedrich Engels einmal sprach,12 warum sollte dann ausgerechnet von ihrer Diktatur eine freundlichere Welt zu erwarten sein? Wäre statt des Sozialismus nicht auch die Barbarei möglich, vor der Engels am Ende seines Lebens gewarnt haben soll?13 Und würde der Sozialismus dann nicht sogar identisch mit dieser Barbarei werden?
Wer diesen Fragen nachgehen will, sieht sich auf Marx’ ersten Paris-Aufenthalt zwischen Oktober 1843 und Februar 1845 verwiesen. Denn seine Hinwendung zum Klassenkampf, zum Kommunismus und zum Proletariat lässt sich exakt auf diese 15 Monate in der Seine-Metropole datieren. „Die Jahre 1843 bis 1845 sollten die entscheidenden seines Lebens werden“, kommentierte der Marx-Biograph Isaiah Berlin Mitte des vergangenen Jahrhunderts.14 In einem der letzten Briefe, die Marx vor seiner Übersiedlung nach Frankreich schrieb, hatte er noch davon gesprochen, dass in seinen Kreisen eine erhebliche Konfusion über das gesellschaftspolitische „Wohin“ bestehe: „Nicht nur, dass eine allgemeine Anarchie unter den Reformern ausgebrochen ist, so wird jeder sich selbst gestehen müssen, dass er keine exakte Anschauung von dem hat, was werden soll.“15 In Paris legte sich zumindest seine eigene Orientierungslosigkeit. Der als Radikaldemokrat in Paris eingetroffene Marx verließ die Stadt als überzeugter Klassenkämpfer und Kommunist. Als er Ende 1847, zwei Jahre nach seiner Ausweisung aus Frankreich, in Brüssel gemeinsam mit Friedrich Engels die Arbeit am Kommunistischen Manifest aufnahm, hatten sie bereits ein festgefügtes Bild des „Historischen Materialismus“ vor Augen. Sie waren zu der Einschätzung gelangt, dass alle Geschichte die Geschichte von Klassenkämpfen sei, die gesellschaftliche Entwicklung unweigerlich auf den Kommunismus hinauslaufe und die Geschichte dem Proletariat die Aufgabe zugewiesen habe, das letzte Gefecht zu führen, dem das „Reich der Freiheit“ folge. Im Manifest wurden die in Paris entstandenen Gedanken nur noch schriftlich fixiert.
Mit der Rekonstruktion von Marx’ erstem Paris-Aufenthalt ist dieses Buch zugleich ein ins Historische verlegter Kommentar zum gegenwärtigen Marx-Boom. Denn seitdem sich die Elendszonen des Weltmarkts erneut ausweiten und die westlichen Metropolen erreichen, wird auch dort wieder verstärkt von Arbeit und Kapital, der Klasse und ihrem Kampf gesprochen. An amerikanischen und britischen Universitäten wird bereits eine neue Marx-Debatte gefordert; im Feuilleton wird die Frage gestellt, ob Marx „doch recht“ hatte.16
Diese Diskussionen kommen jedoch in der Regel ohne jeden Hinweis auf das bereits stattgefundene Dementi mindestens eines Teils der Marx’schen Grundbegriffe aus. Die im 19. Jahrhundert entwickelten Kategorien werden vielfach blindlings auf die Situation des 21. Jahrhunderts übertragen, ohne ihren Entstehungszusammenhang auch nur zu erwähnen. Um herausfinden zu können, ob und in welcher Weise der vor 200 Jahren geborene Karl Marx etwas zur Erkenntnis der Gegenwart beitragen kann, müssten zunächst die – im besten Fall – historisch gewordenen Anteile seines Werks freigelegt werden. Vielleicht kann dieses Buch einen kleinen Beitrag dazu leisten.
Erster Teil
Der Weg ins Exil
Ankunft in Paris
Als Karl Marx Mitte Oktober 1843, im Alter von nur 25 Jahren, in Paris eintraf, war er weder Klassenkämpfer noch Kommunist. Der Begriff der Klasse hatte bis dahin an keiner Stelle seines Werks Erwähnung gefunden. Gegen die Rede vom Kommunismus, die durch Étienne Cabets 1840 erstmals erschienenes Buch Voyage en Icarie(Reise nach Ikarien) populär geworden war,1 hatte er sogar eingehend polemisiert. In einer Auseinandersetzung mit der Augsburger Allgemeinen, die seinerzeit als eines der besten Blätter Europas galt, hatte Marx 1842 erklärt, die Idee des Kommunismus einer „gründlichen Kritik“ unterziehen zu wollen. Auf Versuche, diese Ideen in die Tat umzusetzen, so ergänzte der Mann, dessen Name bald wie kein anderer mit dem Kommunismus gleichgesetzt wurde, sollte mit Kanonen geantwortet werden.2
Dennoch war Marx auch in dieser Zeit kein Freund der Friedhofsruhe, die seit dem Wiener Kongress 1815 in seinem Heimatland Preußen herrschte. Schon während seiner Studienzeit in Berlin, wo er sich vom raufenden und saufenden Korpsstudenten in einen philosophierenden Workaholic verwandelte, war er zu der Überzeugung gelangt, dass die Welt falsch eingerichtet sei. Vom Kantianismus kommend, hatte er sich zunächst Hegel zugewandt, der 1818 den Lehrstuhl Fichtes an der Berliner Universität übernommen hatte. Der preußische Kultusminister Karl vom Stein zum Altenstein protegierte den Philosophen und seine Anhänger: Eduard Gans wurde 1826 zum ordentlichen Professor der Rechte in Berlin ernannt, Georg Andreas Gabler folgte 1835 auf den Lehrstuhl für Philosophie. Der Grund dieser Unterstützung war nicht allein Hegels Verklärung des Staats zum „Irdisch-Göttlichen“, mit der auch die stetig anwachsende preußische Bürokratie weltanschaulich aufgehübscht werden konnte.3 Seine philosophische Schule stand zugleich für den zaghaften Reformkurs, den der Minister gegen die konservativen Kreise um den Sohn des Königs, den späteren Friedrich Wilhelm IV., durchzusetzen versuchte.
Als Marx 1836, nach einem einjährigen Intermezzo an der Universität Bonn, in Berlin zu studieren begann, war Hegel bereits seit fünf Jahren tot. Er war während der großen Berliner Choleraepidemie gestorben – wenn auch wohl nicht, wie vom Arzt diagnostiziert, an der Seuche, sondern an einem Krebsleiden. Vermittelt durch seine Schüler waren die Ideen des Philosophen an der Friedrich-Wilhelms-Universität, wie die Hochschule bis 1945 hieß, jedoch überaus lebendig. Ein Brief, den Marx aus Berlin an seinen Vater schrieb, verdeutlicht die Euphorie, die das Studium Hegels bei ihm auslöste: Er sei „wie toll“ an der Spree herumgelaufen und schließlich voller Erregung von Stralau, einem kleinen Dorf, in dem er sich zur Erholung aufhielt, nach Berlin gerannt. Dort habe er „jeden Eckensteher umarmen“ wollen. Immer enger habe er sich an die „jetzige Weltphilosophie“ gekettet. „Ein Vorhang war gefallen“, so resümierte Marx, „mein Allerheiligstes zerrissen und es mussten neue Götter hineingesetzt werden“.4 Philosophie konnte seinerzeit eine ähnliche Begeisterung hervorrufen wie bald nur noch Popmusik.
Der Hegel, den Marx in den Vorlesungen von Eduard Gans kennenlernte, unterschied sich jedoch deutlich von dem Hegel, den Friedrich Engels später mit einer gewissen Übertreibung als Schöpfer der „königlich preußischen Staatsphilosophie“ bezeichnete.5 Schon bei einem Essen am Königshof im Wintersemester 1827/28 hatte sich der Thronfolger darüber empört, dass Gans seine Studenten zu Republikanern erziehe.6 Hegel, an den die Beschwerde gerichtet war, übernahm die Vorlesung in Rechtsphilosophie daraufhin wieder selbst. Er hatte sie seinem Kollegen erst kurz zuvor überlassen.
In der Tat gab Gans dem Hegelianismus eine republikanische Färbung, die nur bedingt im Sinn seines Erfinders war. So hatte sich Hegel in Berlin mehrfach für das Ständewesen ausgesprochen; er war in seinen späten Jahren allenfalls ein Anhänger der konstitutionellen Monarchie. Seine Philosophie bot jedoch Raum für liberalere Interpretationen: Immerhin gehörte er 1801, als er in Jena mit der Entwicklung seines Systems begann, selbst noch zu den Freunden der Französischen Revolution. Auch wenn er aufgrund des Großen Terrors auf Abstand zu den Jakobinern gegangen war, erhob er bis an sein Lebensende alljährlich am 14. Juli sein Glas auf die Erstürmung der Bastille.7
Die Junghegelianer schöpften das subversive Potenzial der Philosophie ihres Meisters weiter aus. Der Name dieses losen Zusammenschlusses von Theologen und Philosophen, dem sich Marx im Sommer 1837 anschloss, bezog sich nicht zuletzt auf den Altersdurchschnitt dieser neuen Generation von Hegel-Anhängern: Sie hatten ihre politische Prägung ausnahmslos in der Restaurationsära erhalten. Spätestens seit der französischen Julirevolution 1830 war der Verweis auf die Jugend jedoch auch eine Kampfansage ans Alte: Giuseppe Mazzini, dem Marx lange Zeit große Anerkennung entgegenbrachte, hatte 1831 im französischen Exil die radikaldemokratische Sammlungsbewegung Junges Italien gegründet. Kurz darauf entstanden die jungdeutsche Bewegung, die insbesondere durch Heinrich Heine Bekanntheit erlangte, und das Młoda Polska – das Junge Polen.
Ohne sich direkt auf diese teilweise nur kurzlebigen Gruppierungen zu beziehen, teilten die Junghegelianer deren Unzufriedenheit mit dem Zeitalter der Heiligen Allianz. Ausgehend von einer Historisierung der biblischen Schriften, gelangten David Friedrich Strauß, Ludwig Feuerbach, Bruno Bauer, Arnold Ruge und andere junge Anhänger Hegels innerhalb kürzester Zeit zur Kritik der Religion. Insbesondere Strauß, dessen 1835/36 erschienener Zweiteiler Das Leben Jesu, kritisch bearbeitet zum Manifest der „linken“ Hegel-Lektüre wurde, hatte noch versucht, Religion und Philosophie miteinander zu versöhnen. Durch eine historisch-kritische Bibelexegese, Quellenkritik und Mythenforschung sollte, wie er formulierte, die „Wahrheit der kirchlichen Vorstellung von Christus“ herausgestellt werden.8 Bald hielten die Junghegelianer dieses Unterfangen jedoch für unmöglich. Strauß hatte die Heilige Schrift so gründlich erledigt, dass sein komplizierter Versuch, den Glauben auf einer höheren Stufe wiederherzustellen, kaum noch einen seiner Freunde überzeugen konnte.
Die Kritik der Religion führte die Junghegelianer schließlich zur Kritik der Gesellschaft; die religionsphilosophische Debatte verwandelte sich in eine politische. Hierfür gab es gute Gründe: Denn in dem Maß, in dem die Fundamente des Glaubens zertrümmert wurden, wurden auch die Grundlagen des Staats demontiert.9 Das betraf nicht zuletzt die Vorstellung vom Gottesgnadentum des Königs. Wenn die Autorität des Monarchen nicht auf Gott zurückgeht, so lautete eine der bald alles entscheidenden Fragen, wie ist sie dann zu legitimieren? Die enge Verknüpfung von Religion, Kirche, Staat und Herrscherhaus in Preußen tat ein Übriges. Der Landesherr war zugleich oberster Bischof; die evangelische Kirche fungierte als Staatskirche. Durch die Kritik der Religion wurde insofern der gesamte „christliche Staat“, wie die konservativen Kräfte um Friedrich Wilhelm IV. das von ihnen ersehnte Ungetüm bald nannten, infrage gestellt.
Im Zuge dieser Wendung vom Theologischen aufs Politische entfernten sich viele Junghegelianer immer weiter von Hegel. Am Ende wandten sie sich schließlich gegen ihn selbst. Das Zauberwort, das sie gegen ihren einstigen Lehrer richteten, hatte durch diesen selbst erst eine neue Bedeutung erlangt. Es hieß „Dialektik“ und durfte bald in keiner Kampfschrift der marxistischen Arbeiterbewegung fehlen. Durch Negation und die berühmte Bewegung in Widersprüchen, die schnell auf den Dreiklang von These, Antithese und Synthese reduziert wurde, wollten Feuerbach, Marx und andere ihr einstiges Vorbild vom Kopf „auf die Füße“ stellen, wie es in der bekannten Formulierung von Friedrich Engels heißt.10 Die Junghegelianer, so schrieb der Philosoph Karl Löwith später, wollten „die philosophische Theorie in den Dienst der geschichtlichen Praxis stellen“; die Philosophie sollte zur verändernden Kraft werden.11 Anders als von Hegel angenommen, so konstatierte Marx kurz vor der Übersiedlung nach Paris ganz exemplarisch, sei das Wirkliche nicht vernünftig, sondern das Vernünftige müsse erst wirklich werden.12 In der Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, seinem letzten ausschließlich in Deutschland entstandenen Manuskript, erklärte er, dass die Entzweiung des Menschen in einen dem Allgemeinwohl verpflichteten Citoyen und einen am Eigennutz orientierten Bourgeois in einer „wahren Demokratie“ aufgehoben werden könne: „Die Demokratie ist das aufgelöste Rätsel aller Verfassungen.“13
Im Unterschied zu seinen philosophischen Überlegungen waren die politischen und sozialen Forderungen, die Marx formulierte, bis zu seiner Übersiedlung nach Frankreich jedoch ebenso spärlich wie unpräzise. Der Gedanke des Freihandels sollte mit den Menschenrechten und dem allgemeinen Wahlrecht verbunden werden. Betrachtet mit den Kategorien der Zeit, war der Karl Marx, der im Herbst 1843 an der Seine eintraf, ein Radikaldemokrat mit Restsympathien für den Liberalismus.
Diesen Ideen war bereits seine Tätigkeit für die Rheinische Zeitung verpflichtet gewesen, für die er vor seiner Übersiedlung nach Frankreich gearbeitet hatte. Marx’ erster Artikel für das Blatt war im Mai 1842 erschienen; im Oktober, fast auf den Tag genau ein Jahr vor seinem Aufbruch nach Paris, übernahm er die Leitung. Der kaum 24-Jährige brachte die Rheinische Zeitung zunächst auf Erfolgskurs: Unter Marx’ Leitung vervierfachte sich die Abonnentenzahl von knapp 1000 auf etwa 3500.14
Dennoch hatte er seine ersten journalistischen Gehversuche nur unfreiwillig unternommen. Sie waren eine Folge der politischen Veränderungen nach dem Tod Friedrich Wilhelms III. im Juni 1840, die mit der schrittweisen Radikalisierung der Junghegelianer zusammenfielen. Die Krönung des Thronfolgers hatte in Teilen des liberalen und national gesinnten Bürgertums – beides bildete damals vielfach eine Einheit – zunächst Hoffnungen auf Reformen geweckt: Friedrich Wilhelm IV. rehabilitierte zahlreiche Oppositionelle der Restaurationszeit, darunter so unterschiedliche Personen wie den Franzosenfresser Ernst Moritz Arndt, den „Turnvater“ Friedrich Ludwig Jahn und den Revolutionär Ludwik Oborski, der 1830 am polnischen Novemberaufstand teilgenommen hatte. Zugleich verkündete der Monarch, dass die preußischen Provinziallandtage, die unter der Regentschaft seines Vaters nur alle drei Jahre getagt hatten, im Zweijahrestakt zusammentreten dürften.
Schon bald entpuppte sich Friedrich Wilhelm IV. jedoch als religiöser Eiferer. Der neue König war ein rückwärtsgewandter Romantiker und ein Anhänger der neupietistischen Erweckungsbewegung, heute würde man sagen: ein Sektenmitglied. Er sehnte sich nach dem Sacrum Imperium des Mittelalters zurück und versuchte das öffentliche Leben nach den Prinzipien preußischer Treue und christlichen Glaubens zu reorganisieren. In seinen verklärenden Rekursen auf eine mythische Vergangenheit lag auch der zentrale Unterschied zur Politik seines Vaters: Während der Autoritarismus Friedrich Wilhelms III. auf die obrigkeitsstaatliche Grundierung der preußischen Aufklärung zurückging, war sein Sohn ein Repräsentant der romantischen Gegenaufklärung.15
Als seinen zentralen Feind an den Universitäten betrachtete der neue Monarch den Hegelianismus, den er für eine Brutstätte des Unglaubens hielt. 1841 berief er den alten Schelling an die Berliner Universität, damit dieser, wie sich der Herrscher mit einer schon damals schwülstig klingenden Formulierung ausdrückte, die „Drachensaat des Hegelschen Pantheismus“ ausreiße.16 An Schellings Antrittsvorlesung nahmen so unterschiedliche Intellektuelle wie Michail Bakunin, Jacob Burkhardt, Leopold von Ranke, Alexander von Humboldt, Søren Kierkegaard und der junge Friedrich Engels teil, der in Berlin seinen Militärdienst ableistete. Schellings Lehrveranstaltungen endeten in der Regel in wilden Diskussionen mit den Anhängern Hegels. Die königstreuen Kräfte hatten indes den längeren Atem, sprich: das letzte Wort in den universitären Berufungsverfahren.
Im Zuge dieses Kulturkampfs zwischen Offenbarung und Geschichte, konservativen Vorstellungen und liberalen Ideen wurde Marx’ damaliger Mentor Bruno Bauer 1841 aus dem akademischen Dienst entlassen. Er war kurz vor dem Tod Friedrich Wilhelms III. als Privatdozent von Berlin nach Bonn versetzt worden, wo ihm eine Professur in Aussicht gestellt wurde. Nun wurden ihm sämtliche Zukunftsperspektiven verstellt.
Die Entlassung Bauers hatte unmittelbare Folgen für die akademische Karriere seines Schützlings Karl Marx. Der junge Philosoph war nicht nur ein Vertreter jener Schule, für die an den preußischen Universitäten fortan kein Platz mehr war. Er hatte seine damals noch deutlich ausgeprägten wissenschaftlichen Ambitionen zudem eng mit der Karriere Bauers verbunden: Der akademische Betrieb war, auch daran sollte sich in den folgenden 100 Jahren nur wenig ändern, ein quasifeudales Unternehmen. So hatte der neun Jahre ältere Bauer bei seiner Versetzung nach Bonn erklärt, Marx so bald wie möglich zu sich holen zu wollen; gemeinsame Lehrveranstaltungen waren bereits in Planung. Mit Blick auf diese Aufstiegschance hatte sich Marx überstürzt in Berlin exmatrikuliert und in Jena eine Dissertationsschrift eingereicht. Im April 1841, nur wenige Tage nach der Eröffnung des Verfahrens, wurde er promoviert: Die Universität Jena gehörte zu den wenigen deutschen Hochschulen, an denen der Doktortitel auch in Abwesenheit verliehen wurde.
Aber auch die Rheinische Zeitung, die Marx in dieser für ihn schweren Zeit ein finanzielles Auskommen bot, fiel dem neuen Staatskonservativismus unter Friedrich Wilhelm IV. zum Opfer. Das Blatt war Anfang der 1840er-Jahre als Sprachrohr einer neuen Generation des liberalen Kölner Bürgertums gegründet worden. Unter den Anlegern der durch Aktienkapital finanzierten Zeitung befanden sich so einflussreiche Zeitgenossen wie der Bankier Dagobert Oppenheim, der Industriellensohn Gustav Mevissen, der Bankier Ludolf Camphausen – später Ministerpräsident der preußischen Märzregierung – und der wohlhabende Anwalt Georg Jung, der 1848 zu den Hauptrednern bei der Bestattung der Berliner Märzgefallenen gehörte. Die treibende Kraft bei der Gründung des Blatts war jedoch der in Bonn aufgewachsene Moses Hess. In jüdischen und protestantischen Familien geboren, gehörten viele Autoren und Unterstützer der Zeitung zu den Außenseitern im katholischen Rheinland. Viele von ihnen waren zudem der Anziehungskraft „junger“ oder „linker“ Lesarten der Hegel’schen Philosophie erlegen.
Die preußischen Behörden zeigten anfangs sogar eine gewisse Toleranz. Durch das Zugehen auf die Rheinische Zeitung sollte das Meinungsmonopol der ebenfalls antipreußischen, aber streng katholischen Kölner Zeitung gebrochen werden. Die Ministerialbürokratie des Königreichs handelte nach der alten Devise „Divide et impera!“ – „Teile und herrsche!“.
Spätestens in der Zeit, in der Marx für die Rheinische Zeitung zu schreiben begann, zeigte sich, dass der Junghegelianismus keine Einheit war. Oppenheim und Jung standen für seine liberale Auslegung; die Berliner Junghegelianer um Marx’ einstigen Mentor Bruno Bauer, der nach seiner Abberufung aus Bonn in die preußische Residenzstadt zurückgekehrt war, traten dagegen mittlerweile vor allem lebensreformerisch auf: Die Mitglieder des „Vereins der Freien“, wie die Hauptstädter ihren Zusammenschluss nun nannten, stellten ihre Ablehnung der Verhältnisse durch Alkoholexzesse, öffentliche Bekenntnisse zum Atheismus und andere bohemienhafte Albernheiten öffentlich zur Schau. Radikalität, ein Modewort des Vormärz, galt ihnen in anarchistischer Manier auch als Frage des Lebensstils. Wie zur Kompensation ihres Ausschlusses aus den preußischen Universitäten kombinierten sie ihr Image als Bürgerschreck zudem mit einem abgehobenen Schreibstil: Der Gestus vollständiger Ablehnung des Alten verband sich mit einer schwülstigen Angebersprache, die in Deutschland lange Zeit als Ausdruck von Intellektualität galt.
Moses Hess, der mit seinem Buch Rom und Jerusalem 20 Jahre später zu einem der Vordenker des Zionismus werden sollte,17 war in dieser Zeit dagegen bereits auf die Abschaffung des Privateigentums abonniert. Er war der wohl erste Kommunist, den Marx kennenlernte. Liberalismus, Anarchismus und Kommunismus waren seinerzeit noch nahe beieinander. Ihre Anhänger teilten die Abneigung gegen den preußischen Obrigkeitsstaat, die Kritik der Zensur und die Begeisterung für die neue Rede von der Freiheit. Im Unterschied zu den frömmelnden Pietisten um den neuen König, die die „promesse de bonheur“, wenn überhaupt, ins Jenseits verlagert wissen wollten, gehörten sie zudem gleichermaßen der Partei des irdischen Glücks an. „Wir wollen auf Erden glücklich seyn, / Und wollen nicht mehr darben“, schrieb der bald eng mit Marx befreundete Heinrich Heine, der die Entwicklung vom Liberalen zum Kommunisten selbst durchgemacht hatte, um nach eigenen Angaben gelegentlich beim Konservativismus zu landen, in seinem 1844 veröffentlichten Wintermährchen.18
Dennoch waren die affektierte Gottlosigkeit der „Freien“, ihr gespreizter Stil und ihre offen zur Schau gestellte Ablehnung gesellschaftlicher Konventionen dazu angetan, die moderateren Kräfte unter der Leserschaft und den Geldgebern der Rheinischen Zeitung zu verunsichern. Das Gleiche galt für Moses Hess’ Forderung nach der Schaffung einer Gütergemeinschaft. Die Auflagensteigerung des Blatts unter Marx’ Führung ging nicht zuletzt auf die Mischung aus Pragmatismus und eigentümlichem Rigorismus zurück, mit der er die Redaktion leitete. Der neue Chef vom Dienst scheute sich nicht, seine früheren Berliner Mitstreiter, aber auch den inoffiziellen Blattgründer Moses Hess, der ihn kurz zuvor noch überschwänglich als den vielleicht „einzigen jetzt lebenden eigentlichen Philosophen“ bezeichnet hatte,19 zu brüskieren. Marx verbannte die theoretisierenden Artikel der Berliner Junghegelianer, ihren aufgeregten Atheismus wie auch die Rede vom Kommunismus aus dem Blatt. Aus dieser Zeit stammt auch seine Polemik gegen die Augsburger Allgemeine und die ungestüme Forderung, mit Kanonen auf kommunistische Umsturzversuche zu reagieren.20
Hinter diesem redaktionellen Vorgehen stand zweifellos auch die Sorge vor der Zensur, die der Rheinischen Zeitung nach der anfänglichen Toleranz der Behörden immer mehr zu schaffen machte. Marx war nicht bereit, das Verbot des Blatts ausgerechnet für die, wie er sich ausdrückte, „gedankenleere[n] Sudeleien“ der Berliner Junghegelianer zu riskieren.21 Zugleich führte er mit der neuen Redaktionslinie jedoch auch die Wendung vom Theologischen aufs Politische fort, die von den Bruno Bauer und Co. begonnen worden war. „Die wahre Theorie muss innerhalb konkreter Zustände und an bestehenden Verhältnissen klargemacht und entwickelt werden“, schrieb Marx dementsprechend schon im August 1843 an Dagobert Oppenheim.22 Ausgehend von solchen Überlegungen, gab er der Rheinischen Zeitung einen Kurs, der weitaus näher am Tagesgeschehen lag als das philosophische Bekennertum seiner einstigen Mitstreiter.
Marx’ Hoffnung, die Zensur durch Ausschluss der Berliner Junghegelianer besänftigen zu können, erwies sich dennoch als trügerisch. Fast scheint es so, als hätten die preußischen Behörden auf die neue Anbindung theoretischer Fragen an tagespolitische Ereignisse noch gereizter reagiert als auf die bald berechenbaren Provokationen der „Freien“. Marx’ genau recherchierte Artikel über die Not der Moselwinzer sorgten bei den zuständigen Stellen ebenso für Empörung wie die Veröffentlichung eines geheimen Entwurfs für ein neues preußisches Ehescheidungsgesetz.23 Mit dieser frühen Form des investigativen Journalismus stellte die Rheinische Zeitung einen der ersten Versuche Friedrich Wilhelms IV., das Recht zu „christianisieren“, als laienpredigerhafte Scharlatanerie bloß. Von theologischen Fragen, so viel dürfte den Lesern nach der Lektüre des Artikels klar gewesen sein, hatte der fromme Herrscher keine Ahnung.
Als sich schließlich auch noch der russische Zar Nikolaus I. in Berlin über das Blatt beschwerte, weil gegen ihn gerichtete Artikel erschienen waren, hatte die preußische Regierung genug: Im Januar 1843 wurde bekannt gegeben, dass die Rheinische Zeitung ihr Erscheinen Anfang April einzustellen habe. Die Anteilseigner entließen daraufhin den umstrittenen Journalisten Karl Marx, setzten eine Petition auf, die von etwa 1000 Kölner Bürgern unterzeichnet wurde, und adressierten eine Bittschrift an Friedrich Wilhelm IV. Doch weder diese Versuche, das Blatt durch Unterwürfigkeit zu retten, noch eine direkte Vorsprache beim Monarchen konnten das Verbot rückgängig machen. Im März 1843 erschien die letzte Ausgabe der Rheinischen Zeitung.
Damit stand Marx nach dem halben Jahr, in dem er das Blatt zu einer der bekanntesten Zeitungen Deutschlands gemacht hatte, erneut ohne festes Einkommen da. Die Bildungspolitik Friedrich Wilhelms IV. hatte seine akademische Laufbahn schon vor ihrem Beginn beendet; die Karriere als politischer Journalist war den preußischen Zensurbehörden zum Opfer gefallen. Da er seine Überzeugungen nicht verraten wollte, blieben ihm nur wenige Zukunftsoptionen. Die Berufschancen eines promovierten Philosophen waren schon im 19. Jahrhundert nicht besonders aussichtsreich – insbesondere dann, wenn er sich neben dem Weg in den akademischen Betrieb auch noch den in den Journalismus verbaut hatte. Anders als Ludwig Feuerbach, der die Mitbesitzerin einer Porzellanmanufaktur geheiratet hatte, konnte sich Marx auch nicht als Privatgelehrter zurückziehen: Seine Eltern waren nicht sehr wohlhabend; die Familie seiner Jugendliebe Jenny von Westphalen, mit der er sich im Sommer 1836 verlobt hatte, besaß nur wenig mehr als den Adelstitel. Dem Fabrikantensohn Friedrich Engels, der ihn von seinem 32. Lebensjahr an alimentieren sollte, war Marx dagegen erst einmal kurz in den Redaktionsräumen der Rheinischen Zeitung begegnet. Das Treffen war für beide Seiten unerfreulich verlaufen: Engels, den Marx erst in Paris näher kennenlernte, gehörte noch dem Berliner „Verein der Freien“ an, dessen Mitglieder der Redakteur gerade aus dem Blatt zu drängen versuchte.
Vor diesem Hintergrund war es allenfalls Galgenhumor, als Marx im Januar 1843 in einem Brief scherzte, dass ihn die Regierung „wieder in Freiheit“ gesetzt habe.24 Weder in beruflicher noch in intellektueller Hinsicht gab es in Preußen eine Zukunft für ihn. In Deutschland, so schrieb Marx dementsprechend, könne er „nichts mehr beginnen“: „Man verfälscht sich hier selbst.“25 Die Entscheidung für die Emigration war gefallen.
„Jan Gerber richtet den Fokus auf Paris und erklärt die Entstehungsgeschichte von Begriffen wie Kommunismus und Entfremdung in Marx’ Werk auf plausible und nachvollziehbare Weise (…) es geht darum zu verstehen, wie aus dem Ideengemisch der Zeit die Theorie entstehen konnte, die die Welt veränderte. In dem beneidenswert gut geschriebenen Buch erfährt man darüber auf 200 Seiten mehr als aus vielen anderen Werken.“
„So viele Marx-Bücher wie heuer werden nie wieder erscheinen. Jan Gerber hat im Jubiläumsjahr eines der schönsten geschrieben und sich den jungen Marx vorgeknöpft: Den Philosophen Marx, der sich im aufrührerischen Paris radikalisiert und die Entfremdung populär macht, bevor er sich der Kritik der politischen Ökonomie widmen wird.“
„War Paris tatsächlich eine der entscheidenden Lebensstationen für Karl Marx? Dieser Frage geht der Politikwissenschaftler und Historiker Jan Gerber in seiner fundierten, das Zeitkolorit widerspiegelnden und glänzend geschriebenen Studie nach.“
„Jan Gerbers Biographie ist keine Schönmalerei des Lebens und Schaffens des Philosophen und Ökonomen. Auch umstrittene Kapitel aus Marx’ Geschichte wie etwa seinen Artikel zur Judenfrage, für den Marx – trotz seines jüdischen Vaters – Antisemitismus vorgeworfen wird, thematisiert der Autor. Gerber feiert also nicht unreflektiert den 200. Geburtstag von Karl Marx, sondern beleuchtet sein Leben und Werk kritisch. Damit bringt er eine Biographie auf den Büchermarkt, die sich sowohl für Marx-Kenner als auch für Leser ohne Vorwissen eignet.“
„In Jan Gerbers vorzüglichem Essay ›Karl Marx in Paris‹ wird der frühe Marx und vor allem der erste Paris-Aufenthalt von Oktober 1843 bis Februar 1845 untersucht.“

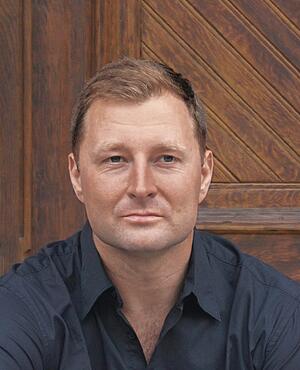
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.