
Kein Pausenbrot, keine Kindheit, keine Chance - eBook-Ausgabe
Wie sich Armut in Deutschland anfühlt und was sich ändern muss
Kein Pausenbrot, keine Kindheit, keine Chance — Inhalt
„Thiel punktet nicht nur durch seine berührende Geschichte, sondern durch Wissen, bedachte Aussagen und gute Argumente.“ - Die Welt
Als Jeremias Thiel elf Jahre alt ist, macht er sich auf den Weg zum Jugendamt. Er hält es zu Hause nicht mehr aus, hat Angst, der Armut und Verwahrlosung, die dort herrschen, niemals entkommen zu können. Seine Eltern sind psychisch krank und leben von Hartz IV, die häusliche Situation ist mehr als schwierig. Von da an lebt er im SOS-Jugendhaus, bis er als Stipendiat auf ein internationales College geht und im Herbst 2019 sein Studium in den USA beginnt. Er ist sich sicher, dass viele, die in ähnlichen Verhältnissen leben, nicht die Möglichkeit haben, sich daraus zu befreien. In diesem Buch erzählt Jeremias seine Geschichte und liefert zugleich einen bewegenden und aufrüttelnden Appell für mehr soziale Gerechtigkeit.
Leseprobe zu „Kein Pausenbrot, keine Kindheit, keine Chance“
Prolog: Der Verrat
Der letzte Abend, den ich in meiner Familie verbracht habe, war der 10. September 2012. Nein, eigentlich stimmt das nicht. Ich habe ihn nicht mit meiner ganzen Familie verbracht, sondern mit meinem Zwillingsbruder Niklas und meinem Halbbruder Stephan, der eigentlich bei einer Pflegefamilie in Polen lebte und uns zu dieser Zeit besuchte. Bis dahin hatte ich ihn noch gar nicht gekannt, aber in den Monaten, als er bei uns war, haben wir viel miteinander unternommen. Ab und zu sind wir mit dem Sozialausweis unserer Eltern ins Freibad [...]
Prolog: Der Verrat
Der letzte Abend, den ich in meiner Familie verbracht habe, war der 10. September 2012. Nein, eigentlich stimmt das nicht. Ich habe ihn nicht mit meiner ganzen Familie verbracht, sondern mit meinem Zwillingsbruder Niklas und meinem Halbbruder Stephan, der eigentlich bei einer Pflegefamilie in Polen lebte und uns zu dieser Zeit besuchte. Bis dahin hatte ich ihn noch gar nicht gekannt, aber in den Monaten, als er bei uns war, haben wir viel miteinander unternommen. Ab und zu sind wir mit dem Sozialausweis unserer Eltern ins Freibad gefahren. An sehr viel mehr erinnere ich mich nicht mehr. Meine Mutter hatte meinen Halbbruder irgendwann rausgeworfen, als er zwanzig war. Sie kam überhaupt nicht mit ihm klar.
An diesem Abend im September 2012 war ich elf. Ein kleiner, schmächtiger Elfjähriger, Schüler der sechsten Klasse, Gesamtschule Bertha von Suttner, Kaiserslautern. Bis zu diesem Abend hatte ich mir alle Mühe gegeben, so etwas wie ein Familienleben aufrechtzuerhalten. Ich habe morgens alle aufgeweckt, meinen Bruder für die Schule fertig gemacht, uns Frühstück gemacht, so gut ich konnte. Nach der Schule habe ich eingekauft, Geld am Automaten geholt und ab und zu geholfen, wenn mal wieder ein Antrag ausgefüllt werden musste. Doch allmählich spürte ich, dass das so nicht weiterging. Ein elfjähriger Junge kann nicht die Verantwortung für seine Eltern übernehmen, schon gar nicht für seine ganze Familie. Und schon dreimal nicht für eine Familie wie unsere. So klar war mir das an diesem Abend allerdings nicht, es war mehr ein undeutliches Gefühl. Eine Art Panik, die in mir aufstieg. Ich wusste nicht, dass ich mir etwas Unmögliches aufgehalst hatte. Ich wusste nur, dass ich total überfordert war und nicht mehr konnte. Ich brauchte Hilfe, und zwar ganz schnell.
Unsere Familiensituation war damals mehr als schwierig. Meine Mutter leidet, so vermute ich, unter ADHS und war lange Zeit spielsüchtig. Mein Vater leidet unter einer bipolaren Störung – früher sagte man wohl manisch-depressiv dazu – und war zu dieser Zeit am tiefsten Punkt einer manischen Phase angekommen. Außerdem wohnte er damals gar nicht bei uns in der Wohnung. Meine Eltern hatten schon zwei Jahre zuvor entschieden, dass sie nicht mehr miteinander leben wollten. (Inzwischen haben sie sich wieder zusammengetan und sogar wieder geheiratet.) Daraufhin ist meine Mutter mit uns Kindern in unserer Familienwohnung geblieben, mein Vater ist ein Stockwerk tiefer gezogen. Dort lebte er mehr schlecht als recht in einer Einzimmerwohnung. Wenn seine psychischen Probleme zu groß wurden, lag er in dem abgedunkelten Zimmer im Bett, neben sich ein Rucksack voller Tabletten, hauptsächlich Psychopharmaka. Meine Tante kam ab und zu mal vorbei, um bei ihm zu putzen. Und ich besuchte ihn auch ziemlich oft. Wenn es oben zu laut und hektisch wurde oder wenn es Streit gab, zog ich eine Weile zu ihm. An diesem letzten Abend habe ich bei ihm noch ein Computerspiel gespielt: einen Bus-Simulator, mit dem ich durch New York City fuhr. Ich kann mich an vieles an diesem Abend nicht mehr gut erinnern, aber dieses Computerspiel sehe ich noch ganz genau vor mir.
Die Situation meiner Eltern war also schon ziemlich schwierig. Beide waren nicht in der Lage zu arbeiten, hatten nie wirklich gearbeitet, lebten von Hartz IV und trieben haltlos durch einen chaotischen Alltag, der keine Struktur hatte. Und dann war da noch mein Zwillingsbruder Niklas. Er lebte eigentlich auch nicht bei uns, sondern war schon seit zwei Jahren in einer Spezialeinrichtung für Kinder mit besonderem Förderungsbedarf untergebracht. Auch davor hatte er einige Tageseinrichtungen durchlaufen, weil meine Mutter nicht mit ihm zurechtkam und weil seine Schulprobleme zu groß geworden sind. Im Sommer 2012 wohnte er aber gerade bei uns, weil er einen Fahrradunfall hatte und danach viermal am Bein operiert wurde. Während die Verletzung ausheilte, war er von der Einrichtung freigestellt. Zur Schule ging er in dieser Zeit nicht.
Eine ADHS-kranke, oft aggressive und dazu spielsüchtige Mutter. Ein manisch-depressiver Vater. Und ein ADHS-kranker Bruder. Alle drei nicht in der Lage, Verantwortung für sich oder andere zu übernehmen. Alle drei total darauf angewiesen, dass sich jemand um sie kümmerte. Und dieser Jemand …
Tja, dieser Jemand war ich.
An diesem Abend im September ist meine Mutter ausgegangen und hat uns – Stephan, Niklas und mich – in der Wohnung eingeschlossen. Da wir befürchteten, sie könnte tagelang nicht wiederkommen, und wir keine Ahnung hatten, wann sie uns wieder aus der Wohnung lassen würde, war es ein ziemliches Drama. Zum Glück konnten wir aus dem Fenster nach meinem Vater rufen, der einen Schlüssel zu unserer Wohnung hatte und uns schließlich befreite. Das hatte er schon ein paarmal getan. Doch diesmal hörte er unser Rufen nicht sofort, und die Nachbarn riefen die Polizei. Die Beamten, die dann herbeigeeilt kamen, unternahmen allerdings nichts weiter, weil mein Vater ja da war und uns bereits befreit hatte.
Dieses Ereignis war wohl der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Denn an diesem Abend stand ich da und wusste auf einmal, dass ich so keinen einzigen Tag mehr weitermachen konnte und würde.
Die Angst ist einfach zu groß geworden. Nicht nur, weil ich nicht wusste, wo meine Mutter war und wann sie wiederkommen würde. Ich hatte auch furchtbare Angst, in diesem irrsinnigen Leben stecken zu bleiben. Ich wusste damals nicht, dass es dafür einen Namen gibt: Kinderarmut. Ich wusste auch nicht, dass es Statistiken und wissenschaftliche Studien darüber gibt. Ich wusste nur, dass mein Leben nicht in Ordnung war. Jeden Tag in der Schule konnte ich sehen, wie meine Mitschüler*innen lebten. Die wenigsten von ihnen kamen aus besonders wohlhabenden Familien, aber sie führten trotzdem ein normales Leben. Ein ganz normales Kinderleben, in dem ihnen die meisten Sorgen von ihren Eltern abgenommen wurden. Ganz abgesehen von alltäglichen Dingen, die für sie selbstverständlich waren: Kino, Urlaub, ordentliche Schulsachen und ein Pausenbrot, das diesen Namen verdiente.
Ich hatte kein normales Kinderleben. Ich steckte fest in meiner ziemlich kaputten Familie, und manchmal hatte ich tatsächlich das Gefühl, ich würde nach Armut riechen. In der vierten Klasse hatte ich keine Empfehlung fürs Gymnasium bekommen, obwohl meine Noten dafür gesprochen hätten. Auf dem Etikett, das man mir aufgeklebt hatte, stand: schlauer Kerl, aber arm, keine Unterstützung aus der Familie, schlechte Prognose. In der Schule glaubte man einfach nicht an mich. Nix mit Gymnasium.
Ich hatte Angst, dass die Leute, die nicht an mich geglaubt hatten, recht behalten würden. Dass ich irgendwann in dem Wahnsinn unseres Familienalltags genauso untergehen würde wie meine Eltern und mein Zwillingsbruder. Deshalb beschloss ich, etwas zu unternehmen.
Am nächsten Morgen schnappte ich mir Niklas und machte mich gemeinsam mit ihm auf den Weg zum Jugendamt in Kaiserslautern. Wir nahmen überhaupt nichts mit, weil wir nicht wirklich damit gerechnet haben, dass man dort sofort etwas unternehmen würde. Wir gingen eher davon aus, dass man unsere Bitten anhören, uns dann aber erst mal wieder nach Hause schicken würde. Schließlich – das habe ich aber erst viel später erfahren – bestand ja schon seit dem Jahr 2000 Kontakt zwischen dem Jugendamt und meiner Familie. Niklas und meine Eltern waren schon oft dort gewesen, unsere Familie war den Beamten seit vielen Jahren bekannt.
Für mich jedoch war es das erste Mal, dass ich das rosa verputzte Haus betrat. Ich hatte eine Heidenangst. Vor all den Klischees, die ich im Kopf hatte zum Thema Kinderheim. Vor prügelnden Betreuern, ungerechten Strafen, Mobbing durch andere Kinder, noch mehr Perspektivlosigkeit. Und vor allem davor, meine Familie zu verraten – ganz besonders meinen Vater. Was tat ich meinen Eltern und Niklas an, wenn ich ging? Ich fühlte mich wie ein Verräter. Und manchmal holte mich dieses Gefühl in den Jahren danach wieder ein.
Wäre ich ein paar Jahre älter gewesen, hätte ich mir vielleicht Mut angetrunken, bevor ich das Jugendamt betrat. Stattdessen haben Niklas und ich uns in einen regelrechten Zuckerrausch versetzt. Bevor wir die Wohnung verließen, haben wir auf dem Boden einen Zehneuroschein gefunden und mitgenommen. Den haben wir beim Bäcker in Donuts und Brezeln umgesetzt. Und so waren wir, als wir das Jugendamt betraten, nicht nur übernächtigt, zerzaust und schmutzig, sondern auch leicht zuckerschwindelig und hatten unglaublich klebrige Finger.
Als wir an die Zimmertür von Herrn Biller klopften, müssen wir einen vollkommen verwahrlosten Eindruck gemacht haben. Jedenfalls sahen wir wohl schlimm genug aus, dass er sofort alarmiert war. Ich bin diesem Mann bis heute sehr dankbar. Er hat sofort alle Hebel in Bewegung gesetzt, um für mich eine Unterbringung zu organisieren, auch wenn es erst mal nur ganz provisorisch war. Ich bin vorerst in die Wohngruppe meines Bruders gekommen, wo ich drei Tage lang unter Kindern und Jugendlichen lebte, die Verhaltensdefizite aufwiesen. Richtig toll war das natürlich nicht. Außerdem war diese Wohngruppe etwa 30 Kilometer von meiner Heimatstadt entfernt. Das bedeutete unweigerlich auch, dass ich ein paar Tage nicht zur Schule gehen konnte, nichts von meinen Freunden hörte und auch sonst von allem isoliert war, was sich irgendwie „normal“ anfühlte.
Nach ein paar Tagen holte mich Herr Biller vom Jugendamt in der Wohngruppe ab. Inzwischen war klar, dass ich im Jugendhaus des SOS-Kinderdorfs in Kaiserslautern leben würde. Dort verbrachte ich die nächsten fünf Jahre und durfte endlich so etwas wie Stabilität und Kindsein erleben. Mir fiel ein riesengroßer Stein vom Herzen.
Ich werde nie den Moment vergessen, als ich mein neues Zuhause betrat, das bis heute immer noch mein gefühltes Zuhause ist: das Jugendhaus des SOS-Kinderdorfs. Ich stand vor der großen Runde der Betreuer*innen, war vollkommen überfordert von all den Blicken und fremden Gesichtern und brach ganz einfach in Tränen aus. Carina, die Betreuerin einer anderen Gruppe, kam zu mir und nahm mich in den Arm. Auf einmal hatte ich das Gefühl von Geborgenheit, Zuneigung und … irgendwie auch Sicherheit. Ein gutes Gefühl, das ganz fest in meine Erinnerung eingeprägt ist.
Was genau im Jugendamt passierte, ist dagegen aus meinem Gedächtnis wie ausradiert. Ich erinnere mich nur noch an meine weichen Knie, an den Mann, der uns die Tür öffnete, und dass ich gesagt habe: „Ich möchte weg von zu Hause, weg von meinen Eltern.“ Wahrscheinlich sind mir auch dort vor lauter Erschöpfung und Erleichterung die Tränen gekommen – ich weiß es nicht mehr. Dieser Moment war der absolute Tiefpunkt in meinem Leben. Und gleichzeitig der absolute Höhepunkt. Danach wurde alles anders.
Mein zweigeteiltes Leben
Mein Leben, das ja noch gar nicht so lange dauert, zerfällt also in zwei Teile: die Zeit vor dem Verlassen meiner Familie und die Zeit danach.
Ich bin im Mai 2001 geboren. In den ersten elf Jahren habe ich Armut hautnah erlebt. Mit aller Überforderung, die das für ein Kind bedeutet. Mit aller Angst, mit aller Schwächung meines Selbstbewusstseins, mit aller Trostlosigkeit und einem Gefühl tiefer Resignation und Hoffnungslosigkeit. Ich hatte nicht den Hauch einer Ahnung, wie sich jemals irgendetwas an meinem Leben zum Guten wenden sollte. Ich habe viel zu früh viel zu viel Verantwortung übernehmen müssen, habe ein Stück weit meine Familie „gemanagt“, obwohl ich selbst gerade erst Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt hatte. Und vor allem – und das war für mich das Schlimmste – war ich gezwungen, ein Leben zu führen, dem jedes noch so kleine Stückchen Struktur und Ordnung fehlte.
Das war die erste Hälfte.
Von dem Moment an, als ich – nach der kurzen, sehr schwierigen Übergangszeit in der Wohngruppe meines Bruders – im SOS-Kinderdorf in Kaiserslautern angekommen war, verwandelte sich mein Leben von Grund auf. Zum ersten Mal erlebte ich verlässliche Fürsorge durch Erwachsene, so etwas wie ein strukturiertes Leben … und Ruhe. Dass mir das unendlich gutgetan hat, liegt auf der Hand. Nur auf diese Weise konnte ich erreichen, was ich bisher geschafft habe: einen guten Schulabschluss und die Chance auf ein Universitätsstudium.
Ich bin dankbar für beide Erfahrungen. Denn heute bin ich genau dadurch in der Lage, Dinge in unserer Gesellschaft zu sehen, die vielen anderen verborgen bleiben. Ich kenne das Leben in Armut ebenso wie den relativen Luxus in einer wohlhabenden Umgebung. Ich habe die Zustände in der Jugendhilfe ebenso erlebt wie die Ausbildung an einer fantastischen Privatschule. Und ich kenne das Leben in einer „bildungsfernen“ Familie ebenso wie den Bildungshunger und das selbstbestimmte Lernen auf einen internationalen Schulabschluss hin – und inzwischen darüber hinaus.
Ich bin, ohne mir das ausgesucht zu haben, ein Wanderer zwischen den Welten geworden. Das ist fast immer spannend, oft mühsam und auf jeden Fall – so sehe ich das – mit der großen Aufgabe verbunden, zwischen diesen Welten zu vermitteln. Zwischen Welten, die viel zu wenig voneinander wissen und viel zu wenig miteinander reden. Es wird Zeit, dass hier Brücken gebaut werden, die ein gegenseitiges Verständnis möglich machen. Auch das ist eine Motivation für mich gewesen, dieses Buch zu schreiben.
DAVOR
Auf dem Kotten
Ich bin in Kaiserslautern geboren und aufgewachsen. Bekannt ist diese Stadt vielen Menschen vor allem wegen ihres traditionsreichen Fußballklubs, des FC Kaiserslautern mit seinem Stadion auf dem Betzenberg. Man nennt die Spieler auch die „Roten Teufel“, und der Fußballspieler Fritz Walter gilt wohl seit den Fünfzigerjahren als größter Sohn der Stadt. Ich bin zwar kein großer Fußballfan, aber natürlich bin ich als Kind ab und zu auf dem „Betze“ gewesen. In der Schule gab es manchmal Freikarten, das war dann immer ein Großereignis der besonderen Art.
Ansonsten ist „Lautre“, wie die Einheimischen sagen, eine sehr normale deutsche Industriestadt mit etwa hunderttausend Einwohnern, einigen wichtigen Baudenkmälern (Wahrzeichen der Stadt ist die katholische Marienkirche, in der ich getauft wurde und zur Erstkommunion ging) und einem großen amerikanischen Militärstützpunkt. Die Kaiserslautern Military Community umfasst immerhin etwa fünfzigtausend Menschen. Sie ist der größte amerikanische Militärstützpunkt außerhalb der USA. Die Ramstein Airbase liegt ganz in der Nähe der Stadt und ist ebenfalls ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.
Das Stadtviertel, in dem ich meine Kindheit verbracht habe, trägt den Namen Kotten. Auf gut Pfälzisch: „ufm Kotte“. Benannt ist dieses Viertel nach dem Kottenfeld, das seinerseits nach dem „Koden“ benannt ist. Im Mittelalter war ein Koden das Krankenhaus für die Leprakranken. Das Kottenfeld lag also außerhalb der eigentlichen Stadt.
Der heutige Kotten hat eine ganz interessante Geschichte, weil er ein systematisch geplantes Arbeiterwohnviertel war. In diesem Teil der Stadt gab es eine große Kammgarnspinnerei, die sehr viele Menschen beschäftigte. Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts wurde dann eine Arbeitersiedlung ganz in der Nähe der Spinnerei erbaut, wie man das früher in Industriestädten eben machte: Fabrik und Wohnviertel bildeten eine Einheit, Wohnen und Arbeiten gehörten eng zusammen. Zu dieser Zeit waren solche Arbeitersiedlungen auch Orte eines engen sozialen Zusammenhalts. Man kannte sich, die Lebenswelten ähnelten einander, auch die Abhängigkeiten. Schließlich lebten ja alle von dem Lohn, den der eine große Arbeitgeber zahlte. Und die Kinder gingen, wenn sie die Volksschule hinter sich hatten, mit wenigen Ausnahmen „in die Fabrik“.
Den Grundriss des ursprünglichen Arbeiterviertels sieht man noch heute, obwohl es im September 1944 durch einen großen alliierten Bombenangriff komplett zerstört wurde. Nach Kriegsende wurde es aber nach den alten Plänen wiederaufgebaut. Der Grundriss ist also geblieben, aber das Miteinander ist mit dem Verlust der alten Industrien verschwunden. Die Sache mit dem engen sozialen Zusammenhalt hat sich leider geändert.
Heute ist der Kotten auch kein reines Arbeiterviertel mehr, sondern ein sozial stark gemischtes Viertel. Oder besser gesagt: ein sozial geteiltes Viertel, denn eine wirkliche Durchmischung findet dort nicht statt. Selbst auf einem Stadtplan oder auf Google Maps kann man die Unterschiede deutlich sehen. Im östlichen Teil, wo die Straßen breiter und die Grundstücke großzügiger sind, lebt gediegener Mittelstand. Im westlichen Teil mit seiner engen Bebauung – früher sagte man wohl „Mietskasernen“ dazu – gibt es bis heute zum Teil bittere Armut. Und man spürt in vielen Ecken Resignation, nicht nur bei den Menschen, sondern auch im Stadtbild. Es wirkt alles ein bisschen verwahrlost. Hier leben die armen Familien. Die „Hartzer“ halt …
Ja, so werden sie genannt. Keine sehr freundliche Bezeichnung, aber immer noch besser als die Bezeichnung „Asoziale“, die in den Siebzigerjahren wohl üblich war. Dass man so über sie spricht, zeigt schon: Auf dem Kotten lebt man nicht miteinander, sondern nebeneinander. Man kann leider wirklich nicht behaupten, dass er ein Beispiel für gelungene soziale Durchmischung wäre, obwohl es durchaus Ansätze gibt, das zu ändern, beispielsweise vonseiten der Schule.
Am ehesten fand soziale Durchmischung noch in der Grundschule statt, die ja praktisch alle Kinder aus dem Stadtviertel besuchten. Die Schule ist ein roter Backsteinbau mit Sandsteingiebeln: drei Stockwerke mit hohen Räumen und großen Fenstern, einige sparsame Verzierungen an der Fassade, hohe Bäume rundherum, ein einfacher Zaun, ein paar Klettergeräte auf dem Pausenhof. Eine Grundschule mit Wurzeln im 19. Jahrhundert, wie es sie in Deutschland zu Tausenden gibt. „Volksschule“ steht im Sandstein über den Eingängen. Bezeichnenderweise steht diese Schule genau auf der Grenze zwischen dem „besseren“ und dem „schlechten“ Teil des Viertels.
Heute gibt es in der Schule ein Angebot mit Ganztagesbetreuung bis 16 Uhr, für die ca. zweihundertfünfzig Schüler*innen sind etwa sechzig Mitarbeiter*innen zuständig. Seit 2009 gibt es zwei Sozialarbeiter*innen der SOS-Kinder-und-Jugendhilfe und zwei FSJler sowie zahlreiche Helfer*innen für die Nachmittagsbetreuung. Wenn man sich die Website der Schule ansieht, spürt man, wie viel Mühe sich die Leitung und alle Beteiligten mit den Kindern geben. Offener Anfang (das heißt, die Kinder können schon vor Unterrichtsbeginn kommen und in ihrer Klasse sein, zum Beispiel um zu frühstücken), Betreuung über die Unterrichtszeit hinaus und vieles mehr (nicht zuletzt Schulhund Jessy, man darf nicht unterschätzen, was ein solcher Besuchshund bei Kindern bewirken kann!) … ganz deutlich erkennt man das Bemühen, die Kottenschule zu einem Ort des gemeinsamen Lebens zu machen und alle Kinder „mitzunehmen“.
Doch wenn ich an meine Zeit auf dem Kotten zurückdenke, auf dem ich gelebt habe, bis ich elf Jahre alt war, dann ist diese Schule im Grunde genommen der einzige Ort, an dem ein solches gemeinsames Leben stattfand. Schon auf den Spielplätzen war die Gemeinsamkeit zu Ende, denn es gab zwei in diesem Viertel: einen für die Kinder aus dem „besseren“ Teil, den Sedan-Spielplatz an der Schützenstraße, und einen für die Kinder aus dem „schlechten“ Teil – für uns: den Kotten-Spielplatz. Er verdiente den Namen kaum, war eher ein Treffpunkt für die Jugendlichen, die ansonsten nicht wussten, wohin. Symbol dafür waren die Glasscherben, denn dort wurde ständig Bier getrunken.
Nicht, dass es irgendein ausgesprochenes Verbot gegeben hätte, den jeweils anderen Spielplatz zu betreten oder zu benutzen. Aber es gab eine Art magischer Trennwand zwischen den Lebenswelten, die auch die Spielbereiche der Kinder voneinander trennte.
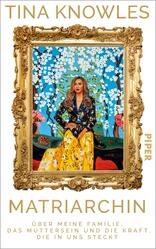



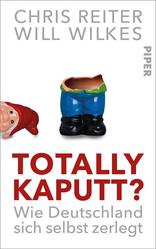




DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.