
Keine Angst! - eBook-Ausgabe
Was wir gegen Depressionen und Ängste tun können. Eine Klinikleiterin erzählt
Keine Angst! — Inhalt
„Ein engagiertes Plädoyer für einen neuen, offeneren Umgang mit psychischen Erkrankungen und eine Einladung zur Achtsamkeit.“ Dr. Eckart von Hirschhausen, Arzt, Bestsellerautor und Gründer der Stiftung „HUMOR HILFT HEILEN“, die seelische Gesundheit in Ausbildung und Behandlung fördert.
Ein Montagmorgen in Weißensee. Der Alltag im Alexianer St. Joseph-Krankenhaus erwacht. Menschen mit ganz verschiedenen psychischen Erkrankungen finden hier Schutz, Hilfe, Therapie. Es stimmt: Depressionen und Angststörungen sind längst zu Volkskrankheiten geworden. Dennoch wollen wir von den Erkrankungen der Seele oft nichts wissen – manchmal nicht einmal von unserer eigenen Furcht und Traurigkeit. Psychisch krank, das ist der Attentäter, der Amokläufer oder der Mörder, dessen Taten wir im Sonntagskrimi mit lustvollem Schauder verfolgen. Und doch sind der Druck und die Angst, die in einer immer unübersichtlicheren Welt auf uns lasten, manchmal mehr, als wir bewältigen können. Iris Hauth erzählt aus ihrer langjährigen Erfahrung als Klinikleiterin und im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie und öffnet die für gewöhnlich verschlossene Welt eines psychiatrischen Krankenhauses. Ein persönliches, Mut machendes Buch, das zeigt, wie wir trotz dunkler Stunden Zuversicht finden.
Leseprobe zu „Keine Angst!“
Vorwort
„Es ist nicht möglich, etwas von dem klarzumachen, woran man krankt, es hängt aber vor allem damit zusammen, dass rundherum alle Leute keine Ahnung von einer derartigen Krankheit haben“, schrieb die Schriftstellerin Ingeborg Bachmann Mitte der 1960er-Jahre. Für sie war es eine Zeit der Depression und der Angst. Über fünfzig Jahre sind seither vergangen. Fiele Bachmanns Befund heute anders aus? Das ist nicht gesagt. Obwohl die Weltgesundheitsorganisation (WHO) davon ausgeht, dass schon im Jahr 2030 die Depression unter allen Volkskrankheiten den [...]
Vorwort
„Es ist nicht möglich, etwas von dem klarzumachen, woran man krankt, es hängt aber vor allem damit zusammen, dass rundherum alle Leute keine Ahnung von einer derartigen Krankheit haben“, schrieb die Schriftstellerin Ingeborg Bachmann Mitte der 1960er-Jahre. Für sie war es eine Zeit der Depression und der Angst. Über fünfzig Jahre sind seither vergangen. Fiele Bachmanns Befund heute anders aus? Das ist nicht gesagt. Obwohl die Weltgesundheitsorganisation (WHO) davon ausgeht, dass schon im Jahr 2030 die Depression unter allen Volkskrankheiten den ersten Rang einnehmen wird, gibt es noch immer eine Scheu, über diese oder andere psychische Erkrankungen zu sprechen. Oft resultiert das Schweigen aus einem Mangel an Wissen. Doch nur ein offener, informierter Umgang mit psychischen Erkrankungen kann die Stigmatisierung Betroffener verhindern, die leider noch viel zu oft an der Tagesordnung ist.
Als Leiterin der größten psychiatrischen Klinik in Berlin habe ich täglich mit Menschen zu tun, die in einer psychischen Krise den Mut aufgebracht haben zu sagen: Ich brauche Hilfe. Und diese Hilfe gibt es. Anhand der beiden häufigsten psychischen Erkrankungen in Deutschland, der Depression und der Angststörung, möchte ich mit diesem Buch gesicherte Informationen über ihre Entstehung, ihren Verlauf und, vor allem, über ihre wirksame Behandlung geben. Leiten lasse ich mich dabei von den Fragen, die mir Patienten und Angehörige in den dreißig Jahren, in denen ich schon als Psychiaterin tätig bin, immer wieder gestellt haben.
Gleichzeitig möchte ich versuchen, einige Einblicke in den Alltag einer psychiatrischen Klinik zu geben. Ein Ort, an den viele Menschen mit Argwohn oder Angst denken. Ihn erzählend ein wenig zugänglicher zu machen – etwa durch die genaue Schilderung des Lebens und der Abläufe auf Station – kann, so meine Hoffnung, vielleicht ein wenig dazu beitragen, Vorurteile zu korrigieren oder sogar ganz aus der Welt zu schaffen. Sodass die Menschen etwas weniger Scheu haben, sich in einer Klinik helfen zu lassen, wenn es ihnen schlechtgeht.
Im Gegensatzzu allen anderen medizinischen Disziplinen befindet sich die Psychiatrie stets in engem Austausch mit aktuellen gesellschaftlichen oder politischen Entwicklungen. Als ehemalige Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) konnte ich einige von ihnen im Austausch mit Politikern und Kollegen aus aller Welt diskutieren: Welche Auswirkungen haben die sich rapide verändernden Lebens- und Arbeitsgewohnheiten auf die seelische Gesundheit? Nehmen psychische Störungen in unserer immer unübersichtlicheren Welt zu? Wie lässt sich bei insgesamt steigendem Hilfebedarf weiterhin eine gute Versorgung gewährleisten? Hier warten auf das Fach in den nächsten Jahren spannende Aufgaben und große Herausforderungen.
Im Mittelpunkt steht jedoch immer der einzelne Mensch. Sein Leben, seine Geschichte, seine Gesundheit. Es gehört zu den schönsten Momenten unseres Berufs, eine tragfähige Beziehung zum Patienten aufzubauen und einander auf Augenhöhe im Gespräch zu begegnen. Die Patientengeschichten in diesem Buch sollen von solchen immer neu und überraschend verlaufenden Begegnungen erzählen.
Körperliche Fitness ist wichtig, die Erhaltung der seelischen Ausgeglichenheit und Gesundheit aber ist es nicht minder. Es gibt Frühwarnsymptome, die auf eine mögliche psychische Störung hindeuten können. Wer weiß, wie er sich vor zu großen Belastungen schützen kann, läuft weniger Gefahr zu erkranken. Mit einigen praktischen Tipps am Ende des Buchs möchte ich jeden Leser dazu ermutigen, etwas für seine psychische Widerstandskraft zu tun und dadurch in einer Balance zu bleiben, die ihn mit Zuversicht und ohne Angst durch den Alltag gehen lässt.
Iris Hauth, im Januar 2018
Kapitel 1
Man muss die Menschen lieben, sonst kann man nicht Psychiaterin sein
Der Wunsch zu helfen
Ich war sechs Jahre alt, als meine Mutter ihren ersten Asthma-Anfall erlitt. So ein Anfall kann eine ziemlich bedrohliche Angelegenheit sein, nicht nur für ein Kind, das ihn miterlebt. Die Betroffenen können nur noch mit Mühe Luft holen, aber noch viel schwerer fällt es ihnen, wieder auszuatmen. Ein Gefühl der Enge ergreift von ihnen Besitz, sie haben Angst zu ersticken und werden von Husten geschüttelt. Die Anfälle meiner Mutter steigerten sich mit den Jahren. Mein Vater war von der Situation überfordert und flüchtete aus dem Haus, wenn es wieder einmal so weit war. Ich aber blieb.
Mitte der 1960er-Jahre gab es noch keine speziellen Medikamente, die Asthma-Kranken im Notfall rasch und wirkungsvoll helfen konnten. Wenn mich meine Mutter bat, ihr etwas zum Einnehmen zu bringen, ging ich an den Schrank und holte, weil ich nichts anderes fand, Togal, obwohl das völlig wirkungslos war. Aber darauf kam es nicht an. Ich kochte ihr einen Kaffee und setzte mich zu ihr, auch wenn mich das Pfeifen ihrer Atmung und der Anblick ihres verkrampften Körpers noch so erschreckten. Ich blieb bei ihr und hielt alles aus. Und nach einer Weile wurde es tatsächlich besser. Meine Mutter erholte sich und bekam wieder normal Luft.
In diesen Stunden erlebte ich zum ersten Mal das, was Psychologen „Selbstwirksamkeit“ nennen, also die auf Erfahrung fußende Gewissheit, auch schwierige Situationen durch Eigeninitiative in den Griff zu bekommen. Im Gegensatz zu meinem Vater war ich nicht davongelaufen, sondern hatte helfen können. Mein Dableiben, mein Aushalten und mein beruhigendes Reden hatten dazu beigetragen, die Not meiner Mutter zu lindern.
Heute bin ich überzeugt davon, dass diese frühen Erlebnisse meinen späteren Berufsweg vorgezeichnet haben. Sie weckten in mir den Wunsch, anderen Menschen zu helfen und sie nach Möglichkeit zu heilen. Kurz erwog ich, Psychologie zu studieren, doch dann entschloss ich mich dazu, Ärztin zu werden. Ich wollte mich mit beidem auskennen, dem Körper und der Psyche.
Während des Medizinstudiums bin ich hier und da ein wenig vom angestammten Weg abgekommen. Ich sah mich auch in anderen Fachrichtungen um. Die Gynäkologie interessierte mich. Babys auf die Welt zu helfen stellte ich mir sehr schön vor. Auch als Hausärztin zu arbeiten und so die Menschen in ihrem Alltag begleiten zu können, reizte mich, und ich absolvierte ein entsprechendes Praktikum. Aber als es am Ende des Studiums darum ging, neben den obligatorischen Fächern Innere Medizin und Chirurgie ein drittes zu wählen, entschied ich mich für die Psychiatrie. Der Kreis hatte sich geschlossen.
Mein Werdegang
Ich hatte Glück und fand nach dem Studium sofort eine Stelle, was zu Beginn der 1980er-Jahre gar nicht so einfach war. Ich landete in der Psychosomatik. Damals hielt ich das einfach für eine Laune des Schicksals, mittlerweile bin ich mir da nicht mehr so sicher. Angesichts der Erfahrungen mit meiner kranken Mutter erscheint es mir nun nicht ganz zufällig, dass ich mich intensiv mit der Wechselwirkung von körperlicher und psychischer Erkrankung beschäftigte. Oder genauer: mit Beschwerden des Körpers, die auch einen psychischen Hintergrund haben.
Auf der Station, auf der ich arbeitete, befanden sich vor allem Patienten mit Essstörungen. Meist waren es junge Frauen. Manche von ihnen wogen nicht einmal vierzig Kilo, die am schwersten Erkrankten waren zwischenzeitlich sogar dem Tode nahe. Mit diesen Frauen begann ich psychotherapeutisch zu arbeiten. Von Beginn an hielt ich die Psychotherapie für existenziell wichtig, auch als sie noch gar nicht in die Psychiatrie integriert war. Nur Medikamente zu geben konnte ich mir nicht vorstellen. Ich wollte immer auch in Beziehung gehen mit den Patienten, mit ihnen reden und ihnen auf Augenhöhe begegnen, um gemeinsam mit ihnen einen Weg heraus aus ihrem Leid zu finden.
Zu dieser Zeit gab es den Titel des Facharztes für Psychosomatik und Psychotherapie noch nicht, es gab nur den Facharzt für Psychiatrie oder Nervenheilkunde. Er beinhaltete auch die Ausbildung in Neurologie, für die ich sehr dankbar bin. Ich lernte das menschliche Nervensystem systematisch von der körperlichen, der somatischen Seite aus kennen. Die Patienten kamen, ich untersuchte sie, klopfte sie mit dem Reflexhammer ab, und je nachdem, welche Beschwerden von ihnen angegeben wurden, konnte ich diese systematisch einzelnen Nerven oder aber den Folgen eines Bandscheibenvorfalls zuordnen. Auch die Symptome für eine Parkinson-Erkrankung oder für Multiple Sklerose ließen sich mühelos erkennen. Alles war so klar. Um eine Entzündungserkrankung auszuschließen, führte man eine Liquorpunktion durch, also die Entnahme von Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit. Und wenn man sich das Gehirn anschauen wollte, half einem die Computertomographie dabei, sich ein genaueres Bild zu machen. Weil ich in einer kleinen Klinik untergekommen war, konnte ich den ganzen Prozess begleiten, von der körperlichen Untersuchung bis zur Bildgebung. Heute, da die einzelnen Abteilungen im Krankenhaus unabhängig voneinander arbeiten, wäre das nicht mehr möglich.
Der Beruf des Psychiaters hat für mich stets diesen Reiz der Vielfalt behalten. Neben dem des Allgemeinmediziners fällt mir keine andere ärztliche Tätigkeit mit einem ähnlich großen Tätigkeitsfeld ein. Und im Gegensatz zu den Psychologen sind Psychiater eben Ärzte. Sie können körperliche Erkrankungen diagnostizieren und behandeln sowie aufgrund ihrer Ausbildung auch Medikamente verschreiben, ohne dass sie auf die andere Säule des Heilens, das Sprechen, verzichten müssen. Bei allem Medizinischen tragen wir sozusagen den weißen Kittel, doch in der Psychotherapie ziehen wir ihn aus und begeben uns immer aufs Neue in eine Interaktion von Mensch zu Mensch, in der man mit seinen Kenntnissen und Erfahrungen, aber auch mit der eigenen Person, mit dem, was man selbst an Menschlichkeit einbringt, etwas bewegen und bewirken kann.
Das Dilemma der Psychiatrie
Ein Psychiater-Kollege hat mir einmal von einer Patientin erzählt, die nach mehreren Wochen intensiver, nicht zuletzt psychotherapeutischer Behandlung voller Ungeduld ausgerufen hat: „So, jetzt möchte ich aber endlich mal mit einem Psychologen sprechen!“ Eine Geschichte zum Schmunzeln, die aber das unterschiedliche Image beider Berufe verdeutlicht. Psychiater, heißt es oft, sperren die Leute weg oder verabreichen zumindest Medikamente, die abhängig machen, ruhig stellen und/oder die Persönlichkeit verändern; wohingegen Psychologen sich ganz dem Gespräch mit dem Patienten verschreiben. Und Gespräche genießen nun mal einen höheren Stellenwert als Tabletten.
Daher bin ich nicht unglücklich, wenn ich in Interviews gelegentlich auch zu leichteren Themen befragt werde, etwa wie man seinen Urlaub sinnvoll gestalten kann, was Liebeskummer im Körper so alles anzurichten vermag oder wie man ein Weihnachtsfest übersteht, wenn man ganz alleine ist. Eher banale Dinge, gewiss, und man könnte meinen, eine Psychiaterin solle sich mit derlei nicht abgeben. Doch es ist gut und wichtig, dass wir auch zu solchen Themen des Alltags Stellung beziehen. Das gibt uns die Möglichkeit, die Psychiatrie ein wenig aus der Schmuddelecke herauszuholen, in der sie für viele immer noch steckt.
Die Psychiatrie ist nicht nur Diagnostik und Therapie einer individuellen psychischen Erkrankung. Sie hat das Ganze im Blick, denn psychische Erkrankungen entstehen immer auch in einem psychosozialen Kontext. Damit verweisen sie auf die Lebensumstände eines Menschen und auf die sie beeinflussenden gesellschaftlichen Strömungen – seien es die Alltagsbedingungen in der Großstadt, seien es die Auswirkungen der Digitalisierung auf Arbeitswelt und Freizeit, die Folgen des demografischen Wandels oder die Herausforderungen durch die Zuwanderung.
Kaum ein anderes medizinisches Fach befasst sich ähnlich intensiv mit gesellschaftlichen Fragestellungen. Und gar keines ist wie die Psychiatrie zusätzlich mit ordnungspolitischen Aufgaben betraut. Denn das ist ja der Spagat, den unser Fach hinbekommen muss und der wohl auch verantwortlich ist für das schlechte Image, das es für viele besitzt. Wir sollen und wollen dem Einzelnen helfen, anderseits sollen wir aber auch Gefahren für die Öffentlichkeit abwenden, was mit hohen gesellschaftlichen Erwartungen verknüpft ist.
In dieses Dilemma geraten wir immer dann, wenn Patienten aufgrund einer schweren Erkrankung ihre Umwelt verkennen, sich verfolgt oder bedroht fühlen und aus Angst angespannt, bisweilen auch aggressiv auf ihre Mitmenschen reagieren. In so einer akuten Krankheitsphase sind diese Patienten nicht mehr selbstbestimmt. Wir haben dann die gesetzliche Verpflichtung, sie in unseren Kliniken unterbringen zu lassen. Dieses doppelte Anforderungsprofil bringt eine besondere Verantwortung mit sich. Kein anderer Arzt muss sich mit Fragen der Unterbringung oder der Behandlung gegen den erklärten Willen eines Patienten auseinandersetzen.
Daher werden uns auch Fragen der Ethik immer beschäftigen. Knapp zehn Prozent aller Patienten kommen nicht freiwillig in den stationären Bereich, sondern werden gegen ihren Willen in die Klinik gebracht, weil sie sich selbst oder andere gefährden. Ihre Behandlung führt zu einem oft schwierigen Abwägen zwischen der Autonomie des Erkrankten und der Aufgabe der Psychiatrie, Sorge für den Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit zu tragen.
Aspekte der seelischen Gesundheit, der Prävention oder des Heilens geraten oft an den Rand angesichts dieser von der Öffentlichkeit und den Medien mit großem Interesse wahrgenommenen Aufgaben. Insbesondere die Forensische Psychiatrie gerät dabei immer wieder in den Fokus. Sie befasst sich mit der Schuldfähigkeit von Straftätern, die ihre Tat als Folge einer psychischen Erkrankung begangen haben. Die von den Psychiatern erstellten Gutachten bilden die Grundlage für die Entscheidung der Gerichte, ob jemand ins Gefängnis kommt oder, wegen mangelnder Schuldfähigkeit, in eine forensische Klinik, also in den Maßregelvollzug. Jede Fehleinschätzung kann fatale Folgen haben, etwa die erneute Tat eines Patienten, der mit irrtümlich günstiger Prognose aus dem Maßregelvollzug entlassen wurde.
Einen eigentümlichen Platz in der öffentlichen Aufmerksamkeit nimmt auch die psychiatrische Klinik ein. Um sie ranken sich eine Menge Schauergeschichten und Mutmaßungen. Für viele Menschen ist sie ein düsterer, mit negativer Faszination aufgeladener Ort. Wenn man erst einmal drin ist, so lautet das Klischee, kommt man für lange, lange Zeit nicht mehr heraus. Man verschwindet einfach, und keinen interessiert es. Die Wände in der Klinik sind kahl, die Patienten sitzen teilnahmslos und mit matten Augen den ganzen Tag nur herum, wenn sie nicht von rabiatem Pflegepersonal herumgescheucht werden. Die Zeit vergeht quälend langsam. Man bekommt regelmäßig Spritzen und viel zu starke Tabletten, die jedes Aufbegehren gegen die menschenunwürdigen Zustände sinnlos erscheinen lassen. Versucht man es dennoch, wird man fixiert, festgeschnallt auf seinem Bett, und es werden einem von bösen Ärzten so lange Elektroschocks verabreicht, bis man wie ein Zombie durch die Gänge schleicht.
Das sind Vorstellungen, die ganz tief im kollektiven Gedächtnis verankert zu sein scheinen. Sie beruhen auf Filmen wie Einer flog über das Kuckucksnest mit Jack Nicholson, aber auch auf kritischen, manchmal reißerischen Berichten in Fernsehen und Zeitungen. Fast nie wird über all das Gelingende in den Kliniken berichtet, den ganz normalen Alltag, die gute und wirkungsvolle Arbeit von Ärzten, Pflegekräften und Therapeuten. Leser und Klicks generiert viel eher der reißerisch aufgemachte Einzelfall. Nach und nach verfestigen sich dann die negativen Eindrücke zu Vorurteilen, die nur noch schwer abzubauen sind. Das Fatale ist, dass sie sich nicht nur gegen psychiatrische Kliniken richten, sondern auch ganz allgemein gegen psychische Erkrankungen und, noch schlimmer, gegen die erkrankten Menschen, die doch dringend auf Verständnis und Unterstützung angewiesen sind.
Psychische Erkrankungen sind Volkskrankheiten
Wohl kaum ein Patient oder Angehöriger betritt ein psychiatrisches Krankenhaus leichten Herzens. Wer als Patient in die Klinik kommt, für den hat sich etwas verschoben. Er ist herausgefallen aus dem, was wir für gewöhnlich und ohne recht darüber nachzudenken „Normalität“ nennen. Was immer „Normalität“ auch heißen mag – eine Übereinkunft, wie man leben soll, ein reibungsloses Funktionieren, ein selbstständiges Meistern des Alltags.
Über dem Eingang des Alexianer St. Joseph-Krankenhauses in Berlin-Weißensee, das ich seit zwanzig Jahren leite, hat ein Glaskünstler eine Neonschrift angebracht: „Die Wildgans zieht allmählich der Hochebene zu“. Es sind Worte aus dem Taoismus, jener uralten chinesischen Religion, der es um den inneren Frieden, den rechten Weg und die Harmonie mit der Natur zu tun ist. Am Eingang einer katholischen Klinik mitten in Berlin steht für mich der Satz nicht nur für ein Miteinander der Lebensentwürfe, Weltanschauungen und Religionen. In ihm liegen auch Trost und Zuversicht. Der Weg in den Süden, der Hochebene zu, ist zwar lang, aber es ist möglich, ans Ziel zu kommen, wenn man sich auf sein Inneres verlässt. Und man kann Hilfe bekommen entlang des Weges. Die Wildgans fliegt nie allein, sondern findet Geleit und Schutz unter Ihresgleichen. So soll es auch den Menschen gehen, wenn sie in unsere Klinik kommen.
Eins steht fest: Wer bei uns Hilfe sucht, gehört zwar zu einer Minderheit. Aber zu einer verdammt großen. Über 800 000 Patienten zählen die psychiatrischen Kliniken Deutschlands Jahr für Jahr. Eine andere Zahl ist noch weitaus beeindruckender. Jeder dritte Mensch in Deutschland ist einmal im Jahr von einer psychischen Erkrankung betroffen, also beispielsweise von einer Depression oder einer Angststörung, um nur die beiden häufigsten zu nennen. Jeder Dritte. Man könnte also durchzählen in der Familie, im Bekanntenkreis: eins, zwei, DREI … Jeder kann davon betroffen sein. Der Ehemann, die Schwester, die Kollegin, der Nachbar.
Die in Deutschland aufgrund psychischer Erkrankungen anfallenden direkten Kosten beliefen sich im Jahr 2015 auf 44 Milliarden Euro. Dieses Geld wurde aufgewendet, um die Behandlung und Rehabilitation von Menschen mit psychischen Störungen zu sichern, aber auch um Präventionsmaßnahmen zu treffen. Nur Erkrankungen des Kreislaufs und des Verdauungssystems verursachten höhere Kosten. Zudem steigt die Zahl der Menschen, die wegen einer psychischen Störung nicht mehr arbeiten können. Ihr Anteil an allen krankheitsbedingten Frühberentungen betrug 2016 schon 43 Prozent. Tendenz steigend.
Das sind nur Zahlen, alarmierend zwar, doch was sie aussagen, bleibt abstrakt. Erst wenn man sich klarmacht, dass sich hinter den Zahlen Millionen von Einzelschicksalen verbergen, bekommt die Statistik anschauliche Wucht. Da ist die Ehe, die aufgrund der Erkrankung eines Partners eine immense Belastungsprobe erfährt. Da ist der berufliche Traum, der sich plötzlich zerschlägt, weil die Krankheit es unmöglich macht, die gestellten Aufgaben weiter zu erfüllen. Da ist die Familie, die langsam zerbricht, weil der Alltag aus den Fugen geraten ist. Und immer, sosehr sich die psychischen Störungen auch unterscheiden in Symptomatik und Schweregrad, sind da subjektives Leid und eine spürbare Beeinträchtigung der Fähigkeit, das Leben zu bewältigen. Manchmal wird die Beeinträchtigung als so stark empfunden, dass die Betroffenen sich dazu entschließen, nicht mehr weiterzuleben. 10 000 vollendete Suizide gibt es in Deutschland Jahr für Jahr. Neunzig Prozent davon werden von Menschen mit psychischen Erkrankungen begangen.
Stigmatisierung
Psychische Erkrankungen sind also längst Volkskrankheiten geworden, so wie Diabetes oder Rückenleiden. Nur möchte zu diesem Volk keiner gehören. Bekennt jemand auf einer Party, wegen seines Rückens in ärztlicher Behandlung zu sein, sind ihm das Interesse und die Anteilnahme der Umstehenden gewiss. Wohl nur sehr, sehr selten wird man aber jemanden auf derselben Party sagen hören: „Ich war gerade vier Wochen in der Psychiatrie wegen meiner Depression.“ Täte er es, fielen die Reaktionen mit ziemlicher Sicherheit ein ganzes Stück anders aus.
Psychisch erkrankt zu sein, das bedeutet für die meisten neben dem schon immensen Leidensdruck, den die Krankheit mit sich bringt, immer auch Angst. Angst vor der Reaktion der anderen. Wie wird sich das Umfeld verhalten, die Familie, der Chef, die beste Freundin? Noch immer werden psychisch Kranke stigmatisiert. In der Antike wurde das Stigma, also ein nach außen weithin sichtbares Zeichen, direkt in den Körper gebrannt. Die Öffentlichkeit sollte vor dem Träger des Zeichens gewarnt werden. Buchstäblich gebrandmarkt fristete der, sei es ein Verbrecher oder ein entlaufener Sklave, künftig sein Dasein als Ausgestoßener, der von den Menschen gemieden wurde.
Heute läuft die Stigmatisierung subtiler ab. Ein wie unmerkliches Abrücken im Freundeskreis; Menschen, die plötzlich auf Distanz gehen; ein schiefer Blick beim Sport; übertriebene Rücksichtnahme; vermeintlich gutgemeinte, doch in Wahrheit nur gönnerhafte Ratschläge; eine Versetzung oder gar Entlassung am Arbeitsplatz, weil auch dem längst Wiedergenesenen nichts mehr zugetraut wird. All das kommt einer Verurteilung gleich, auf die der Erkrankte mit Schamgefühlen und Selbstvorwürfen reagiert. Er sucht die Schuld bei sich, glaubt, nicht stark genug zu sein, sich zu wenig zusammenzureißen oder zu dramatisieren. Kein Wunder, dass daher lieber geschwiegen wird als geredet, lieber mit versteckten als mit offenen Karten gespielt wird. Der Prävention psychischer Störungen ist das genauso wenig zuträglich wie dem ganz spezifischen Verlauf der Krankheit des Einzelnen. Wer setzt sich schon gern der Gefahr aus, gemieden zu werden? „Eine psychische Krankheit wirkt wie eine Handgranate im Lebenslauf“, schrieb die Autorin Jana Simon einmal. Leider hat sie recht.
Das Empfinden von Ausgrenzung und Stigmatisierung ist nicht nur die rein subjektive Angelegenheit der Betroffenen. Es gibt Studien, die belegen, dass sich auf diesem Gebiet in den letzten Jahrzehnten kaum etwas zum Besseren gewendet hat. Einerseits hat das Wissen um die Ursachen psychischer Erkrankungen deutlich zugenommen, ob sie nun biologischer, psychologischer oder sozialer Natur sind. Die Ergebnisse dieser Forschung haben die Öffentlichkeit auch durchaus erreicht. Zudem ist die Akzeptanz professioneller Hilfe, die man in Anspruch nehmen kann, gestiegen. Nur haben die Erkrankten nichts davon. Da sind die Zahlen eindeutig.
Seit 1990 hat sich an der negativen Einstellung gegenüber Menschen mit psychischen Störungen nichts geändert. Vielleicht muss man schon froh sein, dass bei der Depression die Zahlen ungefähr gleich geblieben sind. In Bezug auf Schizophrenie hat sich die öffentliche Meinung nämlich sogar verschlechtert. „Möchten Sie einen Menschen mit Schizophrenie als Nachbarn oder Arbeitskollegen haben?“ Da schüttelte ein Drittel der Befragten den Kopf und winkte ab. Über die Hälfte von ihnen konnte sich nicht vorstellen, mit einem Psychose-Kranken befreundet zu sein. Zu gefährlich, zu unheimlich, zu seltsam. Lieber Abstand halten.
Man hat Angst vor denen, die oft genug selbst nichts als Angst haben. Hartnäckig halten sich die Vorurteile, und es sieht so aus, als würden sie so schnell auch nicht verschwinden. Schizophren, das „ist“ der Gewaltverbrecher, der Amokläufer, der Merkwürdige, der durch die Stadt läuft, vor sich hin brabbelt und nicht mehr ansprechbar scheint. Und brauchen wir eine Bestätigung für dieses Klischee, so liefert sie uns fast jeden Sonntag der Krimi zur besten Sendezeit. Das Bild des unberechenbaren, aggressiven „Verrückten“, den seine Krankheit zum Mord treibt, bleibt dem Betrachter im Gedächtnis, auch nachdem der Abspann lange schon gelaufen ist.
Das Label „Psychische Erkrankung“, mit dem zunehmend in der Öffentlichkeit sozial unerwünschtes Verhalten etikettiert wird, entlastet. Erschreckende Taten können damit erklärt, ihre Verursacher ausgegrenzt und der Psychiatrie überantwortet werden. Fragen nach eventuellen gesellschaftlichen Voraussetzungen oder gar Fehlentwicklungen stellen sich dann gar nicht erst. Wen wundert da der Argwohn, mit dem in der Öffentlichkeit auf psychisch Kranke geschaut, die Unsicherheit, mit der ihnen begegnet wird, und die Scheu der Betroffenen, über ihre Krankheit zu reden?
Um Ängste abzubauen, hilft am besten, wie immer in solchen Fällen, der direkte Kontakt. Hört man zu, wenn jemand erzählt, was es wirklich heißt, psychisch krank zu sein, und befasst man sich näher mit einem zunächst so seltsam anmutenden Verhalten, löst sich manches Klischee rasch in Wohlgefallen auf.
Fast genauso hilfreich ist es, Aufklärung zu betreiben. Wissen zu vermitteln. Immer und immer wieder aufs Neue. Unwissenheit ist der Boden, auf dem Vorurteile prächtig gedeihen können. Wir dürfen nicht aufhören damit, die Dinge zu erklären, richtigzustellen, zu kommunizieren. Mit jedem Wissenden, der kommt, geht ein Ängstlicher. Bei Krebs ist es in den letzten Jahrzehnten nicht zuletzt mithilfe von Aufklärungskampagnen sehr gut gelungen, die Krankheit aus dem gesellschaftlichen Abseits zu holen und ein öffentliches Bewusstsein für Früherkennung und Therapieformen zu schaffen. Die Krankheit hat mittlerweile jene Anrüchigkeit, die ihr lange Zeit anhaftete, verloren. Vielleicht gelingt uns das ja mit psychischen Erkrankungen eines Tages genauso gut.
Man sieht nur mit dem Herzen gut
Still ist es im Garten des Alexianer St. Joseph-Krankenhauses mit seinen schmalen gepflasterten Wegen zwischen den Rasenflächen, den alten Bäumen und den Parkbänken, von denen aus man das machtvolle Hauptgebäude mit seinen rötlichen Backsteinen sehen kann. So still, dass man es manchmal kaum glauben mag, dass nur wenige Meter vom Klinikgelände entfernt Tag und Nacht der Verkehr auf der Berliner Allee dahinfließt, die, von Prenzlauer Berg kommend, Weißensee durchschneidet.
Ich weiß noch, wie ich 1998 zum ersten Mal die Atmosphäre des Gartens, die besonders für Großstadtmenschen ein Aufatmen, eine erholsame Reizreduzierung ermöglicht, in mich aufgenommen habe. Zuvor hatte ich zwei Jahre am Landeskrankenhaus im brandenburgischen Teupitz gearbeitet, und jetzt also war ich hier, eine junge, tief im Westen sozialisierte Chefärztin, die es mit Menschen zu tun bekam, denen ein ganzes Land weggebrochen war, das sie vielleicht geliebt, vielleicht gehasst hatten.
Gehe ich morgens vom Parkplatz durch den Garten zu meinem Büro, ergibt sich immer eine Gelegenheit für eine Begegnung mit Patienten. Manche sind noch müde, manche rauchen die erste Zigarette des Tages, und wieder andere eilen geradezu, weil ihre Therapiestunde gleich beginnt. Ich mag diese Morgenstimmung sehr. Am schönsten ist es, wenn sich spontan ein Gespräch ergibt. Leicht dahingesagte, doch nie oberflächliche Sätze, die im besten Sinne Normalität zum Ausdruck bringen. Besonders Psychose-Patienten kümmern sich nicht allzu sehr um Etikette oder Floskeln, sondern konfrontieren einen direkt mit dem, was sie wahrnehmen: „Oh, Sie haben aber heute ein schönes Kleid an!“ Oder auch: „Mensch, Sie sehen heute aber schlecht aus!“ Es sind kurze Unterhaltungen, jenseits von Visite und therapeutischem Dialog. Sie zeigen, dass da eben nicht nur eine Krankheit existiert und ein Therapieplan, sondern trotz allem immer auch ein Raum, wie klein er auch sein mag, in dem sich zwei Menschen begegnen und respektieren können, mit einem Nicken, einem Lächeln.
Als ich noch ganz am Beginn meiner beruflichen Laufbahn stand, erhielt ich von meinem damaligen Chefarzt eine Ausgabe des Kleinen Prinzen und dazu eine kleine Figur, einen Fuchs. Der Fuchs spielt bekanntlich in Saint-Exupérys Buch eine entscheidende Rolle, denn er entwirft im Zwiegespräch mit dem Kleinen Prinzen eine Lehre der Freundschaft und der Achtsamkeit: „Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“ Berühmt gewordene Sätze, die sich mühelos, das wollte mir Dr. Faber mit seinem Geschenk klarmachen, auch auf das Verhältnis zwischen Arzt und Patient übertragen lassen.
Man muss die Menschen lieben, sonst kann man nicht Psychiaterin sein. Auch wenn jemand gerade noch so schwer zugänglich erscheint, muss man versuchen, mit ihm in Kontakt zu kommen und eine positive Beziehung zu ihm aufzubauen. Und man muss sich selbst lieben, eine positive Verinnerlichung haben. Nur dann schafft man es, mit manchmal schwierigen oder aggressiven Situationen einigermaßen gelassen umzugehen. Nur dann kann man dem Gegenüber auch etwas geben. Nicht zuletzt Hoffnung.
Ja, psychische Erkrankungen treten häufig auf. Jeder kann sie bekommen. Und sie sind oft schlimm, manchmal sehr schlimm. Aber sie lassen sich behandeln, vor allem mit Psychotherapie, aber auch mit Medikamenten. Zudem passiert gerade sehr viel in der Forschung. Auch die Versorgung der Erkrankten wird neu gedacht. Wir sind auf einem guten Weg, psychische Erkrankungen bald noch besser, noch individueller behandeln zu können. Es gibt Hoffnung. Wir müssen keine Angst haben.



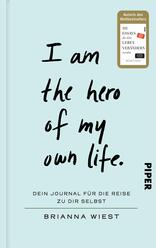
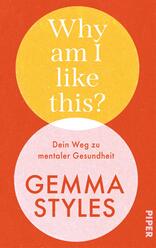





DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.