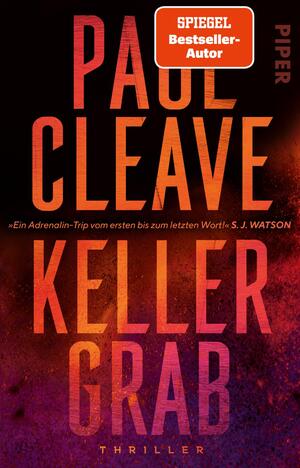
Kellergrab - eBook-Ausgabe
Thriller
— Düster, hart und spektakulär – der Psychothriller des Jahres!Kellergrab — Inhalt
Die besten Geschichten sind geschrieben in Blut
Paul Cleave ist der König des harten Thrillers
Wer könnte perfider morden als ein Thriller-Schriftsteller? Oder am besten gleich ein Autorenpaar? Cameron und Lisa Murdoch sind so ein Paar und behaupten, sie könnten ein perfektes Verbrechen begehen. Als ihr Sohn verschwindet, scheint aus blutigen Geschichten Ernst zu werden. Es beginnt eine öffentliche Hetzkampagne gegen das Ehepaar. Als Lisa bei einem Tumult schwer verletzt wird, bricht die Welt ihres Mannes endgültig zusammen. Doch dann wird der wahre Kidnapper des Jungen gefunden – tot. Cameron wird böse ... sehr böse ... und er will sich an denen rächen, die leben ... die noch leben!
„Seine Worte schneiden wie ein Skalpell!“ New York Times
Leseprobe zu „Kellergrab“
PROLOG
Lucas Pittman muss sich beeilen.
Die beiden Kriminalbeamten haben ihre Fragen gestellt, die Frau mit den muskulösen Armen und der Mann in dem gut sitzenden Anzug, den Lucas sich selbst dann nicht leisten könnte, wenn er arbeiten und zehn Jahre lang darauf sparen würde. Diese Berechnung basiert natürlich auf dem Lohn im Knast, wo er für jeden Tag, an dem er Blut und Scheiße in den Toiletten wegschrubbt, gerade mal einen Dollar bekommen hat.
Er will nicht zurück in den Knast.
Er kann nicht.
Und er muss es auch nicht. Wenn er jetzt schnell ist.
Der Raum [...]
PROLOG
Lucas Pittman muss sich beeilen.
Die beiden Kriminalbeamten haben ihre Fragen gestellt, die Frau mit den muskulösen Armen und der Mann in dem gut sitzenden Anzug, den Lucas sich selbst dann nicht leisten könnte, wenn er arbeiten und zehn Jahre lang darauf sparen würde. Diese Berechnung basiert natürlich auf dem Lohn im Knast, wo er für jeden Tag, an dem er Blut und Scheiße in den Toiletten wegschrubbt, gerade mal einen Dollar bekommen hat.
Er will nicht zurück in den Knast.
Er kann nicht.
Und er muss es auch nicht. Wenn er jetzt schnell ist.
Der Raum unter dem Haus ist nur wenig größer als eine Gefängniszelle. Vier Wände aus Hohlblocksteinen, der Fußboden aus Beton, und der einzige Zugang eine gut getarnte Luke. Die Polizei hat sein Haus durchsucht und nichts gefunden. Und genau darum geht es doch, wenn man einen verborgenen Raum hat, oder? Dass man etwas darin versteckt. Sein Vater jedenfalls war dieser Ansicht gewesen. Und wenn sein Vater ihn nicht manchmal dort unten ans Bett gekettet hätte, zusammen mit einigen anderen, dann hätte Lucas nie von dessen Existenz erfahren.
Und selbst wenn die Polizei anrücken und den Raum doch noch finden sollte, würde es einen gewaltigen Unterschied machen, ob sie ihn leer vorfinden oder darin zwei gefangene, mit Drogen betäubte Kinder entdecken. Lucas will nicht, dass es so endet, aber hat er eine Wahl? Irgendjemand weiß Bescheid. Das ist offensichtlich – aber wer Bescheid weiß, ist leider nicht so offensichtlich.
Er öffnet die Schranktür im Flur. Dort hängen Jacketts an Kleiderbügeln, auf dem Boden liegen jede Menge Schuhe. Lucas schaufelt die Schuhe aus dem Schrank, zieht den Teppichboden zur Seite und hebelt die Bretter des Unterbodens heraus. Das dauert immer eine Weile, und bis heute hat ihn das nie gestört. Doch jetzt zählt jede Sekunde. Pittman hat einige Zeit im Knast verbracht und kennt den Unterschied zwischen zwei Minuten, die man zu lang braucht, um sich Zugang zu einem Raum zu verschaffen, und zehn Jahren, die man dann in einem anderen Raum eingesperrt ist. Aber heute ist alles anders, denn seit heute ist Zach Murdoch in seinem geheimen Raum.
Er beeilt sich. Nachdem er die Bretter herausgenommen hat, sind zwei Vertiefungen zu sehen, in die er die Hände schieben kann, um das quadratische Bodenstück hochzuheben. Er lehnt es gegen die Wand und klettert hastig die Leiter nach unten.
Bloß keine Zeit verlieren.
Der Junge ist immer noch betäubt. Er trägt ein gelbes T-Shirt mit einem aufgedruckten Bus. In diesem Alter hat Lucas auch so eins gehabt. Er erinnert sich noch, wie seine Mutter es ihm zu Weihnachten schenkte und sein Vater es ein Jahr später zerfetzte. Er wird den Jungen vermissen. Weil er Kleider trägt, wie Lucas sie in seiner Kindheit getragen hat. Weil ihm eine schönere Kindheit vergönnt war.
Der Körper des Jungen ist schlaff, aber so leicht, dass es kein Problem ist, ihn die Leiter hochzutragen. Lucas setzt das Bodenstück wieder ein und legt die Bretter darüber, dann den Teppich, dann die Schuhe. Das dauert seine Zeit.
Er trägt den Jungen zum Auto in der Garage und quetscht ihn in den Kofferraum. Wenn im Kofferraum genug Platz für zwei Jungs wäre, würde es doppelt so schnell gehen, aber das ist leider nicht der Fall. Er hat noch nie weiter darüber nachgedacht, zwei Jungen auf einmal zu transportieren. Einen auf den Vordersitz zu schnallen wäre sicher keine gute Idee, denn dann könnte sein Nachbar ihn sehen. Dieser Nachbar, der immer neugierig herüberglotzt. Der sich besser um seine eigenen Angelegenheiten kümmern sollte.
Er legt den Spaten mit dem kurzen Griff in den Kofferraum. In seinen Gedanken hört er die Stimme des Vaters, der ihm erklärt, dass es nicht nötig sei, zwei separate Gräber auszuheben, weil ein großes völlig ausreicht.
Er fährt die Garagentür auf und setzt rückwärts aus der Einfahrt. Er schaut zum Haus des Nachbarn. Und tatsächlich, der steht am Fenster und glotzt raus. Hat ein Telefon in der Hand. Ruft wahrscheinlich die Bullen.
Ich hätte ihn vor Monaten schon umbringen sollen.
Ich bringe ihn um, wenn das alles vorbei ist.
Er biegt auf die Straße und lässt das Haus hinter sich. Fährt mal nach rechts, mal nach links, Richtung Norden, und verlässt das Stadtgebiet von Christchurch. Dorthin, wo er früher mit seinem Vater fuhr, der ihm beibrachte, wie man eine Leiche entsorgt, bevor er Diabetes bekam, ein Bein verlor, sein Augenlicht, sein Leben. Er würde gern schneller fahren, um sein Haus so rasch wie möglich hinter sich zu lassen, um alles hinter sich zu bringen, aber er beherrscht sich und achtet auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Eine Verkehrskontrolle wäre das Letzte, was er jetzt braucht. Er flucht über jede rote Ampel und dankt Gott für jede grüne. Sein Auto macht ein eigenartiges klapperndes Geräusch. Das geht schon seit einigen Wochen so. Er hat es eigentlich in die Werkstatt geben wollen. Hoffentlich macht es nicht ausgerechnet jetzt schlapp. Dumm, dass er es nicht hat überprüfen lassen. Er atmet tief durch, bemüht sich, ruhig zu bleiben, bloß nichts zu provozieren.
Sirenen sind nicht zu hören. Kein Streifenwagen ist in Sicht. Plötzlich aber doch. Sie sind ihm auf den Fersen. Sie haben ihn gefunden. Er hätte gern mehr Zeit gehabt. Er drückt das Gaspedal durch, überschreitet die Höchstgeschwindigkeit. Das Klappern wid immer lauter, schneller und durchdringender, aber der Wagen fährt weiter. Sein Herz rast. Er muss seine schwitzenden Hände am Hemd trocknen. Der Streifenwagen ist noch fünfzig Meter hinter ihm, dann vierzig, dann dreißig. Ein zweiter Wagen schert aus dem Verkehr aus und nähert sich. Ein Blaulicht taucht im Rückspiegel auf. Eine Zivilstreife? Wie viele sind es noch?
Er will nicht wieder in den Knast.
Nur das nicht.
Er hält das Gaspedal ganz durchgedrückt und rast weiter. Der Streifenwagen bleibt an ihm dran. Er fährt immer schneller – wenn man in Neuseeland so schnell fährt, dass es lebensgefährlich wird, ist die Polizei gesetzlich verpflichtet, die Verfolgung zu beenden. Lucas empfindet das als eine Art Belohnung. Wieder und wieder verlässt er den Verkehrsstrom, schert dann wieder ein. Der Streifenwagen folgt ihm immer noch, aber dann wird er langsamer und bleibt zurück. Weiter vorn wird der Verkehr immer dichter. Er muss die nächste Abfahrt nehmen. Er bemerkt eine Lücke im Gegenverkehr. Er könnte zwischen einem weißen Van und einem Lastwagen durchbrettern. Jetzt befindet sich die Lücke kurz vor der nächsten Kreuzung. Es wird eng, aber er kann es schaffen.
Er nimmt den Fuß vom Gas und biegt hinter dem Van nach rechts, berührt beinahe dessen Stoßstange, gibt wieder Gas. Kurz befürchtet er, der Wagen könnte genau in diesem Moment seinen Geist aufgeben, das Klappern ohrenbetäubend werden, der Keilriemen reißen, die Kolben blockieren, aber alles läuft normal weiter, der Motor, das Auto, auch wenn die Lücke viel enger ist, als er dachte. Passt schon, er wird es schaffen, er muss.
Der Lastwagen rammt seinen Wagen und schiebt ihn zusammen, ehe er ihn in die Luft schleudert. Metall verdreht sich, Glas splittert, der Tank reißt auf. Als er das erste Mal auf dem Boden aufkommt, wird das Auto auf die Hälfte zusammengedrückt. Lucas Pittman spürt den Druck auf seinem Schädel. Beim zweiten Aufschlag erfüllt sich sein Wunsch, nie mehr in den Knast zu müssen. Der Junge im Kofferraum wird hin und her geworfen. Schließlich bleibt der Wagen liegen. Flammen schießen empor.
SONNTAG
EINS
Das Gras im Park ist niedergetrampelt, zahlreiche Zelte sind aufgebaut. Stände und Buden überall, Schlangen wartender Menschen, Jahrmarktsattraktionen, grelle Lichter und Musik. Losgerissene Luftballons fliegen der Sonne entgegen. Aufgeschlagene Kinderknie, Grasflecken an Ellbogen und Sodbrennen wegen all der Hotdogs. Lachen, Schreien, Rufen. Hitze. Staub. Schausteller, die Besucher anlocken, damit sie ihr Glück versuchen. Der Sommer hat in Neuseeland offiziell begonnen, und die Welt riecht nach Popcorn und Zuckerwatte.
Auf dem Karussell sehe ich Kiwis statt Pferde, zweibeinige, flügellose Vögel statt vierbeinige, flügellose Pferde. Jeder Vogel hat einen langen Schnabel, der bis zum Boden reicht. Zach lacht, als der Karussellbetreiber ihn auf den letzten freien Kiwi setzt. Wir mussten zehn Minuten anstehen. Das Karussell ist bunt, dicke Farbkleckse übertünchen die Rostflecken, tausend bunte Glühbirnen leuchten. Die Kiwis beginnen sich zu drehen, Zach verschwindet und taucht wieder auf. Jedes Mal, wenn er wieder erscheint, zieht er eine andere Grimasse, damit ich ihn fotografiere. Mal hängen seine glatten, schwarzen Haare über der Brille, mal steckt er die Finger in die Ohren oder die Nase, verdreht die Augen, grinst fröhlich, blickt finster drein, streckt die Zunge raus, grinst schlau, grinst blöd, grinst gar nicht. Dann wird die Musik langsamer, die Kiwis werden langsamer, und Zach springt herunter, kaum dass das Karussell angehalten hat. Er rennt auf mich zu.
„Hüpfburg!“, ruft er aus und sprintet an mir vorbei in Richtung der Burg, auf der sich einige Kinder austoben.
Heute ist der erste Tag des Jahrmarkts. Er wird den restlichen Dezember hindurch bis Mitte Januar stattfinden. Tausende sind gekommen, jede Menge Kinder drängen sich vor den Attraktionen, halten Tüten mit schmelzenden Eiskugeln in den Händen, werden von ihren Eltern mühsam im Zaum gehalten. Es duftet süß, und eine gespannte Erwartung liegt in der Luft. Ich wünsche mir, noch einmal Kind zu sein, durch die Menge zu flitzen und alle Attraktionen auszuprobieren. Stattdessen renne ich hinter meinem siebenjährigen Sohn her, der völlig durchgedreht ist, kaum dass wir aus dem Auto gestiegen sind. Vor der Hüpfburg ist keine Schlange, nur ein halbes Dutzend Kinder springen darin herum. Der Typ, der sie betreibt, hat mehr Lücken als Zähne im Mund. Er hat eine Ledertasche am Gürtel und einen Eimer mit Putzlappen neben sich, um den Schmutz wegzuwischen, der in einer Hüpfburg so anfällt.
Die Burg ist groß genug für zwanzig Kinder. Man kommt auf der einen Seite über eine Rampe hinein und auf der anderen Seite wieder hinaus. Ich kaufe eine Eintrittskarte. Der Besitzer fordert Zach auf, seine Sandalen auszuziehen. Zach kickt sie weg und gibt mir seine Brille. Kurz sieht es aus, als wolle er sich kopfüber in die Burg stürzen, aber dann reißt er sich zusammen und klettert langsam hinein. Die anderen Kinder werfen ihm kurze Blicke zu. Das passiert öfter. Zach erregt immer Aufmerksamkeit bei anderen Kindern, weil sie sofort spüren, dass er ein bisschen anders ist. Jedes Mal, wenn ich das mit ansehen muss, gibt es mir einen Stich.
Ich hebe seine Sandalen auf und stelle mich neben den Betreiber, um zuzuschauen. Der Mann blättert in einer Autozeitschrift und blickt nur gelegentlich auf, um nachzuschauen, ob es in der Hüpfburg keinen Ärger gibt.
Zach ist jetzt auf dem Hüpfareal. Eins der Kinder spricht kurz mit ihm und lässt ihn dann in Ruhe. Zach beginnt vorsichtig zu hüpfen, wirkt aber unsicher. Ich mache noch mehr Fotos mit meinem Smartphone und schicke sie zusammen mit den anderen an Lisa.
Lisa arbeitet an den Korrekturen für den neuen Roman, der nächstes Jahr erscheinen soll. Ich schaue aufs Display und sehe die Pünktchen, als Lisa mir eine Nachricht schickt: Er amüsiert sich ja prächtig! Ich antworte, dass ich es schade finde, dass sie nicht dabei ist, dann kommen wieder Pünktchen, als sie schreibt: Ich auch.
Ich stecke das Handy ein. Zach ist im Innern der Hüpfburg verschwunden. Das ganze Ding schwankt hin und her, während die Kinder herumtoben. Neue kommen dazu, darunter zwei Schwestern, Zwillinge in identischen Kleidern. Ihre Mutter fotografiert sie beim Springen.
Ich gehe näher ran, damit ich Zach beobachten kann. Ich muss aufpassen, dass die anderen Kinder nicht böse zu ihm sind. Aber ich sehe ihn nicht. Offenbar ist er oben auf der Rampe in einer Ecke, die ich nicht einsehen kann, und steht für die Rutsche an. Oder er versteckt sich vor mir. Spontanes Versteckspiel ist eine seiner Spezialitäten. Aber ich glaube nicht, dass er es hier tun würde – wir haben ausgiebig darüber gesprochen, welche Regeln für den Jahrmarkt gelten. Nicht weglaufen. Nicht verstecken. Er soll die ganze Zeit in Sichtweite bleiben.
Kein Kind kommt die Rutsche hinunter. Oben ist auch keine Warteschlange. Hat sich ihm jemand in den Weg gestellt? Das wäre nicht das erste Mal. Ich gehe ein Stück um die Burg herum, schaue in alle Ecken. Kein Zach. Eine Stimme in meinem Kopf – die elterliche, mahnende – erinnert mich daran, dass ich eine solche Situation schon in zahllosen Kinofilmen gesehen habe: Gerade war das Kind noch da, plötzlich ist es verschwunden und liegt auch schon im Kofferraum eines wildfremden Menschen.
Ich bleibe am Eingang stehen und schaue in den Hüpfbereich. Die Zwillinge toben am Rand herum. Eine hält inne und schaut mich an, die andere rempelt ihre Schwester an, und sie fallen aus der Burg heraus. Landen direkt vor meinen Füßen. Ich bücke mich, um ihnen aufzuhelfen. Die eine nimmt meine Hand, die andere steht allein auf und schaut mich misstrauisch an. Sie klettern wieder hinein.
„Zach?“
Zach antwortet nicht, aber Was-wäre-wenn meldet sich zu Wort. Was-wäre-wenn ist die Stimme in meinem Kopf, die zum Zuge kommt, wenn ich schreibe. Sie schickt meine Charaktere auf neue, unbekannte Wege oder nimmt eine ganz alltägliche Situation und stellt sie auf den Kopf. Was wäre, wenn der Kerl ein Messer hätte? Was wäre, wenn die Tür verschlossen ist? Was wäre, wenn sie nicht die Polizei rufen würden? Aber jetzt ist es bittere Realität, als Was-wäre-wenn in meinem Kopf sagt: Er ist weg. Jemand hat ihn geholt und schleppt ihn durch die Menge nach draußen.
„Zach?“
Du musst dich beeilen.
Ich steige in die Hüpfburg. Der Boden sinkt tief ein unter meinem Gewicht, und die Kinder müssen sich anstrengen, um nicht die Balance zu verlieren. Ich klettere auf die Rampe. Dort ist niemand. Ich steige wieder herunter. Die Kinder haben aufgehört zu hüpfen. Sie starren mich an.
„Ein Junge hat hier gespielt“, sage ich. „Er ist so groß.“ Ich halte meine Hand vor die Brust. „Er trägt ein Superman-T-Shirt. Hat jemand ihn gesehen?“
Keine Antwort.
Der Boden sinkt tief ein und wackelt, als ich weitergehe. Ein kleiner Junge verliert das Gleichgewicht und fällt gegen mich. Ich helfe ihm auf, aber er fällt wieder um. Ich stolpere über ihn, und das Ganze endet damit, dass ich eins der Zwillingsmädchen aus der Hüpfburg stoße. Die Kleine landet unsanft auf dem Boden, fängt an zu weinen, steht auf und humpelt zu ihrer Mutter, die auf ihr Handy starrt.
Zach ist nicht da.
Was-wäre-wenn hat recht.
Mein Sohn ist verschwunden.
ZWEI
Mein Sohn kann nicht verschwunden sein. So etwas passiert immer nur anderen Leuten, genauso wie Autounfälle, Krebs oder dass einem das eigene Haus abbrennt.
Tu etwas.
Immer noch halte ich Zachs Sandalen in der Hand. Ich muss mich zusammenreißen. Das kriege ich hin. Kinder verschwinden nicht so einfach am helllichten Tag. Nicht im realen Leben. Es sei denn, es passiert dann doch. Was aber gar nicht sein kann. Denn das Leben hier ist sicher. Wir leben in einer ruhigen Stadt mit anständigen Bürgern.
Ich helfe dem kleinen Jungen in der Hüpfburg auf, der eben hingefallen ist. Er hat vorhin mit Zach gesprochen. Ich knie mich hin, damit ich auf Augenhöhe mit ihm bin. „Du hast doch mit …“
„Tun Sie mir nicht weh“, sagt er.
„Ich tue dir nicht weh“, sage ich und ziehe mein Handy aus der Tasche. Er dreht sich um, aber ich halte ihn am Arm fest.
„Warte bitte. Ich will dir nur ein Foto zeigen.“
„Lassen Sie den Jungen in Ruhe“, ruft ein Mann und stürmt auf mich zu. Er hat eine Glatze, ist ungefähr dreißig und sieht wütend aus.
Er ist nicht der Einzige. Auch die Mutter der Zwillinge nimmt mich ins Visier. Sie ist ebenfalls um die dreißig, hat die dunklen Haare streng zurückgebunden und sieht zornig aus. Eine ihrer Töchter ist weinend zu ihr gerannt, die andere steht noch in der Hüpfburg und starrt mich an. Plötzlich wird mir klar, wie die Situation auf die anderen Eltern wirken muss. Ich bin in die Hüpfburg gesprungen und habe ihre Kinder belästigt. Ich richte mich auf und steige aus dem Hüpfareal.
„Tut mir leid“, sage ich und hebe entschuldigend die Hände, in denen ich die Sandalen halte. „Ich wollte nicht …“
Weiter komme ich nicht. Der Mann, der mich angeschrien hat, schlägt mir gegen die Brust. Ich taumle nach hinten gegen die Hüpfburg.
„Warten Sie, ich …“
„Was haben Sie mit meiner Tochter gemacht?“, fragt die Frau mit schriller Stimme und deutet anklagend mit dem Finger auf mich. Sie baut sich neben dem Mann auf, der mich geschubst hat. Ich stütze mich an der Hüpfburg ab, um wieder aufrecht zu stehen.
„Ich …“
„Was soll das? Wollen Sie sich an den Kindern vergehen?“, fragt sie.
„Nein, natürlich nicht. Ich …“
„Er hat meinen Sohn angefasst“, sagt der Mann.
„Ich hab’s gesehen“, stimmt die Frau zu. „Wahrscheinlich hat er alle Kinder da drinnen begrapscht.“
„Ich wollte doch nur …“
„Er hat mir wehgetan“, sagt der Junge.
Ich hebe abwehrend die Hände. „Hören Sie mir doch mal …“
Der Mann macht eine Drehung und verpasst mir einen Schlag in die Magengrube. Ich falle rücklings in die Hüpfburg, durch die Erschütterung wird das andere Zwillingsmädchen hinausgeschleudert. Ich rolle zur Seite, rutsche aus der Burg und lande auf dem Boden, schnappe nach Luft. Der Mann packt seinen Sohn und stürmt mit ihm davon. Dann deutet er noch mit dem Finger auf mich und droht mir, er werde mich umbringen, sollte ich seinem Sohn jemals etwas zuleide tue.
Die Mutter nimmt ihre schluchzende Tochter an die Hand, das andere Mädchen steht ein paar Meter abseits und weint ebenfalls. „Sie sollten sich schämen“, sagt sie und macht mit ihrem Handy ein Foto von mir.
Ich sage nichts und werfe einen Blick zurück in die Hüpfburg, in der Hoffnung, dass Zach wiederaufgetaucht ist. Ist er aber nicht.
Er ist verschwunden, hämmert Was-wäre-wenn in meinem Kopf. Die Stimme wird lauter, je größer meine Angst wird. Er ist weg, und du wirst ihn nie mehr wiedersehen.
„Ich rufe die Polizei“, setzt die Mutter nach.
„Ich wollte den Kindern nichts tun“, sage ich.
„Erzähl das deinem Anwalt, du Kinderschänder“, sagt sie und geht weg, die Kinder im Schlepptau.
Der Hüpfbudenbesitzer kommt und hilft mir auf die Beine.
„Alles in Ordnung?“
„Ich kann meinen Sohn nicht finden.“
„Er ist vor einer Minute rausgeklettert“, sagt er und bückt sich, um mein Handy aufzuheben, während ich Zachs Sandalen aufsammle. Er reicht mir das Handy. „Das war, als Sie mit dem Ding hier beschäftigt waren.“
„Warum haben Sie mir nichts gesagt?“
„Warum haben Sie nicht auf Ihr Kind aufgepasst?“
Ich hasse ihn, weil er recht hat. Die Frau mit den Zwillingen telefoniert, starrt mich an und gibt wahrscheinlich gerade der Polizei meine Personenbeschreibung durch.
„Ist jemand bei ihm gewesen?“
„Weiß ich nicht. Vielleicht.“ Er deutet in die Menge. „Er ist in diese Richtung gegangen.“
„Was befindet sich dort?“
„Lauter Sachen, mit denen ich nichts zu tun habe.“
Ich tauche in die Menge ein. Suche nach jemandem, der für Notfälle zuständig ist. Jemand vom Sicherheitsdienst oder einen Polizisten. Es muss doch irgendwo eine Information geben oder einen Sammelpunkt, an dem Eltern ihre verloren gegangenen Kinder abholen können. Ein Sanitätszelt. Aber ich sehe nur Tausende Menschen, die Spaß haben und sich um nichts weiter kümmern. Sie alle könnten mir helfen, aber …
Aber da ist er ja. Da vorne steht er in der Schlange vor dem Spiegelkabinett. Er spricht mit einem Mädchen, das in seinem Alter ist. An seinen Händen klebt Zuckerwatte, und das Mädchen versucht das Naschwerk an ihrem Kleid abzuwischen. Die Kleine schaut Zach an und hört ihm zu. Ich zögere. Am liebsten wäre ich hingegangen, hätte ihn umarmt und gefragt, was er sich dabei gedacht hat, einfach wegzulaufen. Aber das ist ja das Problem – er hat sich eben überhaupt nichts dabei gedacht. Er ist sieben Jahre alt. Er tut das, was Siebenjährige so tun. Meine Welt, die gerade aus allen Fugen geraten ist, renkt sich langsam wieder ein.
Ich gehe zu ihm, nehme ihn an der Hand und sage ihm, dass es Zeit wird zu gehen. Er fragt, ob etwas nicht stimmt, und ich sage, dass alles in Ordnung ist. Das scheint er nicht ganz zu glauben und sieht aus, als wolle er in Tränen ausbrechen. Eine typische Reaktion, wenn die Dinge nicht so laufen, wie er sich das wünscht. Ich komme ihm zuvor, indem ich vorschlage, auf dem Weg nach draußen noch ein Eis zu kaufen.
„Darf ich jede Sorte haben?“
„Du suchst dir aus, was du haben willst“, sage ich. Mit Zach muss man die Dinge sehr genau besprechen. Wenn ich ihm verspreche, dass er aus allen Sorten aussuchen kann und es dann eine Sorte, die ihm vorschwebt, nicht gibt, dann bricht für ihn eine Welt zusammen. „Weißt du noch, was ich dir in Bezug auf Weglaufen gesagt habe?“
„Dass ich das niemals tun soll.“
„Warum hast du es dann getan?“
„Was?“
„Du bist von der Hüpfburg weggegangen, ohne es mir zu sagen.“
Er überlegt, geht die letzten Minuten noch mal durch. Dann sagt er: „Einer der Jungs in der Burg hat gesagt, ich sei seltsam. Deshalb wollte ich weg. Ich bin doch gar nicht seltsam, oder?“
„Natürlich nicht.“
„Ich habe dir gewunken, aber du hast nicht geguckt.“
„Dann hättest du warten sollen.“
„Warum hat der Junge das zu mir gesagt?“
„Die Leute sagen manchmal Dinge, die sie gar nicht so meinen.“
Er denkt eine Weile nach und sagt dann: „Also, wenn du und Mama mir sagen, ich soll die Hände waschen vor dem Essen, dann meint ihr das gar nicht so?“
„Doch, das meinen wir so.“
„Ich kapier das nicht“, sagt er. „Ich glaube, ich brauche mindestens zwei Kugeln Eis.“
Ich lache, und erst dann merke ich, dass Zach keinen Witz gemacht hat. Wir gehen in Richtung Ausgang, reihen uns in den Menschenstrom ein. Am Straßenrand parken jede Menge Autos. In der zweiten Reihe suchen Fahrer verzweifelt nach einer Parkmöglichkeit. Unser Wagen steht auf einem Parkplatz zwischen zahllosen anderen. Ich öffne die hintere Tür, und Zach steigt ein. Ein paar Reihen weiter sehe ich den Kerl, der mich geschlagen hat. Er setzt sein Kind in eine dunkelrote Limousine. Der Junge weint immer noch. Ich überlege, ob ich rübergehen und mich entschuldigen soll, aber das erübrigt sich, als der Typ aufschaut und mich bemerkt. Er wirft mir einen drohenden Blick zu. Ich frage mich, was die Personen aus meinen Büchern in so einer Situation tun würden. Einige würden zu ihm hingehen und ihn zusammenschlagen. Andere würden ihn für immer in irgendeinem Loch versenken. Ich würde ihm gern mitteilen, dass ich meinen Lebensunterhalt damit verdiene, Leute umzubringen. Dass ich weiß, wie man das perfekte Verbrechen verübt.
Stattdessen steige ich ein, und wir fahren los.



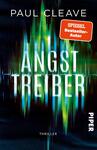

DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.