

Koogland Koogland - eBook-Ausgabe
Roman
— Spannende Unterhaltung mit einem erschreckend realistischen Szenario„Ein rasant erzählter Roman mit fesselnder Handlung, plastisch erzählt wie ein Film.“ - Dithmarscher Landeszeitung
Koogland — Inhalt
Bei einer Jahrhundertflut an der Nordsee brechen die Deiche der Elbmarschen nordwestlich von Hamburg. Die meisten Einwohner verlieren alles, zurück bleibt nur Verwüstung. Die Räumung des Gebiets wird staatlich angeordnet, doch eine Gruppe um den Deichhauptmann Thies Cordes will bleiben und ruft einen eigenen Staat aus: „Koogland“.
Cordes allein entscheidet, wen er aufnimmt. Die Krankenschwester Lara darf bleiben, denn medizinisches Personal wird dringend benötigt. Was Cordes nicht weiß: Lara will herausfinden, was mit ihrer Schwester Alina geschah, die vor Kurzem in Koogland spurlos verschwand …
Für Leser:innen von Andreas Eschbach
Leseprobe zu „Koogland“
Prolog
„Der Deich wird brechen.“
Es war tief in der Nacht, der Regen prasselte, das Wasser lief ihnen eisig in die Stiefel und in den Nacken. Die Männer zitterten im Sturm, während sie immer wieder Sandsäcke in neue Risse stopften. Meterhohe Wellen trieben auf die Deichkrone zu. Gegen den brüllenden Wind und das Tosen der See konnten sie sich nur schreiend verständigen. Dennoch hatte Thorsten den Satz klar und deutlich vernommen: Der Deich wird brechen.
„Wir müssen evakuieren.“
Auch diesen Satz verstand er. Thorstens Ziehvater Thies Cordes blickte hinaus in [...]
Prolog
„Der Deich wird brechen.“
Es war tief in der Nacht, der Regen prasselte, das Wasser lief ihnen eisig in die Stiefel und in den Nacken. Die Männer zitterten im Sturm, während sie immer wieder Sandsäcke in neue Risse stopften. Meterhohe Wellen trieben auf die Deichkrone zu. Gegen den brüllenden Wind und das Tosen der See konnten sie sich nur schreiend verständigen. Dennoch hatte Thorsten den Satz klar und deutlich vernommen: Der Deich wird brechen.
„Wir müssen evakuieren.“
Auch diesen Satz verstand er. Thorstens Ziehvater Thies Cordes blickte hinaus in den schwarzen Abgrund. An schönen Tagen sah man dort die Elbmündung in die Nordsee. Heute war kein schöner Tag. Es hatte den ganzen Februar durchgeregnet, die Straßen hinter dem Deich standen längst unter Wasser, Frost hatte die Elbmündung unpassierbar gemacht. In dieser Nacht zerbrach der Sturm das Eis und trieb es mit der Flut über das Vorland. Die spitzen Kanten der Eisschollen zerhackten mit jeder weiteren Welle den Deich etwas mehr. Selbst der alte Cordes, Thies’ Vater, hatte so etwas noch nicht erlebt. Alle waren erschöpft, der Deich war es auch. Doch noch hielt er. Er hatte immer gehalten.
„Er wird nicht halten!“, rief Thies Thorsten zu, als könne er dessen Gedanken lesen.
„Das kann nicht sein.“
„Es ist erst halb drei.“
Im Kampf dieser Nacht hatte Thorsten sein Zeitgefühl verloren, doch nun verstand er Thies. Der Höhepunkt der Flut war für kurz nach vier vorhergesagt. Das Wasser würde noch mehr als eine Stunde lang weiter steigen.
Auf den eisglatten Wegen im Kaiser-Wilhelm-Koog stand das Wasser bereits mehrere Zentimeter hoch. Der Eisregen, die Löcher im Deich, das Grundwasser, es kam von überall. Die Männer gingen wie auf rohen Eiern zu ihren Fahrzeugen, jeder schrie in sein Handy, um so viele Menschen wie möglich zu warnen. Thies hatte über eine App bereits die höchste Alarmstufe aktiviert, doch bei vielen der Bauern reichte das nicht. Es reichte auch nicht, sie anzurufen. Man musste sie zwingen, ihre Höfe, ihre Felder, ihr Hab und Gut zurückzulassen. Thorsten sah nicht viel in der Dunkelheit, doch er wusste auch so, wo die Höfe standen, prachtvolle Häuser, Scheunen und Ställe. Wo die Felder lagen, mit dem Kohl, dem Getreide oder Gemüse. Wo die Wiesen waren, auf denen die Kühe und Schafe bei besserem Wetter grasten. Ihm wurde bewusst, dass man die Tiere nicht würde retten können. Die Wut kam.
Thorsten war Thies zum nächsten Hof am Deich gefolgt, selbst mit dem Handy am Ohr, um seine Eltern zu erreichen, doch er kam nicht durch. Thies stand jetzt vor dem Bauernhaus und sprach mit Niklas, dem der größte Schäfereibetrieb in Dithmarschen gehörte.
„Entweder du gehst jetzt“, appellierte Thies, „oder du wirst auf deinem Hof sterben.“
„Thies, das ist doch Wahnsinn!“, rief Niklas aufgebracht. „Du hast gesagt, der Deich wird halten.“
„Das ist lange her. Heute wird er nicht halten.“
Thorsten wusste genau, was Thies meinte. Wie konnte der Deichhauptmann so ruhig bleiben? Seit Jahren ermahnte er die Verwaltungen nah und fern, dass der Deich ausgebessert und aufgestockt werden musste. Dass man endlich den Schwachsinn mit dem Naturschutzgebiet vor dem Deich vergessen sollte, um das Land dahinter zu schützen. Aber den verdammten Ökos in Berlin und Kiel waren irgendwelche Vögel wichtiger als die Bauern. Einer dieser Bauern stand jetzt mit Tränen in den Augen vor ihnen und schüttelte verzweifelt den Kopf. Thorsten hatte lange nicht mehr solch eine Wut gespürt.
„Schick wenigstens deine Familie raus“, sagte Thies zu ihm. „Es können alle auf meinen Hof. Die Köge in zweiter Reihe sind sicher.“
Ein paar Kilometer in Richtung des Landesinneren gab es alte Deiche, die die Küste gebildet hatten, bevor dem Meer weiteres Land abgetrotzt worden war. Die Landstücke, die von den Deichen umfasst wurden, nannte man Köge. Die vorderen, wie der Kaiser-Wilhelm-Koog, waren nur über wenige Straßen zu erreichen. Diese führten durch Öffnungen in den alten Deichen, die bei einer Sturmflut mit Planken verschlossen wurden. Dadurch war das Land dahinter sicher. Allerdings bedeutete es auch, dass die Köge direkt am Meer bei einem Bruch vollliefen wie eine Badewanne.
„Du irrst dich!“, rief Niklas. „Der Deich wird halten.“
Er blickte zu der grünen Wand nur hundert Meter vor seinem Hof. Thies ging nicht darauf ein, denn er hatte eine Nachricht auf seinem Handy erhalten. Obwohl nur wenig Licht von der Lampe über der Haustür auf die Männer fiel, konnte Thorsten genau sehen, wie Thies beim Lesen der Nachricht zusammensackte.
„In Friedrichskoog-Spitze ist er gerade gebrochen.“
Das Unvorstellbare. Dort stand der neueste Deich, und auch wenn dieser von drei Seiten der Kraft der Sturmflut ausgesetzt war, hätte er niemals brechen dürfen. Thorsten schlug mit der Faust gegen die Hauswand. Der Schmerz wärmte ihn.
„Spar dir das auf“, sagte Thies zu ihm. „Ich brauche dich. Los, in meinen Wagen.“
Thorsten wurde gebraucht. Die Wut musste warten. Niklas eilte davon. Nicht ins Haus, sondern zu den Ställen, zu seinen Schafen.
Bauer Niklas war nicht der Einzige, der trotz der drohenden Katastrophe zuerst an seinen Besitz dachte. Die Nachricht vom Deichbruch an der Spitze des benachbarten Koogs half zwar, die Leute zur Flucht zu bewegen, doch kaum einer wählte den direkten Weg aus der Gefahrenzone. Überall wurden unwillige Schafe und Kühe in die Eiseskälte getrieben und Autos oder Traktoren mit allem beladen, was Wert hatte. Weinende Kinder saßen wartend in Jeeps, Bauersfrauen trugen Koffer aus den Häusern, ein junger Mann hatte sich einen Fernseher unter den Arm geklemmt und rannte zu seinem Wagen. Immer mehr Autos starteten, schlitterten über die vereisten Straßen, fuhren herumirrende Tiere an. Schon nach wenigen Minuten herrschte in der Dunkelheit gefährliches Chaos.
Der einzige Ruhepol war Thies Cordes. Ihm gehörte der größte Hof hier. Die anderen Bauern hatten ihn zum höchsten Wächter über die Deiche gewählt, er war der Dreh- und Angelpunkt in den Kögen von Süderdithmarschen. Auch in dieser furchtbaren Nacht. Er fuhr mit Thorsten systematisch die Höfe im bedrohten Kaiser-Wilhelm-Koog ab, informierte über Funk seine Helfer, welcher Bauer welche Hilfe benötigte, und wusste genau, wer noch nicht in Sicherheit war.
Thorsten telefonierte auf Thies’ Anweisungen mit so vielen Leuten, wie er trotz überlastetem Netz erreichen konnte. Thies versäumte es nicht, ihn daran zu erinnern, es wieder bei seinen Eltern zu versuchen. Diese wohnten zwar im südlich gelegenen Neufelderkoog, aber auch auf den dortigen Deich hackten die Eisschollen ein.
Während Thies mit einem waghalsigen Manöver über ein vereistes Feld bretterte, erreichte Thorsten endlich seinen Vater. Papa war wie immer der Fels in der Brandung, kochte Essen „für die hungrigen Helfer“. Ein Ritual der letzten Sturmfluten. Kochen war mehr als sein Beruf. Er war stolz auf das kleine Restaurant, das er im alten Hof seiner Eltern aufgebaut hatte, und wollte nicht akzeptieren, dass es damit vorbei war. Dass es mit allem vorbei war, was es in den Kögen an der Elbmündung gab. Er wollte schlichtweg nicht glauben, dass Friedrichskoog-Spitze bereits zwei Meter unter Wasser stand. Thorsten hörte die Stimme seiner Mutter.
„Was sagt er?“, rief sie aus dem Hintergrund.
„Gib sie mir“, raunte Thorsten seinen Vater an.
Papa zögerte. Er wusste genau wie sein Sohn, dass Mama in Panik verfallen würde. Doch zum ersten Mal wollte Thorsten genau das. Zum ersten Mal waren Mamas Ängste für etwas gut.
„Sag ihr, der Deich wird brechen. Und dass Thies das gesagt hat. Thies! Hörst du, Papa?“
Thies machte eine Vollbremsung und sprang aus dem Land Rover. Sie waren an einer Stöpe angekommen. Hier führte eine der wenigen Straßen durch den alten Deich aus dem Koog hinaus. Eigentlich musste die Stöpe nach Thies’ Warnmeldung sofort verschlossen werden. Der dafür zuständige Bauer Michel stand mit seinen Leuten auf der Straße und wollte gerade die Planken in die vorgesehene Führung schieben. Doch der Bauer Udo, der vor der Stöpe aus seinem Jeep gesprungen war, hinderte sie laut zeternd daran. Er wollte nicht zulassen, dass die letzte Straße geschlossen wurde. Udo wartete auf seine Söhne, die noch mit Traktoren und anderen Fahrzeugen hierher unterwegs waren. Michel beharrte jedoch darauf, seine Aufgabe zu erfüllen, musste sich beschimpfen lassen, von zwei Seiten wurde an einer Planke gezerrt. Thies ging auf den Unruhestifter zu und versetzte Udo ohne Vorwarnung eine Ohrfeige.
„Die Stöpen werden geschlossen“, sagte er mit ruhiger Stimme. „Was rausmuss, geht über den alten Deich. Was nicht über den Deich geht, bleibt zurück. Und jetzt reiß dich zusammen, Udo.“
Damit war die Sache geklärt, die Planken wurden angebracht. Udo begehrte nicht weiter auf, sondern entschuldigte sich. Nicht, weil Thies geltendes Recht umsetzte. Auch nicht, weil Thies Udo schon von Kindesbeinen an kannte und sein Trauzeuge gewesen war. Sondern einfach, weil es Thies war.
Thies verfügte auch deswegen über solch eine Autorität, weil er sich selbst nie schonte. Er fuhr mit Thorsten zurück in den bedrohten Koog, um weitere Bauern aus der Gefahrenzone zu holen. Die Familie von Bauer Gernot war mit dem Wagen in einen Graben geschlittert, Thorstens Freund Arthur rannte orientierungslos im Sturm herum. Thies’ Land Rover füllte sich nach und nach mit Leuten.
Während sich bereits Sturzbäche durch den Außendeich in den Koog ergossen, gab es immer noch sture Bauern, die nicht wahrhaben wollten, dass ihr Hof verloren war. Als Thorsten ein Stück der Deichkrone einsacken sah, standen sie mit Thies’ Wagen an einem der letzten beleuchteten Höfe, wo der Deichhauptmann auf den Bauern Andy einredete. Ein Junge, der mit seiner Familie auf dem Rücksitz saß, schrie auf, doch Thies hatte es bereits selbst gesehen.
„Der Deich bricht jetzt, Andy. Steig ein!“
Andy stieg nicht in den Land Rover, sondern ging auf den Deich zu, die Hände erhoben, als wolle er die gesamte Nordsee stoppen. Alles Schreien und Rufen, um ihn daran zu hindern, war erfolglos. Als der Fuß des Deichs nachgab und die Erdmassen nach unten rutschten, hatte Thies keine Wahl.
„Dieser verdammte Sturkopf!“, rief er, während Arthur im Land Rover flehte, dass Thies losfahren sollte.
Die Wassermassen überwanden mühelos das weggesackte Deichstück, rissen rechts und links auf mehr als hundert Metern das Erdreich mit und schossen in den Koog. Thies gab Gas, Andy war verloren. Der Bauer versuchte nicht zu fliehen, sondern schrie wie von Sinnen das Meer an, bis eine Wasserwand ihn von den Beinen riss und vor sein Haus schleuderte. Die letzten Lichter erloschen, die Wassermassen wurden zu einer dunklen Bedrohung. Thies jagte über die gefrorene Straße. Das Getriebe krachte beim Schalten, der Wagen brach hinten aus, aber Thies hielt den Fuß auf dem Gas und peitschte den Wagen voran. Mit ohrenbetäubendem Lärm rasten die meterhohen Fluten wie ein hungriges Ungeheuer hinter dem Land Rover her, fraßen alles auf, was ihnen in den Weg kam, und waren noch lange nicht satt. Im Rückspiegel konnte Thies sehen, wie das Tier nach ihnen griff. Der Junge auf dem Rücksitz schluchzte vor Angst.
„Es wird uns nicht kriegen“, sagte Thies und lächelte den Kleinen an.
Ein Lächeln, das den Jungen und auch alle anderen im Wagen beruhigte. Und tatsächlich, je weiter sie kamen, desto mehr verteilte sich das Wasser, es verlor seine Wucht und auch seine Höhe. Das Auto erarbeitete sich einen Vorsprung und erreichte bald den alten Deich. Thies fand eine etwas weniger steile Stelle und fuhr den Land Rover hoch auf die Deichkrone. Oben stoppte er und stieg aus. Auch wenn es den anderen nicht geheuer war, folgte Thorsten seinem Beispiel und stellte sich zu ihrem Anführer. Bald kam das Wasser. Es erreichte auf einer Breite von mehreren Hundert Metern mit deutlich reduzierter Kraft den Fuß des alten Deichs. Nun wirkte es nicht mehr ganz so beängstigend, doch der Pegel stieg schnell an. Es würde nicht aufhören, bevor der Koog vollgelaufen war.
„Wir brauchen Boote“, sagte Thies.
Als sie mit einem Boot von Thies’ Hof zum alten Deich zurückkehrten, stockte Thorsten der Atem. Das Wasser im Kaiser-Wilhelm-Koog befand sich schon auf der Hälfte der Deichhöhe. Gut zwei Meter, und es stieg weiter. Thies hielt sich damit nicht auf, löste das Motorboot von seinem Anhänger und hob es zusammen mit Thorsten ins Wasser.
Thies hatte zahllose Nachrichten und Anrufe erhalten, darum wusste er genau, wer noch fehlte. Er startete den Motor, fand trotz der nun fehlenden Straßen den Weg und steuerte im Licht ihrer Taschenlampen zu einem Hof, auf dessen Dach Bauer Jonte und seine Frau zitternd ausharrten. Thies half ihnen ins Boot, versorgte sie mit Decken und Tee aus einer Thermoskanne.
Während sich das Boot mit weiteren Gestrandeten füllte, kamen die Nachrichten über Funk. Erst erfuhren sie, dass der Deich bei Neufelderkoog gebrochen war. Die Menschen hatten zwar etwas mehr Zeit zur Flucht gehabt, aber auch dort spielten sich dramatische Szenen ab. Niemand konnte sagen, ob Thorstens Eltern rechtzeitig rausgekommen waren, ihre Handys waren ausgeschaltet. Thorsten sah im funzeligen Licht seiner Lampe die Blicke der anderen. Sie bedauerten ihn, dabei hatten sie gerade alles verloren. Am liebsten wäre Thorsten ins Wasser gesprungen und nach Hause geschwommen, doch Thies brauchte ihn. Sie waren viel zu wenige. Wo war die verdammte Bundeswehr? Wieder einmal wurden sie im Stich gelassen. Die Wut.
Schon kam der nächste Funkspruch. Ein paar durchgedrehte Bauern hatten die Planken an einer Stöpe eingeschlagen. Sie wollten verhindern, dass das Wasser im Kaiser-Wilhelm-Koog einfror, was jede Hoffnung auf eine Rettung ihrer Tiere und Höfe endgültig zunichtemachen würde. Doch damit zogen sie den Koog in zweiter Reihe mit in die Katastrophe. Nun lief auch der Kronprinzenkoog voll, wenn auch nicht mit derselben Wucht und einem solch hohen Wasserstand. In diesem Koog befand sich Thies’ Hof. Doch der Bauer verzog keine Miene. Während er das Motorboot weiter Richtung Süden steuerte, rief er seine Frau Beeke an und gab ihr Anweisungen zum Schutz der Gebäude. Die Menschen in Neufelderkoog brauchten ihn.
In ihrem Boot saßen jedoch längst mehr Personen, als es tragen konnte. Thies wollte die frierenden Bauern zu einem höher gelegenen Hof bringen, wo er einen Sammelpunkt für Gestrandete hatte einrichten lassen. Stille überkam die Schicksalsgemeinschaft im Boot, während sie durch die Nacht und den nicht nachlassenden Regen fuhren. Ein jeder wurde sich seiner aussichtslosen Situation bewusst, dachte an den Verlust, die Ungewissheit, das Schicksal von Freunden und Verwandten. Thorsten versuchte noch einmal, seine Eltern zu erreichen. Vergeblich.
„Das ist nicht das Ende, Leute“, sagte Thies. „Das Wasser wird zurückgehen. Wir werden alles wieder aufbauen. Wahr di, Garr, de Bur de kummt!“
Pass auf, Garde, der Bauer kommt – er sprach die alte Dithmarscher Parole mit solch einer Zuversicht aus, dass die anderen sie wiederholten. Ein Bauer nach dem anderen. Auch Thorsten.
Kurz vor ihrem Ziel flackerte hundert Meter weiter eine Taschenlampe auf dem Wasser. Holm, ein Berg von einem Mann und Thies’ rechte Hand auf seinem Hof, war ebenfalls auf Rettungsmission unterwegs. Er hatte irgendwo ein altes Kanu aufgetrieben, das sich mit ihm und zwei Geretteten gerade noch über Wasser hielt. Vorsichtig paddelte er damit durch den neu entstandenen See. Obwohl Thies’ Boot bereits überfüllt war, forderte der Deichhauptmann die anderen auf, zu ihnen zu klettern.
„Wir bleiben besser im Kanu!“, rief Holm.
„Nein“, entgegnete Thies. „Du gibst das Kanu Thorsten. Er muss nach seinen Eltern schauen.“
Thorsten sprang wie entfesselt auf. Er spürte tiefe Liebe für Thies.
„Aber wir passen nicht alle in dein Boot“, sagte Holm.
„Doch“, erwiderte Thies und sprang ins Wasser. „Du steuerst, ich halte mich hier fest. Los, es ist kalt.“
Damit ließ er niemandem eine Wahl. Thorsten kletterte ins Kanu, während dessen Insassen ins Motorboot stiegen, das bedrohlich schwankte.
„Danke“, stieß Thorsten ergriffen hervor.
„Paddel los! Finde sie!“
Thorsten tat, wie ihm geheißen, während Holm mit dem Motorboot den Innendeich ansteuerte, um Thies keine Sekunde zu lang im eisigen Wasser lassen zu müssen.
Thorstens Weg führte in die andere Richtung. Schon bald verstummte das Geräusch des Motorboots hinter ihm, und die Lichter verblassten im Regen. Thorsten paddelte durch die Nacht. Er hörte nur noch den Wind und das Plätschern der Wellen. Plötzlich stieß er mit dem Paddel irgendwo an. Er schaltete seine Taschenlampe ein. Im Wasser trieb ein totes Schaf, direkt daneben noch eins. Er leuchtete die Umgebung ab und entdeckte immer mehr Schafe. Eine ganze Herde war im kalten Wasser verendet, keine halbe Stunde hatten sie überlebt. Er paddelte mit aller Kraft weiter, fühlte sich, als wäre er in einem Albtraum unterwegs. Obwohl er wusste, dass es nicht möglich war, sah er das Wasser unaufhaltsam steigen, er sah, wie die gesamte Nordsee sich in die kleinen Köge ergoss, Menschen und Tiere in die Tiefe zog. Wie die Welt zerstört wurde, die sein Leben gerettet hatte.
Sie waren erst vor vier Jahren an die Nordsee gezogen. Papa hatte den Hof geerbt und ihn widerwillig angenommen, weil sein Restaurant in Dortmund pleitegegangen war. Thorsten hatte damals als Teenager nicht zu den Bauern ziehen wollen, raus aus der Großstadt, an ein Meer, das er wegen der Deiche nicht einmal sehen konnte. Doch am Ende war der Umzug das Beste gewesen, was ihm je geschehen war. Denn er hatte Thies kennengelernt.
Deichhauptmann Thies war ein alter Freund seiner Eltern, hatte schnell erkannt, wie verloren Thorsten war, und ihm einen Job auf seinem Hof angeboten. Damals hatte Thorsten eine Menge Probleme mitgebracht. Die Sache mit den Drogen, die Aggressionen, die Wut auf die Welt, die den Bach runterging. Mit all diesen Dingen war er vor Thies gelaufen wie vor eine Wand. Der Mann hatte ihn zerschmettert und neu zusammengesetzt.
Dann hatte Thorsten Alina kennengelernt. Eine Wahnsinnsfrau, bei der er Mann sein konnte. Sie hatten davon geträumt, zusammenzuziehen, den Hof von Thorstens Vater zu bewirtschaften, während dieser sich um sein Restaurant kümmerte. Thorsten, der einsame Cowboy, der coole Aufreißer, hatte sich plötzlich als Bauer gesehen, mit Frau und Kindern, und es war eine großartige Vorstellung gewesen. Doch jetzt war alles anders. Es gab keinen Hof mehr.
„Das ist nicht das Ende“, flüsterte Thorsten und zog noch einmal das Tempo an.
Er sah die Gestalten auf dem Scheunendach schon von Weitem. Die kompakte Statur seines Vaters und die zierliche Figur seiner Mutter, die unruhig auf dem Dach hin und her lief. Thorstens Herz schlug schneller.
„Es ist Thorsten!“, rief sein Vater. „O mein Gott.“
Thorsten fand neue Kraft in seinem frierenden Körper, paddelte wie wild zur Scheune und kletterte auf das Dach. Er umarmte seine Mutter vorsichtig. Sie wirkte wie eine Eisskulptur, jegliche Körperwärme war aus ihr entwichen. Mit zitternden Lippen schaffte sie es dennoch, sich über ihren Mann aufzuregen: „Er musste noch sein Messerset einpacken.“ Natürlich hatte Papa die Bedrohung nicht ernst genommen, hatte versucht zu retten, was zu retten war. Er war in dieser Nacht nicht allein damit.
„Tut mir leid“, stieß Papa gequält hervor. „Nicht streiten. Wir müssen ins Warme.“
Papa kletterte zuerst ins Kanu, dann halfen die Männer Mama hinein. Als Thorsten ebenfalls wieder einstieg, sank der Bootsrand fast bis auf Wasserhöhe. Sie mussten äußerst vorsichtig paddeln, denn jedes Schwanken konnte zum Kentern führen. Thorsten saß vorne und hörte das Klappern von Mamas Zähnen hinter sich. So erleichtert er gewesen war, sie zu sehen, so sehr hatte er nun Angst um sie.
Der Weg zum Innendeich schien endlos. In der Ferne, tief im Koog, sahen sie Lichter, eine Rettungsaktion vielleicht, doch man wurde nicht auf das Kanu aufmerksam. Endlich Licht vor ihnen. Ein Hof im benachbarten Kronprinzenkoog. Es gab noch Strom, die Überschwemmungen mussten sich dort in Grenzen halten. Vielleicht war Thies auf diesem Hof. Thorsten spürte Hoffnung, doch weil er zu lange zu dem Licht schaute, achtete er nicht mehr darauf, wo sie entlangfuhren. Vielleicht hätte er den Traktor unter Wasser auch gar nicht sehen können. Dafür hörte er, wie das Metalldach des Fahrzeugs den Boden des Kanus einriss. Wasser drang ein, Papa fluchte, Mama war beängstigend still. Thorsten paddelte, so schnell es ging, doch es dauerte nur wenige Sekunden, bis ihr Kanu sank. Thorsten sprang ins Wasser. Die Eiseskälte durchfuhr ihn wie ein Stromstoß. Er versuchte, mit den Füßen den Boden zu erreichen, doch das Wasser stand viel zu hoch. Er konnte seine Mutter nicht vor dem Kälteschock bewahren. Papa drehte das löchrige Kanu um, und gemeinsam hoben sie Mama darauf. Sie sprach nicht mehr, obwohl ihre Augen noch geöffnet waren.
„Los!“, rief Papa.
Thorsten schwamm vorne, zog das Kanu mit Mama hinter sich her, Papa drückte von hinten. Nach einigen Metern ließ der Druck nach. Papa hatten den Anschluss verloren, bewegte sich mühsam im Wasser.
„Bring sie zum Ufer“, keuchte er. „Ich komm nach.“
„Nein!“, protestierte Thorsten, dem die Erschöpfung in Papas Stimme Angst machte.
„Bin direkt hinter euch. Schwimm, Thorsten! Schwimm!“
Thorsten schwamm. Er hatte keine Kraft mehr, er war ausgelaugt, erschöpft, müde. Doch er hatte die Wut. Sie trieb ihn an. Die Wut auf all die Menschen, die sie im Stich gelassen hatten. Die Banken in Dortmund, die Psychologen seiner Mutter, die Drogencops, die Fluthelfer der Bundeswehr, die Regierung. Ganz besonders diese verdammte Regierung, die einem immer wieder erzählte, was man tun und lassen sollte. Wo waren sie alle, die Besserwisser und Paragrafenfresser, jetzt, da er im eiskalten Wasser um das Leben seiner Mutter kämpfte? Keiner interessierte sich einen Scheiß für ihn. Nur Thies. Der Gedanke an den Hauptmann gab Thorsten auch jetzt den entscheidenden Schub. Thies führte Thorstens eiskalte Hände zu Armzügen durchs Wasser, noch mehr als die Wut. Thies rettete ihn.
Thorsten sah den Deich, bald spürte er Boden unter den Füßen. Er hatte es geschafft. Mit dem Kanu hinter sich watete er die Böschung hoch, raus aus dem Wasser. Er zog es auf den festen Boden. Mama atmete laut aus. Thorsten sah Lichter im nächsten Koog, Taschenlampen, er schrie um Hilfe, die Lichter schwenkten in seine Richtung.
„Wir kommen!“
Es war Thies. Natürlich. Sie waren gerettet.
„Hol deinen Vater“, flüsterte Mama.
Wo war Papa? Er war doch hinter ihm geschwommen, Thorsten hatte das Platschen und Schnaufen gehört. Doch nun sah er ihn nicht mehr in der Dunkelheit, er sah ihn auch nicht, als er mit seiner Lampe leuchtete. Er sah nur schwarzes Nass.
„Papa!“, rief er und eilte los.
Er watete zurück ins Wasser, leuchtete umher, rief nach seinem Vater. Woher waren sie gekommen? Wo war Papa? Wertvolle Minuten verrannen, Thorsten wurde heiser vom Schreien, watete, suchte. Dann entdeckte er einen Schatten am Ufer. Etwas lag dort, umspült vom Wasser, unbeweglich, stoisch. Thorsten leuchtete darauf. Der Körper seines Vaters, zusammengerollt wie ein Stein. Wie ein Fels in der Brandung. Thorsten rannte zu ihm und kniete sich hin, leuchtete Papa ins Gesicht, in die starren Augen, in denen das Leben untergegangen war.
Acht Monate später
19. Oktober 2029
KAPITEL 1
Sie tanzten. Lara minimalistisch, dafür exakt im Rhythmus. Erst noch zu sehr mit dem Kopf, doch schließlich gab sie sich der Musik hin. Selten konnte sie so gut loslassen wie beim Tanzen.
Alina tanzte mit Hüftschwung und geschlossenen Augen, warf wild die Arme um sich. Dann öffnete sie die Augen und blickte Lara lächelnd an, ein kurzes Fragezeichen, die ewige Suche nach der Bestätigung, dass alles gut war.
„Die wollen hier ihren eigenen Staat gründen“, schrie Alina gegen die Bässe an.
Lara musste unwillkürlich lachen.
„Was ist das schon wieder für ’n Quatsch?“
Alina war getroffen. Mit zwei Schritten entfernte sie sich von Lara, begann auf der Stelle zu hüpfen und den Kopf hin und her zu werfen. Ihr Kleid wippte im Takt, ein Träger rutschte von der Schulter, es war Alina egal. Sie tanzte sich etwas von der Seele. Lara sah im Stroboskoplicht den Schweiß auf Alinas Stirn. Die langen schwarzen Haare formten bei jedem Flackern eine neue wilde Frisur. Laras Haare waren genauso lang, aber zu einem Pferdeschwanz gebunden. Und sie waren blond.
Salz und Pfeffer hatte Mami sie genannt.
Jede Tochter hatte die Haar- und Augenfarbe des jeweiligen Vaters, sogar die Statur – die dreiundzwanzigjährige Alina mit ausgeprägten Rundungen, die acht Jahre ältere Lara schlank und drahtig –, doch das markante Gesicht mit den kleinen Augen und dem harten Kinn stammte bei beiden von der gemeinsamen Mutter. Genau wie der Musikgeschmack. Deutscher Hip-Hop aus den Neunzigerjahren, den die jungen Frauen mit den glücklichsten Momenten ihrer Kindheit verbanden. Mami tanzend, Mami singend, Mami glücklich. Die meisten Dates von Lara verstanden ihre Begeisterung für diese alte Musik nicht, doch mit Alina war sie in dieser Frage eins.
„Schüttel deinen Speck“, sang Peter Fox, und Alina folgte der Aufforderung.
In anderen Fragen war Lara mit ihr nicht eins. Eigentlich in fast allen. Ihre Lebensentwürfe hätten nicht verschiedener sein können. Während Lara sich selbst genügte, die Anonymität der Großstadt schätzte und in jeglicher Hinsicht eine Einzelkämpferin war, wurde Lara von obskuren Gruppen, die ihr Heimat und familiäre Wärme vorgaukelten, angezogen wie eine Motte vom Licht.
„Jetzt mal ohne Scheiß!“, rief Alina. „Bald kann jeder seinen eigenen Hof haben. Mit Land, Tieren, Geräten. Hier sind wunderschöne Höfe frei.“
„Sie sind nicht ›frei‹“, ging Lara dazwischen, doch Alina kam gerade erst in Fahrt.
„Wenn du jetzt kommst, kannst du dir den besten aussuchen.“
„Alina!“
„Du kannst doch nicht für immer in dieser abgefuckten Stadt abhängen. In deinem Tigerkäfig. Hier ist alles grün, das Meer liegt vor der Tür, hier laufen Rehe frei rum. Rehe!“
„Alina“, versuchte Lara es erneut. „Ich hab ein Leben. Freunde, einen Job …“
„Du könntest hier arbeiten“, unterbrach Alina. „Wir brauchen dringend ’ne Krankenpflegerin. Medizinische Versorgung fehlt komplett. Sagt der Hauptmann immer wieder. Mit Kusshand würden die dich nehmen.“
So vehement hatte Alina noch nie versucht, Lara das Leben an der Nordsee schmackhaft zu machen.
„Ich bin glücklich in Berlin.“
„Wir wären zusammen!“
Alina tanzte nicht mehr. Sie stand direkt vor Lara und blickte sie viel zu ernst an. Eine Mischung aus Vorwurf und Verzweiflung.
„Ist alles in Ordnung bei dir?“, fragte Lara.
„Meinst du, ich vermisse dich nur, wenn ich ein Problem hab?“
„Das habe ich nicht gesagt.“
„Die doofe Kleine kriegt’s wieder nicht gebacken. Wohnt mit irgendwelchen Verrückten zusammen. Und mit einem Mann, der ihr nicht guttut.“
„Was ist mit Thorsten?“, fragte Lara.
„Nichts!“, rief Alina. „Hörst du mir überhaupt zu? Ich will dich bei mir haben, weil ich dich endlich wieder … aber du … Ach!“
Alina griff sich unwirsch an den Kopf und war im nächsten Moment verschwunden.
„Alina!“, rief Lara, auch wenn sie wusste, dass es vergeblich war.
Lara zog ebenfalls die Brille vom Kopf. Die virtuelle Tanzfläche und die Discokugel an der Decke verschwanden, die Musik verstummte. Lara stand mitten in der Wohnküche ihres Tigerkäfigs. Dort, wo gerade noch die Holoportation von Alina getanzt hatte, war jetzt nur der kleine Esstisch, der mangels Gästen die meiste Zeit als Schreibtisch diente. Lara setzte sich an den Computer. Die Verbindung zu Alina in Dithmarschen war längst getrennt. Lara schaltete die Kameras aus, die in allen vier Ecken des Raumes angebracht waren, und kappte sämtliche Verbindungen ins Internet.
Dann versuchte sie es mit dem Telefon. Obwohl sie wusste, dass auch dies vergeblich war. Alina würde mindestens eine Nacht brauchen, um sich zu beruhigen. Tatsächlich war ihr Handy ausgeschaltet. Eigentlich alles nichts Neues, dennoch witterte Lara Probleme. Etwas stimmte nicht im neuen „Staat“, und das überraschte Lara in keiner Weise.
Zwei Stunden später, auf dem Weg zur Nachtschicht, versuchte Lara es noch einmal. Es war ein lauer Oktoberabend, darum fuhr sie mit dem Fahrrad. Die Radwege waren überfüllt, sexy gekleidete Menschen unterwegs in den Freitagabend. Ausgehen, Freunde treffen, vielleicht tanzen. Lara mochte die Stimmung an diesen Abenden am Ende eines viel zu heißen Sommers, die pulsierende Metropole, die Lichter der Bars, das Lachen aus den Biergärten. Niemals würde sie das alles aufgeben.
Alinas Handy war wieder eingeschaltet, aber sie ging nicht ran. Sollte sie Thorsten anrufen? Alina hatte ihr einmal seine Nummer gegeben. „Für alle Fälle.“ War das einer dieser Fälle? Sie kannte Thorsten nur von zwei oder drei virtuellen Begegnungen, bei denen Alina ihn zu einem Treffen der Schwestern mitgebracht hatte. Auf den ersten Blick ein gut aussehender, charismatischer Kerl mit einem sympathischen, lauten Lachen. Doch Lara hatte die Brutalität in seinem Blick gesehen, die unterdrückte Aggression. Die Art, wie er Laras Körperbau ausgecheckt hatte, verhieß nichts Gutes. Ein Jäger, immer auf der Pirsch, auch wenn er mittlerweile seit mehr als einem Jahr mit Alina zusammen war. Ihre längste Beziehung, seine wohl auch. Angeblich war es die große Liebe, was immer das heißen sollte.
Seinetwegen war Alina an die Nordsee gezogen, im Frühjahr nach der großen Flut, als Thorsten seinen eigenen Hof erhalten hatte. In einem Gebiet, das man eigentlich aufgegeben hatte, das einige Wochen zuvor endgültig geräumt werden sollte. Doch eine ganze Reihe von Bauern unter der Führung des sogenannten Hauptmanns weigerte sich, trotz Entschädigung ihr Land zu verlassen, baute allein alles wieder auf, auch die gebrochenen Deiche. Alina war Teil einer Gemeinschaft geworden, die von konservativen Männern bestimmt wurde, von einem Patriarchat in Reinform mit einem Führer, dessen Wort bedingungslos galt. Lara schauderte bei den Erinnerungen an Alinas begeisterte Berichte darüber, wie klar die Verhältnisse in Dithmarschen waren, wie stark die Kameradschaft. Wie so oft hatte Laras kleine Schwester sich einer Sache mit Haut und Haaren verschrieben, deren gefährliche Seite sie nicht sehen wollte. Wie als Jugendliche der Drogenszene in Freiburg, wie vor einigen Jahren einer radikalen Umweltsekte in Spanien. Heute waren es die Bauern in Dithmarschen, die jetzt auch noch ihren eigenen Staat gründen wollten.
Lara musste bei dem Gedanken erneut lachen, während sie in die Friedrichstraße bog. Sie interessierte sich nicht für Politik, hatte noch nie gewählt, weil es in ihren Augen eh keinen Unterschied machte, wer die Missstände verwaltete. Die aktuelle Regierung war keine Ausnahme, stolperte von einer Krise in die nächste, aber selbst diese Politiker würden sich nicht von ein paar Dutzend Bauern einen eigenen Staat abtrotzen lassen. Alina stand vor einer weiteren Enttäuschung in ihrem Leben.
Der Dienst in der Notaufnahme des größten Berliner Krankenhauses war nie entspannt, schon gar nicht an einem Freitagabend, aber in dieser Nacht stapelten sich die Patienten. Zu den üblichen Kindern mit hohem Fieber und besorgten Eltern, den bewusstlosen Obdachlosen, den Herzinfarkten und Schlaganfällen kamen reihenweise meist unter Alkoholeinfluss verunglückte Radfahrer, Opfer von Messerstechereien und natürlich die Drogenexzesse. Sei es mit Kokain, MDMA oder mit der neuen Droge Shi, einer Speed-Variante, die angeblich dem Körper nicht schadete, aber auch nicht verhinderte, dass überdrehte Kerle sich in Prügeleien oder gleich aus dem Fenster stürzten. Lara musste zweimal Blutreserven holen, um Herrin der Lage zu werden. Der Höhepunkt war zweifelsohne, als ein Junkie sich mit einem der Serviceroboter anlegte und ihn verprügeln wollte. Das arme Gerät erklärte geduldig, dass es für „diese Art von sportlicher Betätigung nicht ausgestattet“ sei, dennoch gab der Aggressor erst Ruhe, als Lara den Sicherheitsdienst einschaltete. Auch ältere Scheinpatienten tummelten sich im Wartebereich, so nannten sie die Frauen und Männer, die nichts Gravierendes hatten, sondern einfach mal jemand anderes sehen wollten als ihren Pflegeroboter. Die Fortschritte in der Medizin spiegelten sich zunehmend in einer höheren Lebenserwartung wider, doch was nützte das, wenn man am Ende noch ein paar Jahre länger allein zu Hause saß?
Die Charité bei Nacht führte einem die Schatten der Großstadt vor. Ein Panoptikum der körperlichen und seelischen Gebrechen, die durch das rasante Bevölkerungswachstum, die urbane Anonymität sowie die Perspektivlosigkeit im Zeitalter der Umweltkatastrophen befeuert wurden. Allein drei Selbstmordversuche wurden während Laras Schicht eingeliefert, und das waren nur die, die sich ernsthaft verletzt, aber keinen Erfolg gehabt hatten. Trotz alldem konnte Lara sich nicht vorstellen, irgendwo anders zu leben. Nur hier konnte sie so sein, wie sie war, musste sich niemandem anpassen, wurde in Ruhe gelassen, war frei.
Die Arbeit ließ ihr allerdings selten eine freie Minute, in dieser Nacht schon gar nicht, sodass es bereits Morgen war, als sie zum ersten Mal auf ihr privates Handy schaute. Ihre Schwester hatte kurz vor Mitternacht angerufen und eine Nachricht hinterlassen.
„Hey, hi, Lara …“
Kurze Pause, schnelles Atmen, Alina ging es nicht gut.
„Hm, hier … hier ist was so richtig schiefgelaufen. Ich … Scheiße!“
Panik in der Stimme. Abrupt brach die Verbindung ab. Lara rief zurück, doch Alinas Handy war ausgeschaltet. Lara hinterließ ebenfalls eine Nachricht und hatte von da an für den Rest der Schicht keine Ruhe mehr, auch wenn der Ansturm der Notfälle nachgelassen hatte. Sie versuchte sogar, Thorsten anzurufen, dessen Telefon jedoch ebenfalls ausgeschaltet war. Es gab keinen weiteren Anruf, keine Nachricht und auch keine sonstige Regung von Alina. Was auch immer Laras Schwester dazu bewogen hatte, „Scheiße“ zu rufen, hatte sie von der Welt abgeschnitten.
Als Lara im Licht der aufgehenden Sonne nach Hause radelte, wusste sie, dass Alina in Not war. Nicht zum ersten Mal. Und ebenfalls nicht zum ersten Mal war Lara nicht für ihre kleine Schwester da gewesen.
Nach der nächsten Nachtschicht hatte Lara drei Tage frei. Den halben Sonntag schlief sie, dann spielte sie ihr liebstes Virtual-Reality-Spiel, abends ging sie aus. Eigentlich wollte sie sich einen heißen Typen oder eine aufregende Frau aufreißen, aber als sie in ihrer Lieblingsbar saß, konnte sie sich nicht auf das Angebot konzentrieren. Ihre Gedanken kreisten um Alina. Sie hatte ein paarmal versucht, ihre Schwester zu erreichen, aber vergeblich. Auch Thorsten reagierte nicht. Mehr Leute kannte Lara in der Gegend nicht. Sie wusste nicht einmal, wo genau sich der Hof befand, auf dem Alina lebte. Sie erinnerte sich an den Begriff „Koog“, doch ein Blick auf die Karte zeigte ihr, dass es dort zahlreiche Köge gab. Es war die Bezeichnung für ein Gebiet, umgeben von Deichen, das einst dem Meer abgetrotzt worden war.
Die Köge in dieser Gegend hätten eigentlich aufgegeben werden sollen, doch ein paar Bauern hatten sich dort festgesetzt. Unter ihnen Thorsten, der irgendwie mit dem „Hauptmann“ vertraut war, von dem Alina immer nur mit ehrfurchtsvoller Stimme sprach. Dabei handelte es sich um den obersten Deichschützer der Region. Er hatte eine Gruppe von knapp achtzig Bauern mit ihren Familien angestiftet zu bleiben. Im Internet war zu lesen, dass von ehemals viertausend Einwohnern der Region noch zweihundert übrig geblieben waren, die sich an ihr Land klammerten. Die wenigen Medien, die über diese Bauern berichteten, gingen davon aus, dass sie bald aufgeben würden. Offensichtlich ahnte niemand, was Alina so aufgeregt verkündet hatte: dass die verbliebenen Bauern auf einer Fläche von gut hundert Quadratkilometern, so groß wie der Berliner Bezirk Pankow, ernsthaft einen eigenen Staat gründen wollten. Wobei in Pankow fünfhunderttausend Menschen lebten statt zweihundert.
Auch in der Kreuzberger Bar durchforstete Lara mit ihrem Handy das Internet nach Berichten über die Rebellen in den Kögen. Dabei stieß sie auf ein Video mit dem Titel „Durchgedrehte Bauern verprügeln Kamerateam“. Ein Journalist suchte auf einem Bauernhof nach Gesprächspartnern, um über den eigenmächtigen Wiederaufbau in Dithmarschen zu reden. Plötzlich stand eine Handvoll Männer vor ihm, Hass im Blick, die Fäuste geballt. „Filmen verboten!“, schrien sie. Die Situation eskalierte binnen Sekunden, bald sah man aufgrund der verrissenen Kamera kaum noch etwas. Dafür hörte man rassistische Beleidigungen gegen den schwarzen Reporter, man hörte Schläge und Schreie. Als Letztes sah man einen stoischen, ruhigen Hünen, der direkt in die Kamera schaute, sie wahrscheinlich selbst hielt. „Wir wollen hier keine Lügenpresse. Wir wollen hier keine Fremden. Kapiert das endlich!“
Lara war bewusst gewesen, dass Alina sich nicht bei Pfadfindern aufhielt, doch das Ausmaß an Hass und Gewaltbereitschaft schockierte sie. Hass gegenüber Fremden. Und Alina war eine Fremde. Natürlich stand sie unter Thorstens Schutz, aber wenn es mit ihm ein Problem gab, war sie solchen Männern ausgeliefert. War genau das passiert?
„Was guckst du denn da Schönes?“, unterbrach jemand ihre Gedanken.
Vor ihr stand ein gut aussehender Kerl Ende dreißig. Er grinste Lara selbstbewusst an, unter normalen Umständen ein Kandidat für eine wilde Nacht. Doch ihr eigenes Desinteresse machte Lara nur noch mehr deutlich, dass all die Anrufe und Recherchen im Internet nicht genug waren. Lara musste an die Nordsee fahren und nach Alina suchen. Und vorher musste sie wenigstens ein paar Stunden schlafen. Allein.
KAPITEL 2
Es war noch dunkel, als Lara die Stadtgrenze hinter Reinickendorf passierte. Der kleine Elektro-Zweisitzer, der zu dem Fuhrpark ihres Wohnblocks gehörte, rollte lautlos über den Asphalt. Mehr als hundert Stundenkilometer gab das Stadtauto nicht her. Immerhin war die Batterie bis zum Anschlag geladen, was locker für die knapp vierhundert Kilometer bis hinter Brunsbüttel reichen würde. Während sie den Wagen zu den Klängen der Fanta 4 Richtung Nordwesten steuerte, machte Lara einen Plan für ihre Suche.
Bei einer virtuellen Begegnung vor einigen Monaten hatte Alina gerührt von dem Wiederaufbau ihrer Scheune berichtet, bei dem die anderen Bauern geholfen hatten. Sie hatte Lara ein Selfie geschickt, auf dem sie mit roten Wangen stolz auf dem First der Dachkonstruktion stand und in die Kamera strahlte, den Sonnenuntergang sowie den Deich und einen kleinen Hain mit blühenden Linden im Rücken. Lara hoffte, mithilfe dieses Fotos Alinas Hof in den Kögen am Meer zu finden. Natürlich wollte sie nicht so enden wie die Journalisten in dem Video, also musste sie vorsichtig vorgehen, Kontakt zu den Einheimischen meiden, Gesprächen ausweichen. Theoretisch konnte sie sich natürlich auch um einen Hof bewerben. Doch das erschien Lara lebensgefährlich.
Denn weitere Recherchen auf dem Bordcomputer ihres eCars zeigten deutlich, was für Menschen sich um den von Alina angehimmelten Hauptmann scharten: sture Bauern, die in den letzten Jahren einen glühenden Hass auf die Regierung entwickelt hatten. Die Pandemie, die Kriegsflüchtlinge, dann die Klimaflüchtlinge, die Wasserknappheit im ganzen Land – all das hatte zu Einschränkungen geführt, die diese Leute wütend gemacht hatten, wütend auf „die da oben“, auf moderne Großstädter wie Lara, auf die Lügenpresse. Und dann war die Flut gekommen.
Die Überschwemmungen hatten auch andere Küstenregionen getroffen, doch das südliche Dithmarschen am härtesten. Mehr als fünfzig Menschen hatten den Tod gefunden. Die Deiche waren an so vielen Stellen gebrochen, die Zerstörung durch die anhaltenden Regenfälle und den Frost so umfangreich gewesen, dass die Regierung beschlossen hatte, das Gebiet aufzugeben. Auch wenn man von einer „Jahrtausendflut“ sprach, waren sich die Experten einig, dass ähnliche Ereignisse bald die Regel sein würden und man die weiter landeinwärts gelegenen Städte, besonders Hamburg, besser schützen musste. Die verlassenen Köge sollten in Zukunft als Pufferzone bis zum Meer dienen und in der Sommerzeit zu einem Naherholungsgebiet für die Metropolregion Hamburg umgebaut werden. All das machte die vor Ort verbliebenen Bauern fuchsteufelswild. Sie fühlten sich betrogen und erneut im Stich gelassen, auch wenn man ihnen finanzielle Entschädigungen und neues Land fernab des Meeres angeboten hatte. Sie schoben auch die Schuld an den Deichbrüchen auf die Regierung, die es ihrer Ansicht nach durch fehlende Investitionen versäumt hatte, die Köge zu schützen, und stattdessen überflüssige Naturschutzgebiete einrichtete. Dass die Erderwärmung, der dadurch rasant steigende Meeresspiegel und die immer heftigeren Unwetter das eigentliche Problem waren, wurde verdrängt. Man steigerte sich lieber in Verschwörungstheorien hinein.
So verbreiteten die Bauern, unterstützt von der rechtspopulistischen Partei, gerne die Theorie, dass man sie absichtlich hatte absaufen lassen. Als „Beweis“ dafür nannten sie die fehlende Hilfe der Bundeswehr in der Schicksalsnacht, die jedoch klar erkennbar daher rührte, dass an zahlreichen weiteren Stellen an Elbe und Nordsee schon tagsüber Deiche gebrochen waren und jeder verfügbare Helfer längst bis zur Erschöpfung gegen die Fluten gekämpft hatte. Aufgrund dieses Gebräus aus Lügen und Unterstellungen sahen die Bauern es als ihr Recht an, die Köge nicht zu verlassen. Zwar zogen die meisten der viertausend Einwohner der Region friedlich und einsichtig weg, doch zweihundert von ihnen blieben in den Kögen zurück.
„Unsere Urahnen haben ihr Leben gegeben, um uns hier eine Lebensgrundlage zu schaffen“, erklärte ein älterer Bauer in einem Interview. „Wir haben Jahrzehnte für dieses Land geschuftet. Unsere Liebsten sind in der Flut für die Höfe gestorben. Wir würden sie entehren, wenn wir alles aufgeben, damit die Hamburger im Sommer surfen können. Uns bekommt hier keiner weg.“
Er klang nordisch unterkühlt, aber seine Augen funkelten vor wütender Entschlossenheit. Abgesehen von dieser Aufzeichnung und dem Video mit dem verprügelten Reporter, gab es nur wenig Bildmaterial aus dem besetzten Gebiet. Die Gewaltandrohung gegen Journalisten funktionierte. Dass es selbst vom Hauptmann keine Fotos gab, nur hier und da ein schriftliches Statement von ihm in seiner Funktion als Deichschützer, war allerdings schon ungewöhnlich. Die Leute waren noch weniger im Internet präsent als Lara, und die hatte dafür hart gearbeitet. Sie vermutete, dass die renitenten Bauern einfach noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen waren. Die Blut-und-Boden-Rhetorik, die manchmal auch bei Alina durchklang, erinnerte darüber hinaus an eine Zeit vor knapp hundert Jahren. Lara hatte Respekt davor, was sie in Dithmarschen erwartete.
Zunächst einmal erwartete sie jedoch ein endloser Blick, der ihre Seele beruhigte. Sie fuhr bei strahlend blauem Himmel über den neuen Deich und hatte freie Aussicht auf das verlassene Land und die Elbmündung dahinter. Die neue Deichlinie lag vor der Kleinstadt Marne; hier entstand ein moderner Naturdeich, der für die Ewigkeit gedacht war. Ein fast gerade verlaufender Deich, der leichter zu schützen war als die alte kurvenreiche Linie. Er stieg zudem deutlich flacher an als frühere Deiche. In Richtung Meer führte eine lang gezogene Fläche mehrere Meter in die Höhe. Ein Wunderwerk der Technik, dessen Errichtung auch noch günstiger war als die von früheren Bauten. Der Deich bestand aus einem neuartigen Kunststoff, der extremen Fluten standhalten konnte und gleichzeitig eine Begrünung ermöglichte, sodass, anders als früher, eine natürliche und in die Umwelt integrierte Zone entstehen würde. An der Begrünung wurde noch gearbeitet, doch seine finale Höhe hatte der Deich längst erreicht. Er war bereit für die anstehende Sturmsaison – zumal es ja auch noch das Land davor gab.
Das neue Vorland, das vermeintlich verlassene Gebiet, wirkte nicht sonderlich zerstört. Am Fuße des neuen Deiches türmten sich zwar Berge von Schutt und Müll, zusammengeschoben beim Aufräumen nach der Flut, doch das Land davor bestand aus Feldern und Wiesen, die intakt schienen. Felder mit Weizen, Kohl und anderem Gemüse. Wiesen, auf denen Schafe und Kühe weideten. Dazwischen Höfe, manchmal ein paar Hundert Meter, manchmal auch mehr als einen Kilometer voneinander entfernt. Natürlich gab es auch Brachen, Schlammlöcher und kleine Seen, aber „verheerend“ oder „verwüstet“, wie es nach der Flut überall geheißen hatte, war der Anblick nicht. Die Bauern hatten ganze Arbeit geleistet.
Die zahlreichen Windräder, die der Flut getrotzt hatten, fielen Lara ins Auge. Sie standen über die Felder verteilt, alle in dieselbe Richtung ausgerichtet. Laut Alina versorgten diese Windräder die Köge mit reichlich Strom. Das Potenzial der Windkraft am Meer hatten die Bauern schon vor langer Zeit entdeckt. Deswegen stand man nun auch besser da als die meisten Regionen Deutschlands, in denen viel zu lange über den Umstieg auf erneuerbare Energien diskutiert worden war und die Stromausfälle sich häuften.
Bald gelangte Lara zu einem weiteren Deich, laut Internet ein sogenannter Schlafdeich. Er trennte im Landesinneren einen Koog vom nächsten, war niedriger als die Außendeiche und vielleicht vor hundert Jahren einmal die Grenze zum Meer gewesen. Diese Schlafdeiche waren dafür verantwortlich, dass die Köge am Meer nach dem Bruch der Außendeiche vollgelaufen waren. Lara passierte eine Durchfahrt im Deich. Sie hatte gelernt, dass die wenige Meter breiten Öffnungen Stöpen hießen.
Sie fuhr in den am Meer gelegenen Kaiser-Wilhelm-Koog. Dort bekam sie nun einen besseren Eindruck davon, was die Naturgewalt angerichtet hatte. Die Straßen waren hier weit brüchiger, an manchen Stellen waren sie gänzlich einer Rollsplittstrecke gewichen. Laras Auto schlitterte auf dem schwergängigen Terrain. Sie passierte eine Hofruine. Eins der Gebäude war eingestürzt, die Fenster im Haupthaus zerstört, Risse in den Mauern, die an der dem Meer zugewandten Seite aufgebrochen waren. Man konnte ins Haus sehen, wo sich Möbel, Gerätschaften und vergammelte Vorhänge stapelten. Der nächste Hof schien von der Katastrophe verschont worden zu sein. Ein schönes altes Bauernhaus mit angebauter Scheune. Auf den zweiten Blick sah man jedoch, dass die Wände der Scheune neu waren, die Hausmauern ausgebessert und frisch gestrichen, die angepflanzten Beete und Büsche noch jung.
Plötzlich näherte sich von hinten in hohem Tempo ein Pick-up. Als Lara ihn im Rückspiegel erblickte, zog er schon auf der staubigen Straße vorbei. In den Fahrerraum hatten sich drei junge Männer in Arbeitsklamotten gequetscht, die bei Laras Anblick johlten und lachten, als hätten sie noch nie eine Frau gesehen. Lara verlangsamte unweigerlich, doch der Pick-up wurde ebenfalls langsamer und blieb auf ihrer Höhe. Der muskulöse, bärtige Kerl auf dem Beifahrersitz rief Lara irgendetwas zu. Sie versuchte ihn zu ignorieren, doch die Kerle hielten sich beharrlich neben ihr, kamen Laras Wagen gefährlich nah. Anhalten kam für sie nicht infrage, Kontakt meiden war ihre Devise. In der Ferne befand sich eine Kreuzung mit einer Straße, die zu einer der wenigen Siedlungen in den Kögen führte. Lara trat aufs Gas, die Reifen drehten durch, doch mit Geschick konnte sie sich auf der Piste halten. Allerdings fiel es dem Pick-up-Fahrer nicht besonders schwer aufzuschließen.
Der Bärtige lachte in ihre Richtung und wedelte mit dem Zeigefinger. Plötzlich gab der Fahrer Gas und setzte den Wagen mittig vor Lara, sodass sie im aufgewirbelten Staub kaum noch etwas erkennen konnte. Die Bremsleuchten vor ihr flackerten auf. Sie trat mit Wucht auf die Bremse. Das kleine eCar schlitterte über die Piste und kam nur einen Meter vor der Ladefläche des Pick-ups zum Stehen.
Lara stieg aus ihrem Auto und stampfte zu den Arschlöchern, die sie im Staubwirbel erst sahen, als sie bereits die Fahrertür aufriss.
„Bist du komplett bescheuert? Willst du mich umbringen?“
Damit überrumpelte sie den nicht mal zwanzig Jahre alten Rotschopf mit Sommersprossen. Doch angestachelt vom hämischen Lachen seiner Kumpels, fand er schnell seine Fassung wieder.
„Beruhig dich mal, Mädel!“
Der Typ hinter ihm lachte anzüglich. Er hatte doppelt so viel Masse wie der Rothaarige.
„Kindergarten!“
Lara ging zu ihrem Wagen zurück, kam aber nicht weit. Der Bärtige stand plötzlich vor ihr.
„Nicht so schnell!“
„Lass mich durch!“
Er ignorierte sie. Lara hörte, wie die anderen beiden Kerle hinter ihr ebenfalls aus dem Pick-up stiegen. Genau deswegen hatte sie nicht anhalten wollen. Ihre Fäuste ballten sich unweigerlich.
„Was willst du hier?“, fragte der Bärtige.
„Geht dich einen Scheißdreck an.“
„Berliner Kennzeichen“, hörte sie den Rothaarigen hinter sich sagen. „Bist du ’ne Journalistin?“
Bei ihm klang es wie eine Beleidigung. So viel zu ihrem Plan, Gesprächen auszuweichen. Der Rothaarige kam näher.
„Wir wollen hier niemanden, der rumschnüffelt. Verstehst du? Du gehörst hier nicht hin.“
„Und deswegen wollt ihr mich umbringen?“
Sie blickte sich um und entdeckte auf einer Parallelstraße einen Jeep mit Anhänger, der jedoch weiterfuhr und eine Staubwolke hinterließ. Keine Chance, den Fahrer auf sie aufmerksam zu machen.
„Niemals“, sagte der Bärtige gedehnt. „Mit dir kann ich mir viel schönere Sachen vorstellen.“
Der dicke Kerl lachte wieder anzüglich, mehr hatte er offensichtlich nicht drauf. Lara wurde langsam ruhiger. Sie lächelte den Bärtigen freundlich an, was ihn verunsicherte.
„Was hast du denn mit mir vor?“
Ihr Selbstbewusstsein hinterließ Eindruck.
„Kommt ganz drauf an, wer du bist“, erwiderte er. „Was du hier willst. Wir sind keine Unmenschen, aber wir mögen’s nicht, verarscht zu werden.“
Einen Moment lang überlegte Lara, ob sie ihm die Wahrheit sagen sollte. Sie war sicher, dass die Kerle Alina und natürlich auch Thorsten kannten. Doch dann dachte sie wieder an das Video.
„Ich mache Urlaub und suche das Meer. Hinter dem Deich, oder?“
„Falsche Antwort“, zischte der Bärtige.
Er packte sie am Arm und zerrte sie weg.
„Arthur, fahr ihren Wagen“, wies er den Rothaarigen an. „Wir bringen sie raus.“
„Lass mich los!“, rief Lara und trat ihrem Peiniger zwischen die Beine.
Er schrie auf und ließ sie los, doch der Dicke ergriff sie sofort von hinten, hielt sie an den Handgelenken vor sich und drehte sie dem wütenden Bärtigen zu. Der baute sich vor ihr auf. Lara sah den Schlag bereits kommen.
„Hey!“, hörte sie einen Ruf hinter sich.
Alle blickten sich um. In einiger Entfernung hatte der Jeep mit dem Anhänger auf einem Feld gehalten. Von dort näherte sich ihnen jetzt ein vielleicht fünfzigjähriger Mann, stämmig gebaut, in Armeehose, Holzfällerhemd mit hochgekrempelten Ärmeln und schweren Stiefeln. Seine Augen waren hinter einer Sonnenbrille verborgen.
„Lass sie los!“, rief er dem Dicken zu, der widerwillig gehorchte.
„Sie sagt nicht, was sie hier will“, erklärte der Rothaarige.
„Ist immer noch ein freies Land, oder?“, entgegnete der Neuankömmling.
Er hatte dichtes, kurzes Haar, ein wettergegerbtes Gesicht und wirkte aus der Nähe nicht besonders muskulös. Dennoch schienen Laras Peiniger Respekt vor ihm zu haben. Zum ersten Mal fiel Lara auf, wie leise diese fremde Welt war. Keine Autos, keine Sirenen, keine wabernden Geräusche wie in der Großstadt. Aber auch kein Vogelgezwitscher oder Ähnliches. Nur etwas Wind, sonst nichts. Der Holzfäller blickte in Ruhe von einem Mann zum nächsten. Dann sagte er: „Werdet ihr nicht irgendwo gebraucht?“
Der Rothaarige stöhnte missmutig. Alles in ihm wollte aufbegehren, aber etwas hielt ihn zurück. Also ging er zurück zu seinem Pick-up. Der Dicke folgte sofort, der Bärtige grinste Lara noch einmal frech an und eilte dann zum Beifahrersitz. Der Rothaarige trat trotzig aufs Gas, die Räder wirbelten Staub auf, dann flitzte der Wagen davon.
„Danke“, sagte Lara zu ihrem Retter.
Der Mann winkte ab und schaute dem Pick-up hinterher.
„Sind Sie der Hauptmann?“, fragte Lara.
Er lachte.
„Nein. Bin der Charlie. An der Küste duzt man sich übrigens.“
Er reichte ihr seine Hand. Lara nahm sie, ohne zu zögern.
„Lara. Freut mich.“
Er nickte knapp, erwiderte aber nichts.
„Auf jeden Fall hört man hier auf Sie … auf dich.“
Sie deutete in Richtung des Pick-ups, der langsam in der Ferne verschwand.
„Nicht wirklich. Auf Fremde hören die hier nur ungern.“
„Du bist nicht von hier?“
Charlie schüttelte den Kopf.
„Hab ein bisschen geholfen, als hier alles in Schutt und Asche lag.“
Lara wartete darauf, dass er seine Aussage noch weiter ausführte, aber das tat er nicht.
„Deswegen dulden sie dich?“
„Ja, aber dich …“
Er schüttelte den Kopf.
„Soll heißen?“, fragte Lara.
„Du bist hier nicht sicher. Ist ein rechtsfreier Raum. Wenn sie dir Übles wollen, hilft dir keiner.“
Lara wusste nicht, ob er sich um sie sorgte oder nur auf deutlich subtilere Art das vollenden wollte, was die drei Halbstarken angefangen hatten: sie zu verjagen.
„Aber du hast mir doch geholfen“, entgegnete sie.
Charlie schmunzelte, sagte aber nichts weiter dazu. Stattdessen blickte er zu ihrem eCar.
„Soll das ein Auto sein?“
„Na ja, in der Stadt reicht es.“
„Ich hab das Gefühl, wir sind hier nicht mehr in der Stadt.“
Nun musste Lara schmunzeln.
„Falls es noch mal zu Feindkontakt kommt, sag einfach, du bist ’ne Freundin von Charlie.“
Mit diesen Worten stiefelte er zurück auf das Feld, wo sein Jeep stand. Sein plötzlicher Abschied überrumpelte Lara, gleichzeitig war sie froh, dass sie nun so etwas wie einen Freund in dieser fremden Welt hatte.
„Danke noch mal!“, rief sie ihm hinterher.
Er hob die Hand, ohne sich umzudrehen. Dann stieg er in seinen Wagen und fuhr davon. Erst jetzt konnte Lara den Anhänger am Jeep genauer anschauen. Ein graues Gefährt mit dunklen Fenstern, einer Tür, diversen Klappen und Luken. Es schien ein geländetauglicher Wohnwagen zu sein. Lebte Charlie etwa darin? Sie blickte der Staubwolke eine Weile hinterher, bis die Stille sie einholte.
Seit Jahren verfolge ich Berichte über Menschen, die sich von unserer zivilen Gesellschaft abspalten wollen: Reichsbürger. Eine bunt durchmischte Szene von Geschichtsrevisionisten über sektenartige Gruppierungen bis hin zu rechtsextremen Populisten. Allen gemein ist der Wunsch nach einem eigenen Staat mit eigenen, für sie passenden Regeln. Eine Utopie, die in manchen Fällen absurde Ausmaße angenommen hat: Es gibt selbst herausgegebene Pässe, die Verweigerung von Steuerzahlungen oder gar Gewalt gegen die echten Kräfte unseres Staates.
Doch eines haben all diese Gruppierungen gemeinsam: Keine von ihnen hatte bisher Erfolg. Zum Glück.
Als die Pandemie uns die neue Spezies des „Querdenkers“ bescherte, erhielt der zivile Ungehorsam zum ersten Mal größeren Zulauf von populistischer Seite. Und ich stellte mir die Frage: Was wäre, wenn eine Gruppierung entstehen würde, die nicht nur einen klugen und charismatischen Anführer hätte, sondern auch ein einfach abzutrennendes Gebiet und genügend wirtschaftliche Kraft für ein autarkes Leben? Könnte dann aus dem eigenen Staat etwas werden?
Das war die Grundidee für „Koogland“. Ausgerechnet der Klimawandel kam bei der Suche nach einem passenden Stück Land zur Hilfe: Sollte der Meeresspiegel nur wenig schneller steigen als derzeit angenommen, und kämen ein paar unglückliche Faktoren zusammen, könnte es notwendig werden, ganze Landstriche dem Meer zurückzugeben. Gebiete, in denen Menschen leben, die sich dort mit Härten und Ausdauer eine Heimat aufgebaut haben.
Um „meinen“ Staat zu finden, nahm ich mir die Nordseeküste auf Google Maps vor. Schon optisch sticht dort ein Bereich der Dithmarschen nördlich von Brunsbüttel heraus. Es gibt mehrere Köge – einst dem Meer abgetrotzt –, die sich geographisch gesehen leicht vom Rest des Landes abtrennen lassen. Wenige Rechercheschritte später fand ich heraus, dass es einst die Bauernrepublik Dithmarschen gab: eine unabhängige, streitlustige und fast schon demokratisch organisierte Region, die sich von den Ansprüchen und Angriffen diverser Könige nicht beeindrucken ließ. Salopp gesagt: Sture Bauern, die ihr eigenes Ding machten. Sie waren eindeutig die Vorfahren meines „Hauptmanns“ Thies Cordes. Nach einer Jahrtausendflut fühlt er sich von der Bundesrepublik Deutschland im Stich gelassen und ruft seine Republik Koogland aus.
Da ich noch nie in Dithmarschen gewesen war, schien eine Recherchereise unabdingbar. Dummerweise war dies im Frühjahr 2021, Deutschland befand sich im zweiten großen Corona-Lockdown, und Reisen war nur aus beruflichen Gründen gestattet. Mit Mühe fand ich einen Bauernhof mit Ferienwohnungen in der Nähe von Marne – das zu einem zentralen Ort meiner Erzählung wurde –, wo man bereit war, mich aufzunehmen. Ausgestattet mit zahlreichen Corona-Tests und einer Bescheinigung meiner Agentur, dass ich für das schreibende Handwerk reiste, machte ich mich von Berlin auf den Weg nach Marne – genau wie meine zweite Hauptfigur Lara es zu Beginn der Geschichte tut. Als einziger Besucher des Nørdnhofs fand ich nicht nur reizende Gastgeber, sondern mit dem Hof selbst auch das perfekte Vorbild für meinen fiktiven Lindenhof, von dem aus Lara Koogland nach ihrer verschwundenen Schwester Alina absucht. In den nächsten Tagen fuhr ich kreuz und quer durch die Köge, lernte Schafzüchter, Deichführer, Wasserbauingenieure und auch ein paar echte Dithmarscher Bauern kennen – auf Distanz und zumeist im Freien. Sie alle waren gesprächsbereite und interessierte Menschen, die oft mit feinem Humor und angenehmer Ruhe ein Bild der Menschen „hinterm Deich“ entstehen ließen. Darunter befand sich auch ein Überlebender der letzten großen Sturmflut 1962. Er lebte nach wie vor einen Steinwurf von dem Deich entfernt, der damals gebrochen war.
Ich besuchte zudem eine Führung durch die Neulandhalle – in meiner Erzählung sollte sie zu einem Ort nervenaufreibender Szenen werden. Eine von den Nazis erbaute Halle, die viel darüber vermittelt, warum der Neulandkoog nach seiner Eindeichung zunächst Adolf-Hitler-Koog hieß. Nachfahren der damals auserwählten ersten Siedler leben noch heute dort, was natürlich genauso Einfluss auf meine Geschichte nahm wie die überall zu findenden Hinweise auf die Schlacht bei Hemmingstedt von 1500. In dieser Schlacht besiegten die weit unterlegenen Dithmarscher Bauern das Heer des dänischen Königs mit List und unerschütterlichem Willen.
Mein Gastgeber Tim auf dem Nørdnhof, selbst in der Region groß geworden, hörte sich abends bei einem Glas Wein meine Ideen und Geschichten an und antwortete auf kleine und große Fragen zu den Menschen vor Ort. Und irgendwann sagte er, dass das bei einigen der Dithmarscher Bauern schon passen könnte mit dem Wunsch nach dem eigenen Staat, wenn man sich im Stich gelassen fühlt. Das war für mich der Ritterschlag für Koogland. Und der Auftakt zu einer weiteren Reise, dieses Mal an meinem Schreibtisch in Berlin, tief hinein in die Geschichte von Lara, dem Hauptmann und den stolzen Bauern aus Dithmarschen ...










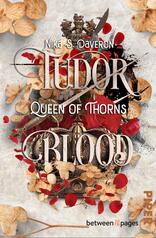







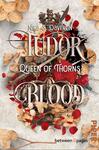


du hast es wieder geschafft-ein tolles buch danke das du mich über dein neues werk informiert hast die inhaltsangabe auf der buchrückseite war nicht ansprechend für mich - da benötigst du einen anderen schreiberling die aussagen sind zwar stimmig aber nicht so - das man es unbedingt lesen muss nach 20-30 seiten war ich gefangen und gefesselt der spannungsbogen ist perfekt - du hast es echt drauf eine geschichte interessant rüber zu bringen ich mag deinen schreibstil ich lese viele bücher , wenn ich dir sage das du gut bist dann kannst du das glauben vielen dank frank
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.