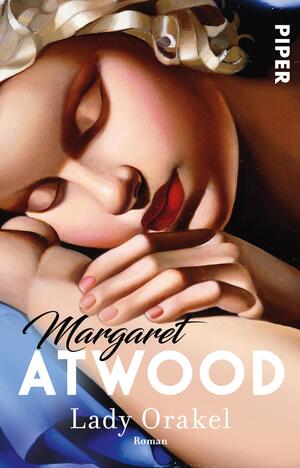
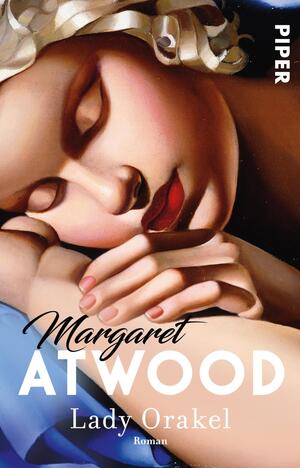
Lady Orakel — Inhalt
Als Kind wegen ihres unglaublichen Übergewichts gehänselt und von der eigenen Mutter abgelehnt, findet Joan Foster in ihrer ebenso dicken wie skurrilen Tante Lou eine Verbündete. Als diese stirbt, hinterläßt sie Joan ein Vermögen. Doch der Anspruch auf das Erbe ist an eine Bedingung geknüpft: Joan muß 40 Kilo abnehmen, um in den Genuss des Geldes zu kommen. Mit gewohnt spitzer Feder setzt Margaret Atwood in „Lady Orakel“ zu einem Rundumschlag gegen menschliche Schwächen an und entwirft wie nebenbei das Porträt einer ganz und gar ungewöhnlichen Frau auf der Suche nach ihrer Identität.
Leseprobe zu „Lady Orakel“
ERSTER TEIL
1
Ich plante meinen Tod mit Bedacht – anders als mein Leben, das, trotz meiner lahmen Versuche, es unter Kontrolle zu halten, dauernd auf Abwege geriet. Mein Leben hatte die Neigung zu zerfasern, wabbelig zu werden, es verschnörkelte sich girlandenartig wie der Rahmen eines Barockspiegels, was daher kam, dass ich immer den Weg des geringsten Widerstands ging. Meinen Tod wünschte ich mir im Gegensatz dazu schlicht und einfach, eher untertrieben, ja sogar mit einem kleinen Schuss Strenge, wie eine Quäker-Kirche oder wie das kleine Schwarze mit [...]
ERSTER TEIL
1
Ich plante meinen Tod mit Bedacht – anders als mein Leben, das, trotz meiner lahmen Versuche, es unter Kontrolle zu halten, dauernd auf Abwege geriet. Mein Leben hatte die Neigung zu zerfasern, wabbelig zu werden, es verschnörkelte sich girlandenartig wie der Rahmen eines Barockspiegels, was daher kam, dass ich immer den Weg des geringsten Widerstands ging. Meinen Tod wünschte ich mir im Gegensatz dazu schlicht und einfach, eher untertrieben, ja sogar mit einem kleinen Schuss Strenge, wie eine Quäker-Kirche oder wie das kleine Schwarze mit einer einzigen Perlenkette, das von allen Modemagazinen angepriesen wurde, als ich fünfzehn war. Diesmal sollte es keine Trompeten, kein großes Geschrei, keinen Flitter, keine Unklarheiten geben. Der Trick war, spurlos zu verschwinden, den Schatten einer Leiche zurückzulassen, einen Schatten, den jedermann fälschlich für handfeste Wirklichkeit hielte. Zuerst glaubte ich, ich hätte es geschafft.
Am Tag nach meiner Ankunft in Terremoto saß ich draußen auf dem Balkon. Ich hatte vorgehabt, ein Sonnenbad zu nehmen; ich sah mich selbst in mediterraner Pracht, goldbraun, lachend, mit blitzenden Zähnen ins blaugrüne Meer tauchen, endlich aller Sorgen und meiner Vergangenheit ledig. Aber dann fiel mir ein, dass ich keine Sonnencreme hatte (höchster Schutzfaktor: sonst würde ich Sonnenbrand und Sommersprossen bekommen), also legte ich mir ein paar der kümmerlichen Badetücher des Vermieters über Schultern und Schenkel. Einen Badeanzug hatte ich nicht dabei. Büstenhalter und Slip würden es auch tun, dachte ich, da der Balkon von der Straße aus nicht einzusehen war.
Ich hatte schon immer eine Schwäche für Balkone gehabt. Ich wusste, wenn ich es nur fertigbrächte, auf dem einen, dem richtigen, lange genug auszuharren, in einer langen, weißen, fließenden Robe, am besten, während der Mond im ersten Viertel stand, dann würde etwas geschehen: Musik würde erklingen, ein Schatten würde unter dem Balkon auftauchen, dunkel und geschmeidig, und würde mir entgegenklettern, während ich ängstlich, hoffnungsvoll, anmutig und zitternd an der schmiedeeisernen Balustrade lehnte. Das hier war allerdings kein sehr romantischer Balkon. Er hatte ein geometrisches Geländer, wie bei diesen Mietshäusern aus den Fünfzigerjahren, mit einem Zementboden, der schon abzubröckeln begann. Es war bestimmt nicht der Balkon, unter dem ein Mann sehnsuchtsvoll die Laute schlagen oder den er mit einer Rose zwischen den Zähnen oder einem Stilett im Ärmel erklettern würde. Ganz abgesehen davon, dass es bis zum Erdboden nur anderthalb Meter waren. Viel wahrscheinlicher würde irgendein für mich bestimmter geheimnisvoller Besucher den Schlackenpfad benutzen, der oben von der Straße zum Haus hinunterführte, mit knirschenden Schritten, Rosen oder Messer bestenfalls im Kopf.
Das jedenfalls wäre Arthurs Stil, dachte ich; er würde lieber knirschen als klettern. Wenn es nur wieder so sein könnte, wie es gewesen war, bevor er sich verändert hatte … Ich stellte ihn mir vor, wie er hierherkam, um mich zurückzugewinnen, wie er sich in einem gemieteten Fiat, an dem irgendetwas nicht in Ordnung war, den Hügel hinaufkurvte; von dem Defekt würde er mir später erzählen, nachdem wir einander in die Arme gestürzt waren. Parken würde er so dicht wie möglich an der Mauer. Vor dem Aussteigen würde er im Rückspiegel sein Gesicht kontrollieren und sich den richtigen Ausdruck zulegen: Er machte sich nicht gern lächerlich, und er würde sich vergewissern, ob er drauf und dran war, es zu tun oder nicht. Er würde sich aus dem Wagen herauswinden, abschließen, damit sein spärliches Gepäck nicht gestohlen werden konnte, würde die Schlüssel in eine Innentasche seiner Jacke stecken, nach rechts und links spähen, und dann, mit diesem komischen Kopfducken, als müsste er einem Steinwurf oder einer zu niedrigen Tür ausweichen, würde er um das rostige Tor herumschleichen und vorsichtig den Pfad hinuntergehen. Er wurde an Grenzübergängen oft durchsucht. Einfach, weil er so etwas Verstohlenes an sich hatte; verstohlen, aber korrekt, wie ein Spion.
Bei Arthurs Anblick, wie er lang und dünn zu mir herabstieg, unsicher, mit steinernem Gesicht, meine Errettung im Sinn, in seinen unbequemen Schuhen und mit seiner abgetragenen Baumwollunterwäsche, noch im Ungewissen, ob ich wirklich da war oder nicht, fing ich an zu weinen. Ich schloss die Augen: Vor mir, jenseits einer ungeheuren blauen Fläche, die ich als Atlantischen Ozean erkannte, waren alle, die ich auf der anderen Seite zurückgelassen hatte. Natürlich an einem Strand; ich hatte eine Menge Fellini-Filme gesehen. Der Wind zauste ihre Haare, sie lächelten und winkten und riefen mir etwas zu, was ich natürlich nicht verstehen konnte. Arthur war ganz vorn; hinter ihm das Königliche Stachelschwein, auch unter dem Namen Chuck Brewer bekannt, in seinem langen theatralischen Umhang; dann Sam und Marlene und die anderen. Leda Sprott flatterte wie ein Betttuch nach einer Seite weg, und dort, wo Fraser Buchanan hinter einem Busch auf der Lauer lag, konnte ich seinen lederfleckenbesetzten Ellbogen herausschauen sehen. Im Hintergrund meine Mutter in einem marineblauen Kostüm und mit weißem Hut, neben ihr, undeutlich und verschwommen, mein Vater und meine Tante Lou. Als Einzige schaute Tante Lou nicht zu mir. Sie marschierte am Strand lang, tief durchatmend und die Wellen bewundernd; ab und zu hielt sie an, um den Sand aus ihren Schuhen zu schütteln. Sie zog sie schließlich aus und ging weiter, Fuchspelz, Federhut und bestrumpfte Beine, auf eine entfernte Würstchen- und Limonadenbude zu, die, einer armseligen Fata Morgana gleich, vom Horizont her lockte.
Bei den anderen hatte ich mich allerdings getäuscht. Sie lächelten und winkten einander zu, nicht mir. Vielleicht irrten die Spiritisten, und die Toten hatten gar kein Interesse an den Lebenden? Obwohl einige von ihnen noch lebten und ich diejenige war, die für tot gehalten wurde. Sie hätten trauern müssen, doch stattdessen kamen sie mir ganz fröhlich vor. Es war einfach nicht fair. Ich versuchte, etwas düster Drohendes in ihre Strandidylle zu zwingen – einen gewaltigen, in Stein gehauenen Kopf, ein sterbendes Pferd –, doch ohne Erfolg. Tatsächlich ähnelte das Ganze weniger einem Fellini-Film als einem von Walt Disney, den ich mit acht Jahren gesehen hatte, über einen Walfisch, der an der Metropolitan Oper singen wollte. Er näherte sich einem Schiff und schmetterte seine Arien, aber die Matrosen harpunierten ihn, und jede seiner Stimmen verließ seinen Leib in einer anders gefärbten Seele und stieg immer noch singend der Sonne entgegen. Ich glaube, der Film hieß „Der Wal, der an der Met singen wollte“. Damals heulte ich wie ein Schlosshund.
Die Erinnerung daran brachte mich wirklich aus der Fassung. Ich habe nie gelernt, stilvoll zu weinen, lautlos, während aus großen leuchtenden Augen perlenförmige Tränen meine Wangen hinunterrollen, wie auf den Titelseiten der ›Wahre Liebe‹-Heftchen, ohne etwas zu verschmieren. Ich wollte, ich hätte es gelernt; dann könnte ich in aller Öffentlichkeit weinen statt in Badezimmern, dunklen Kinos, hinter Büschen und in leeren Schlafzimmern, zwischen den Mänteln der Partygäste auf dem Bett. Wenn man lautlos weinen kann, haben die Leute Mitleid mit einem. Aber es war so, dass ich schnaubte, meine Augen nahmen Form und Farbe von gekochten Tomaten an, meine Nase lief, ich ballte die Fäuste, ich stöhnte und keuchte, ich wirkte einfach störend, bis ich schließlich nur noch zur Erheiterung beitrug, eine komische Figur. Der Kummer war immer echt, aber sichtbar wurde nur ein Zerrbild des Kummers, eine übergroße Imitation wie die Neonrose der White-Rose-Tankstellen, die es auch schon längst nicht mehr gibt … Sittsames Weinen gehört zu jenen Künsten, die ich nie beherrscht habe, genauso wie das Anlegen falscher Wimpern. Ich hätte eine Gouvernante haben sollen, ich hätte die Schule beenden sollen, ein Brett zwischen die Schultern geschnallt wegen der Haltung, ich hätte den Umgang mit Wasserfarben und Selbstbeherrschung lernen sollen.
Die Vergangenheit kannst du nicht ändern, pflegte Tante Lou zu sagen. Oh, ich wollte es aber; das war das Einzige, was ich wirklich wollte. Tiefe Wehmut erfasste mich. Der Himmel war blau, die Sonne schien, links von mir schimmerte ein Scherbenhaufen wie Wasser; auf dem Geländer wärmte eine kleine, grüne Eidechse mit schillernd blauen Augen ihr kaltes Blut; aus dem Tal drang Glockengeläut, ein sanftes Muhen, der einschläfernde Ton fremder Stimmen. Ich war in Sicherheit, ich konnte von vorn beginnen, doch stattdessen saß ich auf dem Balkon, neben den Überbleibseln eines von meinen Vorgängern zerbrochenen Küchenfensters, in einem Sessel aus Aluminiumrohren und gelben Plastikstreifen, und gab erstickte Laute von mir.
Der Sessel gehörte Mr Vitroni, dem Hausbesitzer, der eine Vorliebe für Filzstifte in den Farben Tintenschwarz, Rot, Rosa, Purpur und Orange hatte, einen Geschmack, den ich teilte. Er benutzte seine Stifte dazu, den anderen Leuten in der Stadt zu zeigen, dass er schreiben konnte. Ich brauchte meine für Listen und Liebesbriefe, manchmal beides auf einmal: ›Bin Kaffee einkaufen gegangen, XXX.‹ Der Gedanke an diese nun aufgegebenen Einkaufsbummel verschlimmerte meinen Kummer … keine Grapefruits mehr, für zwei Personen in zwei Hälften geschnitten, mit einer roten Maraschinokirsche als Nabel, die Arthur gewöhnlich an den Tellerrand schob; kein Weizenmehl-Porridge mehr, von mir gehasst, von Arthur hoch gepriesen, klumpig und angebrannt, weil ich nicht auf seinen Rat gehört hatte, es im Wasserbad zu kochen … jahrelange Frühstücke, töricht, einsam, endgültig vorbei … jahrelange missglückte Frühstücke, warum hatte ich das getan?
Mir wurde klar, dass ich an den schlechtesten Ort der ganzen Welt gekommen war. Ich hätte irgendwo hingehen sollen, wo alles frisch und sauber war, wo ich nie zuvor gewesen war. Stattdessen war ich in dieselbe Stadt, sogar in dasselbe Haus zurückgekehrt, in dem wir im Jahr davor den Sommer verbracht hatten. Und nichts hatte sich verändert: Ich musste auf demselben zweiflammigen Herd mit angeschlossener Gasflasche, ›bombola‹, kochen, die immer beim Kochen mittendrin leer wurde; am selben Tisch essen, der immer noch die weißen Ringe in der Politur hatte, wo ich leichtsinnig heiße Tassen abgestellt hatte; im selben Bett schlafen, die Matratze vom Alter und den Ängsten vieler Mieter durchgelegen. Arthurs Geist würde mich verfolgen; schon hörte ich schwach gurgelnde Geräusche aus dem Badezimmer, das Knirschen von Glas, wenn er seinen Stuhl auf dem Balkon zurückschob und darauf wartete, dass ich ihm durchs Küchenfenster seine Tasse Kaffee hinausreichte. Wenn ich die Augen aufmachte und den Kopf drehte, würde er ganz sicher da sein, die Zeitung zehn Zentimeter vor seinem Gesicht, Taschenwörterbuch auf einem Knie, den linken Zeigefinger (vielleicht) ins Ohr gestopft, eine unbewusste Geste, die er strikt ableugnete.
Es war meine eigene Dummheit, mein eigener Fehler. Ich hätte nach Tunesien oder auf die Kanarischen Inseln fahren sollen oder sogar nach Miami Beach, im Greyhound-Bus, Hotel im Preis inbegriffen, aber ich brachte den Willen dazu nicht auf; ich brauchte etwas Vertrauteres. Einen Ort ohne Handgriffe, ohne Orientierungspunkte, ohne jede Vergangenheit: Das wäre dem Sterben zu ähnlich gewesen.
Mittlerweile heulte ich krampfhaft in eines der Badetücher des Hausherrn, und ein zweites hatte ich aus alter Gewohnheit über den Kopf geworfen: Früher weinte ich unter Kissen, damit niemand es merkte. Jetzt hörte ich durch das Handtuch ein merkwürdig klickendes Geräusch. Es musste schon eine ganze Weile zu hören gewesen sein. Ich lauschte, und es verstummte. Ich hob das Handtuch hoch. In Höhe meiner Fußknöchel und nur einen knappen Meter entfernt tauchte ein Kopf auf, der Kopf eines alten Mannes, bedeckt mit einem zerfledderten Strohhut. Die weißlichen Augen starrten mich entweder besorgt oder missbilligend an; der Mund, über dem Zahnfleisch eingefallen, stand auf einer Seite offen. Er musste mich gehört haben. Vielleicht glaubte er, ich hätte irgendeinen Anfall, wie ich da in meiner Unterwäsche und handtuchbedeckt auf dem Balkon saß. Vielleicht hielt er mich auch für betrunken.
Zur Beruhigung schenkte ich ihm ein feuchtes Lächeln, wickelte meine Handtücher um mich und versuchte, aus dem Aluminiumsessel herauszukommen. Zu spät erinnerte ich mich an seine hinterlistige Art zusammenzuklappen, sobald man zappelte. Ich verlor mehrere der Handtücher, ehe ich durch die Tür verschwinden konnte. Den alten Mann hatte ich erkannt. Es war derselbe alte Mann, der immer an ein oder zwei Nachmittagen in der Woche die Artischocken auf der unfruchtbaren Terrasse unterhalb des Hauses versorgt hatte, wobei er dem groben Unkraut mit einer großen rostigen Schere zu Leibe rückte und die ledrigen Artischockenköpfe abschnitt, sobald sie reif waren. Anders als die anderen Leute im Dorf sagte er nie ein Wort zu mir, noch erwiderte er meinen Gruß. Bei seinem Anblick bekam ich Gänsehaut. Ich zog mein Kleid an (hinter der Tür, damit ich nicht gesehen werden konnte) und ging ins Badezimmer, um mein Gesicht mit einem feuchten Waschlappen abzuwischen und mir mit Mr Vitronis kratzigem Toilettenpapier die Nase zu putzen. Dann ging ich in die Küche und machte mir eine Tasse Tee. Zum ersten Mal seit meiner Ankunft spürte ich Angst. Es war nicht nur deprimierend, in diese Stadt zurückgekehrt zu sein, es war gefährlich. Es taugt nicht viel, wenn man sich für unsichtbar hält und es nicht ist. Das Problem war einfach: Wenn ich den alten Mann erkannt hatte, hatte er mich vielleicht auch erkannt.
2
Ich setzte mich an den Tisch, um meinen Tee zu trinken. Tee wirkte beruhigend und würde mir beim Nachdenken helfen; obwohl dieser nicht gerade gut war. Es war Beuteltee, und er roch nach Apotheke. Ich hatte ihn zusammen mit einer aus England importierten Packung Peek Frean Biskuits im Lebensmittelgeschäft gekauft. Der Laden hatte davon einen großen Vorrat, in Erwartung englischer Touristenschwärme, die bis jetzt allerdings noch nicht aufgetaucht waren. „By Appointment to Her Majesty the Queen, Biscuits Manufactures“, stand auf der Schachtel. Ich finde, so etwas hebt die Moral. Die Königin würde nicht jammern: Reue ist taktlos. „Reiß dich zusammen“, sagte eine strenge königliche Stimme. Ich setzte mich kerzengerade in meinen Stuhl und überlegte, was ich tun könnte.
Natürlich hatte ich Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Ich benutzte meinen anderen Namen, und als ich Mr Vitroni aufsuchte, um zu fragen, ob die Wohnung noch zu vermieten wäre, hatte ich meine Sonnenbrille aufgesetzt und meinen Kopf mit dem Tuch umwickelt, das ich am Flughafen von Toronto gekauft hatte und das mit rosa berittenen Polizisten bedruckt war, die vor dem Hintergrund der purpurnen Rocky Mountains eine Parade ritten. Und das alles made in Japan. Ich hüllte meinen Körper in eines dieser bedruckten Sackkleider, ebenfalls rosa, mit babyblauen Blumen, das ich an einem Straßenstand in Rom gekauft hatte. Eigentlich hätte ich große rote Rosen oder orangefarbene Dahlien vorgezogen: In diesem Kleid sah ich aus wie eine wandelnde Tapete. Aber ich hatte etwas wirklich Unverdächtiges gewollt. Mr Vitroni hatte sich nicht an mich erinnert, da war ich sicher. Der alte Mann jedoch hatte mich ohne meine Verkleidung erwischt und, schlimmer noch, mit deutlich erkennbaren Haaren. Hüftlanges rotes Haar war in diesem Teil des Landes sehr auffällig. Die Biskuits waren hart wie Gips und schmeckten nach alten Brettern. Ich stippte das letzte in den Tee, und während ich es mit mechanischen Kaubewegungen aß, wurde mir klar, dass ich die ganze Packung aufgegessen hatte. Das war ein schlechtes Zeichen. Ich musste ein Auge darauf haben.
Ich beschloss, etwas mit meinen Haaren zu unternehmen. Sie waren zu eindeutig, ihre Länge und Farbe waren eine Art Warenzeichen geworden. Jeder Zeitungsartikel, egal ob freundlich oder feindlich, hatte sie erwähnt. Tatsächlich war ihnen viel Raum gewidmet worden: Bei Frauen bedeuteten Haare wohl mehr als Talent oder Mangel an Talent. „Joan Foster, gefeierte Autorin von LADY ORACLE, mit dem Aussehen eines üppigen Rossetti-Porträts, voll strahlender Ausdruckskraft, hypnotisierte das Publikum mit ihrer unirdischen …“ (Der Toronto Star). „Die Prosadichterin Joan Foster, mit ihrem fließenden roten Haar und der grünen Robe wie eine lebendig gewordene Juno wirkend, war bedauerlicherweise kaum zu verstehen …“ (The Globe and Mail). Mein Haar war bei Weitem leichter aufzuspüren als ich. Ich musste es abschneiden und den Rest färben, obwohl mir nicht klar war, wo ich hier das Haar färben konnte. Bestimmt nicht in dieser Stadt. Wahrscheinlich würde ich deswegen zurück nach Rom müssen. Eine Perücke hätte ich kaufen sollen, dachte ich. Das hatte ich übersehen.
Ich ging ins Badezimmer und kramte die Nagelschere aus meinem Kulturbeutel. Sie war zu klein, aber ich hatte nur die Wahl zwischen ihr und Mr Vitronis stumpfen Kartoffelschälmessern. Es kostete mich einige Zeit, das Haar abzusäbeln, Strähne um Strähne. Den Überbleibseln versuchte ich etwas Form zu geben, aber es wurde kürzer und kürzer, keineswegs gleichmäßiger, bis ich merkte, dass ich meinen Kopf wie den einer KZ-Insassin zurechtgestutzt hatte. Mein Gesicht hatte sich allerdings verändert: Ich konnte als Sekretärin auf Urlaub durchgehen.
Das Haar ringelte sich bergeweise im Waschbecken. Ich wollte es retten. Einen Augenblick lang dachte ich daran, es in eine Schublade zu stopfen. Aber was sollte ich sagen, wenn es gefunden wurde? Sie würden anfangen, nach den Armen und Beinen und dem Rest der Leiche zu suchen. Ich musste es loswerden. Ich erwog, es durch die Toilette zu spülen, aber es war einfach zu viel, und die Sickergrube hatte schon angefangen, Sumpfgras und Fetzen verfaulenden Klopapiers aufzustoßen.
Ich nahm es mit in die Küche und zündete einen der Gasbrenner an. Dann, Strähne um Strähne, begann ich mit der Opferung meines Haares. Es schrumpfte schwarz zusammen, krümmte sich wie eine Handvoll Regenwürmer, schmolz und brannte schließlich wie eine Lunte. Ein überwältigender Geruch nach versengtem Truthahn machte sich breit.
Die Tränen liefen mir die Backen hinunter; ohne jeden Zweifel war ich sentimental, und zwar auf die rührseligste Art und Weise. Das Dumme war: Arthur hatte gern mein Haar gebürstet, und diese kleine Erinnerung brachte mich zum Heulen, obwohl er nie lernte, nicht zu ziehen, und das tat verflixt weh. Zu spät, zu spät … Ich habe es nie fertiggebracht, zur richtigen Zeit die richtigen Gefühle zu haben; Zorn, wenn ich hätte zornig sein müssen, Tränen, wenn es Grund zum Weinen gab; bei mir war nichts aufeinander abgestimmt.
Als ich die Hälfte von dem Berg Haare geschafft hatte, hörte ich Schritte auf dem Kiesweg. Mein Herz zog sich zusammen, ich stand wie erstarrt: Der Weg führte nur zum Haus, und außer mir wohnte dort niemand. Die beiden anderen Wohnungen standen leer. Wie konnte Arthur mich nur so schnell gefunden haben? Vielleicht hatte ich mich doch nicht in ihm getäuscht. Oder es war gar nicht Arthur, es war einer von den anderen … Die Panik, die ich in der letzten Woche krampfhaft unterdrückt hatte, schlug in einer eisgrauen Woge über mir zusammen, und in ihrem Sog schwappten die Umrisse meiner Angst heran, ein totes Tier, die Drohung eines schweren Atems am Telefon, die aus Zeitungen zusammengeschnipselten Nachrichten eines Killers, ein Revolver, Wut … Gesichter formten sich in meinem Kopf und zersplitterten wieder, ich wusste nicht, auf wen ich mich gefasst machen sollte; was wollten sie von mir? Die Frage, die ich nie beantworten konnte. Mühsam unterdrückte ich einen Schrei und stürzte ins Badezimmer. Vielleicht konnte ich mich dort durch das hohe quadratische Fenster zwängen; dann den Hügel hinaufrennen, ins Auto und weg. Noch mal eine schnelle Flucht. Ich versuchte mich daran zu erinnern, wo ich die Autoschlüssel hingelegt hatte.
Es klopfte an der Tür. Ein kräftiges, selbstbewusstes Pochen. Eine Stimme rief: „Hallo? Sind Sie da?“
Mein Atem setzte wieder ein. Es war bloß Mr Vitroni, Signor Vitroni, Reno Vitroni, mit dem breiten Lächeln, der seinen Besitz inspizierte. Dies war sein gesamter Besitz, soviel ich wusste. Nichtsdestoweniger hielt man ihn für einen der reichsten Männer in der Stadt. Wenn er die Küche kontrollieren wollte, was würde er von meinen geopferten Haaren halten? Ich drehte den Brenner ab und stopfte das Haar in die Papiertüte für den Abfall.
„Ich komme gleich“, rief ich, „eine Sekunde.“ Ich wollte ihn nicht hier drin haben: Mein Bett war ungemacht, Kleider und Unterwäsche waren über Stuhllehnen und Fußboden verstreut, auf dem Tisch und im Ausguss stand schmutziges Geschirr. Ich wickelte mir eins von den Handtüchern um den Kopf und nahm im Vorbeigehen die Sonnenbrille vom Tisch.
„Ich hab’ mir gerade die Haare gewaschen“, sagte ich zu ihm, nachdem ich die Tür geöffnet hatte.
Die dunklen Gläser verwirrten ihn ein bisschen, nicht sehr. Seiner Erfahrung nach hatten ausländische Damen merkwürdige Schönheitsrituale. Er strahlte und streckte die Hand aus. Ich streckte ihm meine entgegen, er hob sie wie zum Handkuss, aber dann schüttelte er sie bloß.
„Es erfreut mich sehr, Sie zu sehen“, sagte er und schlug die Hacken in einer komischen militärischen Verbeugung zusammen. Die farbigen Filzstifte waren auf seiner Brust aufgereiht wie Orden. Er hatte sein Vermögen im Krieg gemacht, irgendwie; jetzt, wo alles vorbei war, fragte niemand mehr danach. Damals hatte er ein bisschen Englisch und ein paar Brocken verschiedener anderer Sprachen gelernt. Weshalb mochte er jetzt am frühen Abend zu meiner Wohnung gekommen sein? Sicherlich nicht die richtige Zeit für einen Besuch bei einer jungen Ausländerin, jedenfalls nicht für diesen respektablen Mann mittleren Alters mit der standesgemäß fassförmigen Frau und den zahlreichen Enkelkindern. Er trug etwas unter dem Arm. Er schaute über meine Schulter, als wollte er hineingehen.
„Sie kochen wohl Ihr Abendessen?“, fragte er. Der Geruch nach verbranntem Haar musste ihm in die Nase gestiegen sein. Ich hörte förmlich seine Gedanken: Gott weiß, was diese Leute essen. „Ich störe nicht, hoffe ich sehr?“ „Aber nein, überhaupt nicht“, sagte ich herzlich und blieb mitten im Türrahmen stehen.
„Alles in Ordnung bei Ihnen? Geht das Licht wieder?“
„Ja, ja“, sagte ich und nickte heftiger als notwendig. Bei meinem Einzug hatte es keinen Strom gegeben, weil der letzte Mieter die Rechnung nicht bezahlt hatte. Mr Vitroni hatte seine Beziehungen spielen lassen.
„Wir haben viel Sonnenschein, nicht?“
„Sehr viel“, sagte ich und versuchte meine Ungeduld zu verbergen. Er stand zu dicht vor mir.
„Das ist gut.“ Jetzt kam er zur Sache. „Ich habe hier etwas für Sie. Damit Sie sich“ – sein freier Arm schwang hoch, die Handfläche nach oben, mich überschwänglich willkommen heißend –, „damit Sie sich bei uns wie zu Hause fühlen.“ Wie peinlich, dachte ich; er will mir ein Begrüßungsgeschenk überreichen. War das hier Sitte, was sollte ich dazu sagen? „Das ist furchtbar nett von Ihnen“, sagte ich, „aber …“
Mr Vitroni winkte meine Dankbarkeit ab. Er zog das rechteckige Bündel unter seinem Arm hervor, stellte es auf den Plastikstuhl und begann die Schnur aufzuknüpfen. Beim letzten Knoten legte er eine Pause ein, um die Spannung zu erhöhen, wie ein Zauberer. Dann ging das braune Packpapier auf, und zum Vorschein kamen fünf oder sechs Bilder, Gemälde, auf – o Gott! – schwarzem Samt, mit vergoldeten Stuckrahmen. Mit ausgestreckten Armen führte er mir eins nach dem anderen vor. Auf allen waren historische Bauten von Rom zu sehen, jedes in einem dominierenden Farbton gehalten. Das Kolosseum erstrahlte in fieberhaftem Rot, das Pantheon war malvenfarben, der Konstantinsbogen ein trübes Gelb, der Petersdom rosa wie ein Kuchen. Ich betrachtete sie stirnrunzelnd wie ein Preisrichter.
„Gefallen Ihnen?“, fragte er gebieterisch. Ich war eine Fremde, derartige Dinge sollten mir gefallen, und er hatte sie als Geschenk gebracht, um mir eine Freude zu machen. Pflichtgemäß freute ich mich also; ich brachte es nicht übers Herz, seine Gefühle zu verletzen.
„Sehr hübsch“, sagte ich. Womit ich nicht die Bilder, sondern seine Geste meinte.
„Ja, wie Sie sagen“, sagte er. „Der Sohn von meinem Bruder, er hat ein Genie.“
Schweigend schauten wir beide die Bilder an, die nun nebeneinander auf dem Fenstersims lehnten und wie Autobahnschilder im goldenen Licht der tief stehenden Sonne glühten. Während ich sie anstarrte, begannen sie eine gewisse schreckliche Energie anzunehmen oder abzugeben, wie die geschlossenen Türen eines Ofens oder einer Gruft.
Es ging ihm nicht schnell genug. „Welches mögen Sie?“ fragte er. „Dieses hier?“
Wie sollte ich wählen, ohne zu wissen, was die Wahl bedeuten würde? Die Sprache war nur ein Problem; da gab es auch noch diese andere Sprache, was man tut und was nicht. Wenn ich ein Bild annahm, musste ich dann seine Geliebte werden? Besaß die Wahl des Bildes irgendeine Bedeutung, war es ein Test?
„Nun ja“, sagte ich zögernd, auf das neonstrahlende Kolosseum deutend …
„Zweihundertfünfzigtausend Lire“, antwortete er prompt. Sofort fühlte ich mich erleichtert: Schlichte Geldtransaktionen hatten nichts Geheimnisvolles an sich, mit ihnen konnte man leicht fertigwerden. Natürlich hat sein Neffe die Bilder überhaupt nicht gemalt, dachte ich. Er musste sie in Rom bei einem Straßenhändler gekauft haben, und nun verkaufte er sie mit Profit weiter.
„Schön“, sagte ich. Ich konnte es mir überhaupt nicht leisten, aber ich hatte nie gelernt zu feilschen und fürchtete sowieso, ihn zu beleidigen. Ich wollte nicht, dass der Strom plötzlich wegblieb. Ich holte mein Portemonnaie.
Nachdem er die Geldscheine gefaltet und eingesteckt hatte, fing er an, die anderen Bilder einzusammeln. „Sie möchten zwei, vielleicht? Geschenk für Familie?“
„Nein danke“, sagte ich. „Das hier ist einfach wunderbar.“
„Ihr Mann, er wird auch bald kommen?“
Ich lächelte und nickte vage. Diese Geschichte hatte ich ihm erzählt, als ich die Wohnung mietete. Ich wollte, dass in der Stadt bekannt wurde, dass ich einen Mann hatte, ich wollte keinen Ärger bekommen.
„Das Bild wird ihm gefallen“, sagte er, als wüsste er es.
Ich wurde nachdenklich. Hatte er mich trotz allem erkannt, trotz der Sonnenbrille, des Handtuchs und des anderen Namens? Er war einigermaßen reich; ganz sicher hatte er es nicht nötig, billige Touristenbilder zu verhökern. Die ganze Sache könnte ein Vorwand sein, aber wofür? Ich hatte das Gefühl, dass in unserer Unterhaltung viel mehr mitgeschwungen hatte, als ich begriff, was nicht ungewöhnlich war. Arthur pflegte zu sagen, ich sei beschränkt.
Als Mr Vitroni sich in sicherer Entfernung vom Balkon befand, nahm ich das Bild mit nach drinnen und suchte einen Platz zum Aufhängen. Es musste der richtige Platz sein: Jahrelang mussten wegen meiner Mutter die wichtigsten Gegenstände in meinem Zimmer im richtigen Verhältnis zueinander stehen, und ob es mir nun gefiel oder nicht, dies würde ein wichtiger Gegenstand werden. Es war sehr rot. Endlich hängte ich es an einen Nagel links neben der Tür. Auf die Art konnte ich ihm wenigstens beim Sitzen den Rücken zudrehen. Meine Angewohnheit, plötzlich und ohne jede Vorwarnung die Möbel umzustellen, ärgerte Arthur. Er verstand nie, warum ich das tat; er war der Meinung, man sollte sich um seine Umgebung nicht kümmern.
Doch Mr Vitroni täuschte sich: Das Bild hätte Arthur nicht gefallen. Es gehörte nicht zu den Dingen, die er mochte, obwohl es zu den Dingen gehörte, von denen er annahm, dass ich sie mochte. Passend, würde er sagen, das Kolosseum in Blutrot auf vulgärem schwarzem Samt, mit einem vergoldeten Rahmen, Lärm und Tumult, tobende Menschenmengen, Tod im Sand, das Grollen, Fauchen, Brüllen wilder Tiere und in den Kulissen weinende Märtyrer, die sich für ihre Opferung bereit machten; und über allem Gefühle, Angst, Wut, Lachen und Weinen, eine Vorstellung, von der die Menge lebt. Dies, so vermutete ich, war seine Ansicht von meinem Innenleben, obwohl er es nie so direkt ausdrückte. Und wo war er inmitten all dieses Aufruhrs? Natürlich in der Mitte der ersten Reihe, reglos dasitzend, kaum mal ein Lächeln, so leicht war er nicht zufriedenzustellen; und von Zeit zu Zeit würde er eine kleine Handbewegung machen, die Leben oder Tod bedeutete: Daumen nach oben oder Daumen nach unten. Jetzt musst du dir deine eigene Show vorführen, dachte ich, deine eigenen Gefühle haben. Ich habe dieses Spiel satt, mir ist das Blut zu echt geworden.
Jetzt war ich wütend auf ihn, und außer den Tellern, die Mr Vitroni gehörten, gab es nichts zu werfen und niemanden zu bewerfen, außer Mr Vitroni selbst, der sich mittlerweile sicher den Hügel hinaufschleppte, etwas außer Atem wegen seiner kurzen Beine und dem kleinen Kugelbauch. Was würde er wohl denken, wenn ich plötzlich wutschnaubend und Teller werfend hinter ihm auftauchte? Er würde die Polizei rufen, sie würden mich einsperren, die Wohnung durchsuchen, sie würden eine Papiertüte voll roter Haare finden, meinen Koffer …
Ich wurde schnell wieder vernünftig. Der Koffer stand unter einer großen unechten Barockkiste mit Schubladen aus Rindenfurnier und einem Muster aus eingelegten Seemuscheln. Ich zog ihn hervor und öffnete ihn; darinnen lagen in einer grünen Plastiktüte meine nassen Kleider. Sie rochen nach meinem Tod, nach dem Ontariosee, vergossenem Öl, toten Möwen, gestrandeten und faulenden winzigen Silberfischen. Jeans und ein marineblaues T-Shirt, mein Begräbniskostüm, mein früheres Ich, feucht und zusammengeknüllt, aus dem die vielfarbigen Seelen geflüchtet waren. In Terremoto konnte ich solche Kleidungsstücke nie tragen, auch wenn sie nicht verdächtig gewesen wären. Ich dachte daran, sie in den Abfall zu werfen, aber ich wusste von früher, dass die Kinder die Mülltonnen durchwühlten, besonders die der Ausländer. Auf der vielbefahrenen Straße nach Terremoto hatte es keine Möglichkeit gegeben, sie wegzuwerfen. Ich hätte sie auf dem Flughafen von Toronto oder auf dem von Rom loswerden sollen, aber weggeworfene Kleider am Flughafen waren verdächtig.
Obwohl die Dämmerung schon hereingebrochen war, konnte man immer noch genug sehen. Ich beschloss, sie zu vergraben. Ich knüllte den Plastikbeutel zusammen und schob ihn unter den Arm. Die Kleider gehörten mir, ich hatte nichts Unrechtes getan, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, einen Körper verschwinden zu lassen, die Leiche von jemandem, den ich umgebracht hatte. Ich rutschte den Pfad neben dem Haus hinunter, meine lederbesohlten Sandalen schlitterten über die Steine, bis ich schließlich unten zwischen den Artischocken landete. Der Boden war granithart, und ich hatte keine Schaufel; es war aussichtslos, ein Loch zu graben. Außerdem würde es der alte Mann merken, wenn ich seinen Garten in Unordnung brachte.
Ich untersuchte die Grundmauern des Hauses. Zum Glück war es schlampig gebaut, und der Zement zeigte kräftige Risse. Ich entdeckte eine lose Platte und zerrte sie unter Zuhilfenahme eines flachen Steines heraus. Unter dem Zement war bloße Erde: Das Haus war direkt in den Hügel hineingebaut worden. Ich buddelte eine kleine Höhle, rollte die Plastiktüte so fest zusammen wie möglich und drückte sie hinein. Dann deckte ich die Zementplatte wieder darüber. In Hunderten von Jahren würde vielleicht jemand meine Jeans und mein T-Shirt ausgraben und ein längst vergessenes Ritual, einen Kindsmord oder ein schützendes Grab vermuten. Die Vorstellung gefiel mir. Die heruntergefallene Erde verteilte ich mit dem Fuß, damit sie niemandem auffallen konnte.
Erleichtert kletterte ich wieder zurück auf meinen Balkon. Jetzt brauchte ich nur noch mein Haar zu färben, und alle offensichtlichen Hinweise auf meine Identität wären verschwunden. Ich konnte anfangen, ein anderer Mensch zu sein, ein ganz und gar anderer Mensch.
Ich ging in die Küche und verbrannte das restliche Haar. Dann holte ich die Flasche Cinzano hervor, die ich im Schrank hinter den Tellern versteckt hatte. Hier brauchte nicht jeder zu denken, ich sei eine heimliche Trinkerin. Was außerdem auch nicht zutraf, es gab nur keinen Ort, wo ich es in aller Öffentlichkeit tun konnte. Hier schickte es sich nicht, dass Frauen allein in Bars tranken. Ich schenkte mir ein kleines Glas ein und prostete mir selbst zu. „Auf das Leben“, sagte ich. Danach beunruhigte es mich, dass ich laut gesprochen hatte. Ich wollte nicht damit anfangen, Selbstgespräche zu führen.
Die Ameisen hatten den Spinat, den ich tags zuvor gekauft hatte, erobert. Sie hausten draußen in der Mauer, und Spinat und Fleisch waren die einzigen Sachen, hinter denen sie her waren. Alles andere ignorierten sie, wenn man ihnen ein Schälchen mit Zuckerwasser hinstellte. Das hatte ich schon getan, und sie hatten es entdeckt. Jetzt marschierten sie zwischen dem Zuckerwasser und ihrem Nest hin und her, auf dem Hinweg mager, auf dem Rückweg vollgefressen, nachdem sie sich wie kleine Miniaturtanker aufgefüllt hatten. Im Kreis umlagerten sie den Wasserrand; einige hatten sich zu weit vorgewagt und waren ertrunken.
Ich gönnte mir noch einen Drink, dann stippte ich meinen Finger ins Schälchen und schrieb mit Zuckerwasser meine Initialen aufs Fensterbrett. Ich sah zu, wie die Ameisen allmählich die Buchstaben meines Namens formten: eine lebende Legende.
3
Als ich am nächsten Morgen erwachte, war meine Euphorie vergangen. Ich hatte keinen echten Kater, aber nach plötzlichem Aufstehen war mir auch nicht zumute. Die Cinzano-Flasche stand auf dem Tisch, leer; merkwürdig, ich konnte mich nicht daran erinnern, sie ausgetrunken zu haben. Arthur hatte mich oft genug ermahnt, nicht so viel zu trinken. Er selbst trank kaum, aber er hatte so eine Angewohnheit, von Zeit zu Zeit eine Flasche mit nach Hause zu bringen und sie offen herumstehen zu lassen, damit ich sie sehen konnte. Ich glaube, ich war so etwas wie ein Spielzeug-Chemiekasten für ihn: Insgeheim liebte er es, mit mir herumzuexperimentieren, er wusste genau, dass irgendetwas Aufregendes passieren würde. Obwohl er nie sicher war, was das sein würde oder was er überhaupt erwartete; hätte ich das damals schon gewusst, wäre es leichter gewesen.
Draußen nieselte es, und ich hatte keinen Regenmantel. Ich hätte in Rom einen kaufen können, aber in meiner Erinnerung bestand das Klima aus ewigem Sonnenschein und lauen Nächten. Meinen eigenen Regenmantel oder meinen Schirm oder überhaupt viele meiner persönlichen Habseligkeiten hatte ich nicht mitgebracht, um keine Spuren vom Packen zu hinterlassen. Nun trauerte ich meinem Kleiderschrank nach, meinem gold-roten Sari, meinem bestickten Kaftan, meinem aprikosenfarbenen Samtkleid mit dem gerippten Saum. Doch wo hätte ich sie hier tragen können? Trotzdem lag ich im Bett und sehnte mich nach meinem Fächer aus Pfauenfedern, an dem nur eine einzige Feder fehlte, und nach meiner Abendtasche mit den milchig blauen Perlen, einer echten Antiquität.
Arthur hatte ein merkwürdiges Verhältnis zu meiner Kleidung. Er mochte es nicht, wenn ich Geld dafür ausgab, weil er glaubte, wir könnten es uns nicht leisten. Deshalb behauptete er anfangs, es würde nicht zu meinem Haar passen oder ich würde zu fett darin wirken. Später, als er sich aus masochistischen Gründen für die Frauenemanzipation einsetzte, versuchte er mir klarzumachen, ich sollte mir derartige Kleider nicht wünschen, damit würde ich den Ausbeutern in die Hände arbeiten. Aber es ging noch weiter; er empfand diese Kleider als Affront, als eine Art persönlicher Beleidigung. Gleichzeitig faszinierten sie ihn, wie alle Dinge, die er an mir missbilligte. Ich habe ihn im Verdacht, dass er sie anregend fand und dass ihn das wiederum beunruhigte.
Zum Schluss machte er mich so unsicher, dass es mir schwerfiel, meine langen Kleider in der Öffentlichkeit zu tragen. Stattdessen schloss ich die Schlafzimmertür, hüllte mich in Samt und Seide und kramte alle baumelnden goldenen Ohrringe und Ketten und Armbänder hervor, die ich nur finden konnte. Ich betupfte mich mit Parfüm, zog die Schuhe aus und tanzte vor dem Spiegel, mich langsam mit einem unsichtbaren Partner im Walzertakt drehend. Ein großer Mann in Abendkleidung, mit Operncape und glühenden Augen. Während er mich im Kreis herumschwang (wobei wir ab und zu an den Toilettentisch oder das Bettende stießen), flüsterte er mir zu: „Lass dich von mir entführen. Wir werden zusammen tanzen, immer.“ Es war eine große Versuchung, ungeachtet der Tatsache, dass es ihn in Wirklichkeit nicht gab …
Arthur tanzte nie mit mir, nicht einmal, wenn wir allein waren. Er sagte, er hätte es nie gelernt.
Ich lag im Bett und schaute dem Regen zu. Von irgendwoher aus der Stadt hörte ich ein klagendes Muhen, rau und metallisch, wie von einer eisernen Kuh. Ich war traurig, und in der Wohnung gab es nichts, was mich hätte aufheitern können. „Wohnung“ war das richtige Wort dafür. Auf der Anzeigenseite einer englischen Zeitung hätte „Villa“ gestanden, aber es gab nur zwei Zimmer und eine vollgestopfte Küche. Die Wände waren grob verputzt und ohne Farbe, fleckig und verdreckt vom Sickerwasser. Quer über die Decke liefen Holzbalken – Mr Vitroni muss sie wohl für rustikal und pittoresk gehalten haben –, in denen Tausendfüßler hausten, die manchmal abstürzten, meistens nachts. In den Spalten zwischen Wand und Fußboden gab es mittelgroße Skorpione, gelegentlich auch in der winzigen Badewanne, deren Stich angeblich nicht tödlich sein sollte. Wegen des Regens draußen war es dunkel und kalt, irgendwo tropfte es, und wie in einer Höhle kam das Echo zurück, wahrscheinlich weil die beiden Wohnungen oben immer noch leer standen. Damals hatte über uns eine südamerikanische Familie gewohnt, die bis spät in die Nacht Gitarre spielte, johlend und mit den Füßen stampfend, sodass es Mörtel hagelte. Ich wäre gern hinaufgegangen, um mitzufeiern und ebenfalls mit den Füßen zu stampfen, aber Arthur meinte, es wäre aufdringlich, uns selbst vorzustellen. Er ist in Fredericton, New Brunswick, aufgewachsen.
Ich drehte mich um, und die Matratze pikte mich in den Rücken. Direkt in der Mitte ragte eine Feder heraus; würde ich die Matratze wenden, dann wären es vier Federn, das wusste ich. Es war noch dieselbe Matratze, mit ihren Schluchten und Berggipfeln, voller Hinterlist und unverändert durch das eine Jahr, in dem andere darauf gelegen hatten. Wir hatten uns darauf mit einer Heftigkeit geliebt, die an Motelzimmer erinnerte. Arthur wurde durch die Tausendfüßler stimuliert, die eine Aura von Gefahr verliehen (ein wohlbekanntes Aphrodisiakum, wie die Pestzeiten bezeugen). Außerdem lebte er gern aus dem Koffer. Anscheinend fühlte er sich so wie ein politischer Flüchtling, wahrscheinlich eine seiner Fantasievorstellungen, obwohl er nie ein Wort darüber verlor.
Zusätzlich konnte er sich einbilden, wir führen irgendwohin, irgendwo, wo es besser war. Tatsächlich hielt er jeden neuen Ort, an den wir zogen, für besser, zumindest für eine Weile. Danach empfand er ihn lediglich als anders, und anschließend war es dann so wie immer. Aber er schätzte die Illusion von Übergang höher ein als die Illusion von Dauerhaftigkeit, und unsere gesamte Ehe spielte sich in einer Art geistigem Bahnhof ab. Vielleicht lag es daran, wie wir uns kennengelernt hatten. Weil wir mit Auf-Wiedersehen-Sagen anfingen, gewöhnten wir uns daran. Auch wenn er bloß wegen eines Päckchens Zigaretten um die Ecke ging, starrte ich ihm nach, als würde ich ihn nie wiedersehen. Und jetzt würde ich ihn nie wiedersehen.
Ich brach in Tränen aus und zog mir das Kissen über den Kopf. Dann entschied ich, dass es so nicht weitergehen konnte. Ich konnte nicht zulassen, dass Arthur auch jetzt noch mein Leben kontrollierte, besonders nicht auf so eine Entfernung. Ich war nun jemand anderes, ich war fast jemand anderes. Oft sagten die Leute zu mir: „Sie sehen ganz anders aus als auf Fotos“, und das stimmte; mit einigen kleinen Veränderungen musste es möglich sein, auf der Straße an ihm vorbeizugehen, ohne dass er mich erkannte. Ich strampelte die Bettdecke weg – Mr Vitronis Bettdecke, dünn und sorgfältig gestopft –, ging ins Badezimmer, ließ, um mir das Gesicht zu kühlen, kaltes Wasser über einen Waschlappen laufen und entdeckte erst in letzter Sekunde den kleinen braunen Skorpion, der sich in den Falten versteckt hatte. Man gewöhnte sich nur schwer an diese Art von Hinterhalt. Wäre Arthur da gewesen, ich hätte geschrien. So warf ich nur den Waschlappen auf den Boden und zerquetschte den Skorpion mit dem Blechboden einer Büchse Reinigungspulver, ebenfalls von Mr Vitroni bereitgestellt. Er hatte reichlich vorgesorgt, was die Mittel zum Sauberhalten der Wohnung anbelangte – Seife, WC-Desinfektion, Scheuerbürsten –, aber zum Kochen standen nur eine Bratpfanne und zwei Töpfe, einer ohne Deckel, zur Verfügung.
Ich taumelte in die Küche und zündete den Gaskocher an. Vor dem Morgenkaffee war mit mir noch nie viel los gewesen. Ich brauchte etwas Warmes im Mund, um mich sicher zu fühlen; hier war es Filterkaffee und Milch aus dem dreieckigen Pappbehälter vom Fenstersims. Es gab keinen Kühlschrank, aber die Milch war noch nicht sauer. Ich musste sie ohnehin kochen, alles musste abgekocht werden.
Mit meiner heißen Tasse setzte ich mich an den Tisch, wodurch ich den Lack mit einem weiteren weißen Ring verzierte, aß eine Packung Zwieback und versuchte, mein Leben zu organisieren. Ein Schritt nach dem anderen, sagte ich mir. Zum Glück hatte ich ein paar Filzstifte mitgebracht; ich würde eine Liste aufstellen. „Haare färben“ schrieb ich ganz oben in Apfelgrün. Ich würde deswegen nach Tivoli oder vielleicht nach Rom fahren, je eher, desto besser. Mit gefärbten Haaren würde mich nichts mehr mit meinem früheren Ich verbinden, abgesehen von meinen Fingerabdrücken. Und niemand würde sich um die Fingerabdrücke einer Frau kümmern, die man offiziell für tot erklärt hatte.
Ich schrieb „Geld“ und unterstrich es zweimal. Geld war wichtig. Einen Monat würde ich auskommen, wenn ich genügsam lebte. Realistisch gesehen würde es zwei Wochen reichen. Das schwarz-samtene Kolosseum hatte ein Loch in meine Kasse gerissen. Ich hatte nicht viel von meinem Bankkonto abheben können, denn das hätte am Tag vor meinem Tod komisch gewirkt. Hätte ich mehr Zeit gehabt, dann wäre etwas über mein anderes Bankkonto zu machen gewesen, das Geschäftskonto. Falls da überhaupt etwas drauf gewesen wäre. Leider überwies ich gewöhnlich das meiste Geld auf mein Privatkonto, sobald es hereinkam. Ich fragte mich, wer wohl das Geld erhalten würde; wahrscheinlich Arthur.
„Postkarte an Sam“ schrieb ich. Die Postkarte hatte ich am Flughafen von Rom bereits gekauft. Ein Bild vom Schiefen Turm von Pisa. Ich malte die vereinbarte Botschaft in grüner Blockschrift: „Verbringe tolle Ferien. Der Petersdom ist wunderbar. Bis bald, alles Liebe, Mitzi und Fred.“
So erfuhr er, dass ich gut angekommen war. Im Falle von Komplikationen hätte ich geschrieben: „Wetter kühl, Fred hat Durchfall. Gott sei gedankt für Enterovioform! Alles Liebe, Mitzi und Fred.“
Ich beschloss, zuerst die Postkarte aufzugeben und mir danach über das Geld und das Haarefärben den Kopf zu zerbrechen. Ich trank meinen Kaffee aus, aß den letzten Zwieback und zog mir das zweite meiner neuen Sackkleider an, weiß mit grauen und mauvefarbenen Rauten. An meinem Nachthemd entdeckte ich eine aufgegangene Naht in Höhe der Schenkel. Wenn es niemanden gab, der mich ansah und diese Nachlässigkeiten bemerkte, würde ich dann schlampig werden? Warum achtest du nicht besser auf dich, sagte eine Stimme, willst du denn gar nichts aus dir machen? „Nadel und Faden“ schrieb ich auf die Liste.
Ich wickelte das Tuch mit den rosa Polypen um den Kopf und setzte meine Sonnenbrille auf. Es regnete zwar nicht mehr, aber der Himmel war immer noch grau; die Sonnenbrille musste merkwürdig wirken, aber das ließ sich nicht ändern. Ich ging über das Kopfsteinpflaster der gewundenen Straße zum Marktplatz hinauf, ein Spießrutenlaufen vorbei an alten Frauen, die Tag für Tag auf den Türschwellen ihrer angriffslustig wirkenden historischen Steinhäuser saßen, ihre verbrauchten ungeheuren Rümpfe wie zur Trauer in schwarze Kleider gezwängt, ihre Beine wie aufgeblasene, in Wolle gehüllte Würste. Es waren dieselben alten Frauen, die mich gestern Nachmittag von oben bis unten gemustert hatten, dieselben, die vor einem Jahr hier gewesen waren und vor zweitausend Jahren. Sie änderten sich nicht.
„Buongiorno“, sagte jede, als ich vorbeiging, und ich nickte ihnen zu, lächelnd und das Wort wiederholend. Sie schienen wegen mir nicht sonderlich neugierig zu sein. Sie wussten bereits, wo ich wohnte, wie mein Auto aussah, dass ich Ausländerin war, und jedes Mal, wenn ich etwas auf dem Markt kaufte, würden sie es ebenfalls erfahren. Was gab es sonst noch über eine Fremde zu wissen? Das Einzige, was sie beunruhigen mochte, war wohl, dass ich allein lebte: Es würde ihnen nicht natürlich vorkommen. Aber mir kam es auch nicht natürlich vor.
Die Post war im vorderen Teil eines dieser muffigen historischen Häuser untergebracht. Die ganze Einrichtung bestand aus einer Bank, einem Schalter und einem Nachrichtenbrett mit ein paar angepinnten Bildern, die wie Steckbriefe aussahen: mürrische Männer, von vorn und von der Seite.
Einige Polizisten, vielleicht waren es auch Soldaten, lehnten in ihren übrig gebliebenen Mussolini-Uniformen am Schalter: hohe Schaftstiefel, Seitenstreifen an der Hose und Weizengarben auf den Taschenklappen. Mir kribbelte das Genick, als ich am Schalter stand und der Frau begreiflich zu machen versuchte, dass ich eine Luftpostmarke wollte. Mir fiel bloß „Par Avion“ ein. Falsche Sprache. Ich flatterte mit den Armen wie mit Flügeln und kam mir blöd vor, aber das kapierte sie. Hinter mir lachten die Polizisten. Todsicher würden sie gleich meinen Pass riechen, der wie geschmolzenes Eisen durch das Leder meiner Tasche glühte, todsicher würden sie ihn verlangen, würden mich befragen, die Behörden alarmieren … Und was würden die Behörden tun?
Die Frau hinter dem Schalter nahm die Karte durch den Schlitz entgegen. Sobald Sam sie bekommen hatte, konnte er mir mitteilen, ob und in welchem Ausmaß wir Erfolg gehabt hatten. Von den glänzenden kleinen Käferaugen der Polizisten verfolgt, ging ich hinaus.
Ein guter Plan, dachte ich; ich war stolz auf mich, wie ich das alles hinbekommen hatte. Plötzlich wünschte ich, Arthur hätte eine Ahnung, wie geschickt ich gewesen war. Er glaubte immer, ich sei zu chaotisch, um meinen Weg durch den Flur und zur Tür hinaus vorzuplanen, geschweige denn aus dem Land. Ich war diejenige, die mit einer sorgfältig aufgestellten Einkaufsliste losraste, wobei die meisten Sachen seinen Vorschlägen entstammten, und dabei meine Handtasche vergaß, deswegen zurückkam, die Autoschlüssel vergaß, endlich losfuhr und die Liste vergaß; oder die mit zwei Dosen Kaviar und einer Schachtel feinster Kekse und einer kleinen Flasche Champagner zurückkehrte und diese Herrlichkeiten damit rechtfertigte, dass sie im Sonderangebot gewesen wären, was, vom ersten Mal abgesehen, immer gelogen war. Ich hätte ihm so gern mitgeteilt, dass ich etwas Kompliziertes und Gefährliches vollbracht hatte, ohne auch nur einen einzigen Fehler zu machen. Immer hatte ich etwas tun wollen, was er bewundern würde.
Der Gedanke an den Kaviar machte mich hungrig. Ich überquerte den Marktplatz und ging in den größten Lebensmittelladen, wo man Dosen und Spaghetti bekam, und kaufte noch eine Schachtel Peek Freans, ein bisschen Käse und Nudeln. Draußen, in der Nähe des Cafés, stand ein alter Gemüsewagen. Das musste die Hupe gewesen sein, die ich vorher gehört hatte. Der Lastwagen wurde von dicken Hausfrauen in baumwollenen Morgenkleidern und mit nackten Beinen umringt, die ihre Einkaufswünsche durcheinanderriefen und mit ihren Papiergeldbündeln wedelten. Der Gemüsemann war jung, mit öliger Mähne; er stand hinten auf dem Wagen, füllte Körbe und scherzte mit den Frauen. Als ich hinüberging, grinste er mir zu und rief etwas, worüber die Frauen lachten und kreischten. Er bot mir Weintrauben an, ließ sie verheißungsvoll hin und her baumeln, aber wegen meines beschränkten Wortschatzes ging ich nicht darauf ein. Stattdessen wandte ich mich dem normalen Gemüsestand zu. Die Sachen waren zwar nicht so frisch, aber der Mann war alt und freundlich, und es reichte, dass ich mit dem Finger deutete.
Beim Metzger kaufte ich zwei teure, hauchdünne Fleischscheiben. Ich wusste, dass sie nach nichts schmecken würden. Sie stammten von einjährigen Tieren, weil niemand es sich leisten konnte, eine Kuh länger grasen zu lassen, und ich hatte nie gelernt, sie ordentlich zuzubereiten; bei mir schmeckten sie immer nach Kunststoff.
Mit meinen Päckchen ging ich wieder den Hügel hinunter. Mein roter Leihwagen von Hertz stand gegenüber dem schmiedeeisernen Tor, durch das man zum Pfad kam. Ich hatte ihn am Flughafen übernommen. Einen Kratzer hatte er schon abbekommen, in einer Straße in Rom, die sich als Einbahnstraße, „senso unico“, erwiesen hatte. Ein paar von den Dorfkindern umlagerten ihn, malten Bilder in die Staubschicht, die ihn bedeckte, schauten fast ängstlich durch die Fenster hinein und fuhren mit der Hand über die Kotflügel. Als sie mich entdeckten, wichen sie vom Auto zurück und steckten flüsternd die Köpfe zusammen.
Ich lächelte ihnen zu und dachte, wie reizend sie aussahen mit ihren runden braunen Augen, hurtig wie die von Eichhörnchen; einige hatten blonde Haare, ein verblüffender Kontrast zu ihrer Olivenhaut, und ich erinnerte mich an Erzählungen, dass die Barbaren vor zehn oder fünfzehn Jahrhunderten hier durchgezogen waren. Aus diesem Grund waren alle Dörfer auf Hügeln erbaut.
„Buongiorno“, sagte ich zu ihnen. Sie kicherten verschämt. Ich bog ins Tor ein und ging mit knirschenden Schritten den Pfad hinunter. Zwei verkümmerte kleine Hennen, in der Farbe von zerfetzter Pappe, trippelten zur Seite. Auf halbem Weg nach unten hielt ich an: Hatte ich die Tür abgeschlossen oder nicht? Obwohl ich allem Anschein nach in Sicherheit war, konnte ich es mir nicht leisten, sorglos oder faul zu werden. Es war irrational, aber ich hatte das Gefühl, dass irgendjemand in der Wohnung war, auf dem Stuhl am Fenster saß und auf mich wartete.




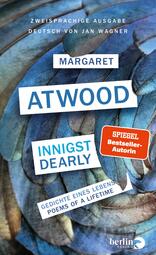
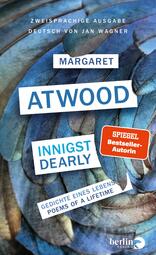








DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.