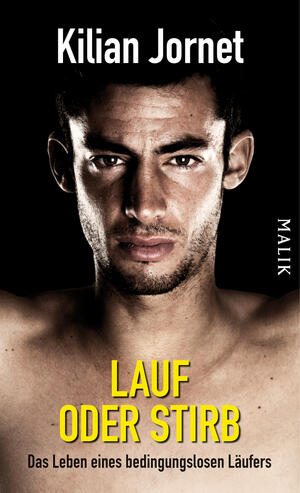
Lauf oder stirb - eBook-Ausgabe
Das Leben eines bedingungslosen Läufers
„Man liest und staunt.“ - Badische Zeitung
Lauf oder stirb — Inhalt
Er wuchs auf 2000 Metern Höhe in einer Berghütte zwischen Andorra und Frankreich auf, stand mit sechs Jahren zum ersten Mal auf einem Viertausender und durchquerte mit zehn die Pyrenäen der Länge nach. Lebendig und offenherzig berichtet Kilian Jornet von seiner beeindruckenden Karriere zum international gefeierten Trailrunningstar: Wir begleiten ihn auf dem ersten 48-Stunden-Lauf, spüren die Atmosphäre beim Ultratrail auf den Mont Blanc und erfahren von seinem unglaublichen Rekord am Kilimandscharo. Der junge Sportler gibt Einblicke in seine Philosophie und erzählt von der Freude, die eigene Leistungsgrenze zu überwinden. Ein inspirierendes Buch für alle, die selbst leidenschaftlich gerne laufen und das besondere Bergabenteuer suchen.
Leseprobe zu „Lauf oder stirb“
Was willst du später mal werden?
„Seezähler. Wenn ich groß bin, möchte ich Seezähler werden!“
Die Lehrerin wandte den Blick von der Tafel ab, auf der sie gerade die Berufe notierte, die die Kinder ihrer Klasse als Erwachsene ergreifen wollten, und sah zu meinem Tisch hinüber.
»Ja, Seezähler. Aber ich will nicht einfach nur zählen, wie viele es sind. Wenn ich über einen Berg gehe und einen See entdecke, messe ich auch, wie tief er ist. Dafür nehme ich einen Stein, binde ihn an einen Faden und werfe ihn mitten ins Wasser. Dann sehe ich nach, wie breit der [...]
Was willst du später mal werden?
„Seezähler. Wenn ich groß bin, möchte ich Seezähler werden!“
Die Lehrerin wandte den Blick von der Tafel ab, auf der sie gerade die Berufe notierte, die die Kinder ihrer Klasse als Erwachsene ergreifen wollten, und sah zu meinem Tisch hinüber.
„Ja, Seezähler. Aber ich will nicht einfach nur zählen, wie viele es sind. Wenn ich über einen Berg gehe und einen See entdecke, messe ich auch, wie tief er ist. Dafür nehme ich einen Stein, binde ihn an einen Faden und werfe ihn mitten ins Wasser. Dann sehe ich nach, wie breit der See ist und woher die Flüsse kommen, die in ihn hineinfließen. Und wohin die gehen, die aus ihm herausfließen. Ich prüfe außerdem, ob es in dem See Fische gibt oder Frösche oder Kaulquappen. Ob sein Wasser sauber ist oder nicht.“
Meine Lehrerin sah mich mit großer Verwunderung an, denn mein Berufswunsch klang so gar nicht nach dem, was fünfjährige Kinder üblicherweise werden wollen. Doch ich blieb dabei. Es war meine Bestimmung.
Wegen dieser Anekdote und weil ich, solange ich denken kann, von sämtlichen Ausflügen mit mindestens einem Stein vom Gipfel oder vom jeweils höchsten Punkt nach Hause zurückkehrte, war ich wohl wie geschaffen dafür, Geograf zu werden. Zumindest wollte ich einen ähnlichen Beruf ergreifen. Die Angewohnheit, Steine in allen Formen und Farben zu sammeln, habe ich im Übrigen bis heute beibehalten: egal, ob Vulkangestein vom Kilimandscharo und aus der katalanischen Garrotxa, Granit aus den Pyrenäen und den Alpen, ockerfarbene Steine aus Marokko und Kappadokien, blaue vom Berg Erciyes oder Platten vom Cerro Plata in Argentinien. Ich fühlte mich dazu berufen, das Erdinnere zu erkunden, auf allen Gipfeln und in allen Höhlen Steine zu suchen, Landschaften zu erforschen und dem Geheimnis auf die Spur zu kommen, wie so komplexe Strukturen wie die Kordilleren mit all ihren Bergen, Tälern und Seen überhaupt entstehen konnten. Und wie all das, ähnlich den Zahnrädern einer Schweizer Uhr, perfekt ineinandergriff, ohne dass irgendetwas oder irgendjemand – nicht einmal die mächtigsten Menschen der Welt – in der Lage wäre, den Lebensrhythmus der Erde aufzuhalten.
Ich glaube, das war einer der seltenen Momente, in denen ich gesagt habe: „Das will ich.“ Eigentlich gehöre ich zu der Sorte Mensch, die lieber vorausschickt: „Ich kann es ja mal versuchen.“ Ich war zurückhaltend und habe stets gedacht, dass sich mit der Zeit alles von allein fügen wird. Und so hat sich nach und nach mein Schicksal herauskristallisiert.
Meine Kindheit verlief normal. Nach der Schule tollte ich allein, mit meiner Schwester oder mit Schulfreunden, die gelegentlich nachmittags vorbeikamen, in der Nähe meines Elternhauses herum. Wir spielten Verstecken oder Fangen, bauten uns Hütten und Burgen und verwandelten unsere Umgebung in Phantasiewelten, die wir aus Comics oder Filmen kannten. Ich gehörte nie zu denen, die sich zu Hause einigeln, und hatte das Glück, mit meinen Eltern in einer Berghütte zu leben, die mein Vater bewirtschaftete. Die Hütte lag auf 2000 Meter Höhe am Nordhang der spanischen Cerdanya – umgeben von den angrenzenden Gipfeln Frankreichs und Andorras. Mein Spielplatz waren weder die Straße noch ein Hinterhof, sondern die Wälder am Cap del Rec sowie die Langlaufloipen und Bergspitzen der Tossa Plana de Lles, der Muga und des Port de Perafita … Dort begann ich, die faszinierende Welt der Natur zu entdecken.
Wenn ich nach der Schule mit meinen Freunden heimkam, ließen wir die Schulranzen einfach im Speiseraum der Hütte stehen und rannten nach draußen, um auf den nächstbesten Felsen zu klettern. Im Sommer turnten wir auch gerne in Bäumen herum, und im Winter fuhren wir mit den Langlaufskiern über schneebedeckte Wiesen.
Jeden Abend vor dem Schlafengehen machten meine Schwester, meine Mutter und ich im Pyjama einen Spaziergang durch den dunklen Wald – ohne Taschenlampe. Wir hielten uns abseits der Wege, und wenn sich unsere Augen nach und nach an die Finsternis und unsere Ohren an die Stille gewöhnt hatten, konnten wir den Wald atmen hören und erkannten zwischen unseren Füßen den Boden. Der Sehsinn wird überschätzt, und sobald man sich nicht mehr auf ihn verlassen kann, fühlt man sich schutz-, ja hilflos den Gefahren der Welt ausgesetzt. Aber mal ehrlich, welche Gefahren lauern denn in einem dunklen Wald in den Pyrenäen? Die einzigen natürlichen Räuber, Wölfe und Bären, sind sehr selten geworden. Und was die anderen Tiere betrifft: Welcher Gefahr setzt man sich schon aus, wenn man einem Fuchs oder einem Hasen begegnet – ist man doch selbst zehn- oder fünfzehnmal größer als sie? Und die Bäume? Man lernt, dem Wind zu lauschen, hört, wie er in den Blättern rauscht, und sieht die Bäume dadurch vor sich. Und der Boden? Unsere Füße sagen uns, ob da Äste sind, Gras, Schlamm oder Wasser; ob es hinauf- oder hinuntergeht oder ob es unwegsam wird.
Mit Herumtollen um die Berghütte und Ausflügen am Wochenende und in den Ferien vergingen die Jahre wie im Flug. Immer wenn wir zwei oder mehr Tage freihatten, nutzten wir die Gelegenheit, um einen neuen Berg zu erkunden. Schon seitdem wir laufen konnten, erklommen wir die Berge in unserer unmittelbaren Umgebung. Doch mit der Zeit suchten wir neue, weiter entfernt liegende Herausforderungen. Mit drei Jahren hatte ich bereits die Gipfel der Tossa Plana, des Perafita und der Muga bestiegen. Was den etwa 3500 Meter hohen Pico de Aneto, den höchsten Berg der Pyrenäen, angeht: Mit sechs war ich darüber schon hinaus und hatte meinen ersten Viertausender bezwungen, das Zermatter Breithorn, und mit zehn die Pyrenäen in zweiundvierzig Tagen durchquert.
Doch niemals liefen wir bei diesen Bergwanderungen einfach nur unseren Eltern hinterher! Sicher, sie führten und lenkten uns zum Gipfel, doch wir mussten uns eigenständig unseren Weg suchen, die Zeichen deuten und verstehen, warum der Weg so verlief und nicht anders. Wir genossen beim Bergsteigen nicht einfach nur das Panorama, sondern der Berg hatte für uns eine tiefere Bedeutung jenseits des bloßen Freizeitabenteuers. Es war ein Terrain voller Leben, das wir erforschen mussten, um darin zurechtzukommen, um die lauernden Gefahren erkennen und voraussehen zu können. Kurzum, wir mussten uns dem Gelände anpassen, in das wir hineingeboren worden waren. Auf diese Weise brachten unsere Eltern uns bei, die Berge zu lieben. Außerdem sorgten sie dafür, dass wir uns als ein Teil davon fühlten. Denn im Grunde genommen ist der Berg wie ein Mensch: Um ihn zu lieben, muss man ihn erst einmal kennenlernen. Und sobald man ihn kennengelernt hat, weiß man, wann er verärgert und wann er zufrieden ist, wie man ihn zu behandeln hat, wie man mit ihm spielt, sich um ihn kümmert, wenn ihm Schaden zugefügt wurde, und wann man ihn besser in Ruhe lässt … Doch verglichen mit den Menschen, sind die Bergwelt, die Natur, die Erde unermesslich viel größer. Wir sollten nie vergessen, dass wir nur ein kleiner Punkt, ein Pünktchen im All, in der Unendlichkeit sind und dass die Natur entscheidet, ob sie diesen Punkt irgendwann auslöschen will oder nicht.
Mit acht unternahm ich einen Ausflug, der sich mir ins Gedächtnis brannte und an den ich häufig beim Laufen zurückdenken muss.
Wir kamen in La Coruña an. Der Zug hielt, und wir stiegen aus. Draußen war es kühl, und obwohl es nicht regnete, hatte man das Gefühl, dass im nächsten Moment die ersten Tropfen fallen würden. Wir holten unsere Räder und stürzten uns ins Abenteuer. Ich fuhr mit dem Mountainbike meiner Mutter. Es war ziemlich neu, und auch wenn ich mit den Füßen kaum an die Pedale kam, war ich wegen der bunten Verkleidung der Speichen vollkommen vernarrt in das Rad. Meine Schwester war damals sieben Jahre alt, und sie hatte ihr Fahrrad schon seit drei Jahren. Es befand sich zwar noch in tadellosem Zustand, aber sie war mittlerweile ein ganzes Stück gewachsen und musste sehr schnell treten, um mit mir mithalten zu können. Meine Mutter fuhr ein altes Rennrad, bei dem die Gangschaltung noch am Rahmen angebracht war. Auf dem Gepäckträger hatte sie einen großen Rucksack festgebunden, in dem sich alles Nötige, auch unsere Schlafsachen, für eine einwöchige Radtour durch Galizien befand.
Wir fuhren Richtung Süden und kamen in unserem eingespielten Rhythmus zügig voran. Ich setzte mich mit dem großen Rad an die Spitze, gefolgt von meiner Schwester, die wie verrückt in die Pedale treten musste. Meine Mutter fuhr ab und zu an uns beiden vorbei und ließ sich dann wieder zurückfallen, um zu kontrollieren, ob auch alles in Ordnung war.
Im feuchtkalten Nebel, der uns im Laufe des Tages bis auf die Haut durchweichte, erreichten wir schließlich Santiago de Compostela. Während einer unserer Pausen studierten wir eine alte Straßenkarte, und meine Mutter meinte zu mir: „Kilian, folge dieser Linie unbedingt immer geradeaus!“ Dabei deutete sie auf die weiße Markierung am Boden. „Auch an allen Kreuzungen, denn irgendwann geht rechts eine Straße ab, verstanden?“
Ich hatte sie genau verstanden und radelte weiter, wobei ich mich ganz auf die teilweise unterbrochene weiße Linie auf der Straße konzentrierte, während meine Mutter mit meiner Schwester in einiger Entfernung folgte. Die ersten Kreuzungen kamen, und bald darauf überholten mich rechts und links Autos und Busse; Lastwagen hupten mich an, und ihre Fahrer beschimpften mich. Doch ich folgte unbeirrt meinen Anweisungen und gab mir Mühe, auf keinen Fall von der weißen Linie abzuweichen. Plötzlich sah ich meine Mutter, das Rad neben sich herschiebend, am äußeren linken Straßenrand entlangrennen. Sie schrie, so laut sie konnte, um mich von der Mitte der Straße herunterzulotsen: „Kilian! Was machst du denn da? Du fährst ja auf dem Mittelstreifen!“
Aus irgendeinem dummen Zufall war ich beim Nachfahren der weißen Linie auf die Überholspur der Zufahrtsstraße nach Santiago geraten. Dabei hatte ich mich doch strikt an die Anweisung gehalten und war keinen Zentimeter abgewichen! Ich schaffte es zu meiner Mutter hinüber, die mich, schweißgebadet vor Anstrengung, erst küsste und anschließend den Platten reparierte, den sie sich bei ihrer Aufholjagd eingefahren hatte.
In den darauffolgenden drei Tagen kämpften wir schwer gegen den heftigen Nordwind an. Auf der kurvigen Strecke entlang der Küste blies er uns mit aller Macht entgegen. Meine Schwester kostete es große Mühe, mit ihrem kleinen Fahrrad die Steigungen zu bewältigen, und so musste meine Mutter auf uns beide ein Auge haben. Auf mich, weil ich dahinsauste, so schnell ich konnte, und auf meine Schwester, weil sie viel langsamer vorankam. An einem Nachmittag schließlich, an dem lediglich eine frische Brise ein paar kleine Wolken vor sich hertrieb, gelangten wir ans Kap Finisterre – gerade rechtzeitig, um einen wunderschönen Sonnenuntergang über dem Meer beobachten zu können.
Doch wir hatten nicht bedacht, dass mit dem Sonnenuntergang auch das Tageslicht schwinden würde. Als wir uns in Bewegung setzten, um wieder zurückzufahren, hatte ich nur im Kopf, was meine Mutter mir gesagt hatte: „Fahr schon mal vor bis zum Campingplatz mit den grünen Schranken und den zwei Fahnen. Ich komme mit Naila nach.“
Ich trat kräftig in die Pedale und legte zügig Kilometer um Kilometer zurück. Zu meiner Rechten verschwanden nach und nach die Strände, und in der Ferne zeichneten sich allmählich die Umrisse der Berge ab. Seltsam, ich dachte, der Campingplatz wäre näher, schoss es mir durch den Kopf, während die Dunkelheit hereinbrach und die Straße immer steiler anstieg. Ich erreichte die Passhöhe und fuhr auf der anderen Seite wieder hinab. Weder vor mir noch zu meiner Rechten konnte ich ein Licht oder ein Hinweisschild zu einem Campingplatz entdecken. Ich wurde immer schneller, denn ich wollte endlich ankommen. Langsam begann ich zu frieren, und müde war ich auch. Nach einer Kurve überholte mich plötzlich ein rotes Auto und blieb vor mir stehen. Daraus stiegen ein kleiner rundlicher Mann aus, der sich vor Lachen ausschüttete, und meine Mutter, die noch immer ihre Fahrradschuhe anhatte.
„Hast du denn den Campingplatz nicht gesehen?“, schimpfte sie.
„Mmm …, nein, da war keiner. Ich habe Strände gesehen und dann Berge“, sagte ich. Das war alles, woran ich mich seit meiner Abfahrt erinnerte.
„Und auf der linken Seite?“, fragte sie und sah mich vollkommen perplex an.
Ich kam mir furchtbar dumm vor. Immerhin hatte ja die fünfzigprozentige Möglichkeit bestanden, dass sich der Campingplatz links von der Straße befand, doch auf diese Idee war ich gar nicht gekommen. Ich musste über mich selbst lachen und stieg in das Auto des Campingplatzbesitzers. Er fuhr uns zu unserem Zelt, in dem meine Schwester schon mit dem Abendessen wartete.
Am nächsten Morgen standen wir zeitig auf, weil wir nachmittags in La Coruña sein wollten. Dort würden wir am Tag darauf ganz früh den Zug zurück nach Puigcerdà nehmen. Um weitere Zwischenfälle zu vermeiden, machten wir uns diesmal gemeinsam auf den Weg, doch beim letzten Anstieg vor der Stadt gab das altgediente Fahrrad meiner Mutter den Geist auf: Kette und Gangschaltung blockierten. Da unser Rucksack schon über zwanzig Kilo wog, hatten wir kein Werkzeug für Reparaturen eingepackt. So mussten wir im nächstgelegenen Dorf ein kleines Geschäft aufsuchen, um Öl zu besorgen.
Nach etlichen Versuchen und einiger Fummelei bekamen wir schließlich die Kette wieder frei, aber das Rad ließ sich nur noch in einem der unteren Gänge fahren. Da meine Mutter bergab unmöglich die Füße auf den Pedalen lassen konnte, wenn sie nicht wie eine Irre strampeln wollte, legte sie die Beine kurzerhand über den Lenker. Meine Schwester und ich blieben hinter ihr, um sicherzu gehen, dass sie keinen Unfall baute.
Die Nacht verbrachten wir in einer preiswerten Unterkunft mitten in der Stadt, von der wir am nächsten Morgen in aller Frühe zum Zug aufbrachen. Auf der Hinreise hatte es sich als schwierig erwiesen, die Räder im Zug mitzunehmen. Deshalb sorgten wir diesmal vor und verpackten sie noch in unserem Hotel. Da wir keine Decken, geschweige denn Kartons zur Verfügung hatten, steckten wir sie einfach in unsere Schlafsäcke. Diese ausgeklügelte Lösung hatte jedoch eine Schwachstelle: Wie sollten wir die Räder zum Bahnhof bekommen? Weder meine Schwester noch ich waren in der Lage, diese sperrigen Bündel, die größer waren als wir selbst, zu tragen. Wir überlegten uns folgendes System: Gemeinsam würden meine Mutter und ich ein Fahrrad bis zur Hälfte des Weges transportieren. Dort würde ich dann auf sie warten, während sie zurückgehen und mit dem zweiten und dritten Fahrrad sowie meiner Schwester Naila nachkäme. Anschließend würden wir auf die gleiche Weise den Rest der Strecke zum Bahnhof zurücklegen.
Unsere Anständigkeit brachte meine Schwester und mich dabei um unser erstes selbst verdientes Geld. Die Fußgänger, die uns neben unseren Schlafsäcken alleine am Boden sitzen sahen – mit erschöpftem Gesichtsausdruck nach der mehrtägigen anstrengenden Radtour und nicht gerade sauberer Kleidung, vor allem wegen der Fahrradreparatur –, waren von unserem Anblick ganz gerührt und wollten uns Geld zustecken, damit wir uns etwas zu essen kaufen könnten. Ungläubig blickten wir die Passanten an. Wie kamen sie bloß auf diese Idee? Gut, wir waren vielleicht ein bisschen dünn, doch wir hatten gerade erst gefrühstückt! Und so lehnten wir selbstverständlich das Geld ab.
Schließlich kamen wir am Bahnhof an, wo der Schaffner uns aufforderte, die Fahrräder wieder aus den Schlafsäcken zu holen und in der Nähe der Türen stehen zu bleiben. Wir mussten also an jeder Station die Räder herumwuchten, um die Leute aussteigen zu lassen. Nach ein paar Stunden hatte eine Schaffnerin endlich Mitleid mit uns, und wir durften unsere Drahtesel in einem Materialwaggon abstellen. So konnten wir bis zu unserer Ankunft schlafen.
Anfänglich waren diese Ausflüge für uns ein Spiel, dann wurden sie zum Hobby und später zum Sport. Gleich nach meiner Einschulung ins Gymnasium nahm ich an ersten Wettkämpfen teil, zudem schrieb ich mich im Hochleistungszentrum für Skibergsteigen ein – als Ventil für meine überschüssige Energie. Ich begann, zu trainieren und an Rennen teilzunehmen, die mich zunächst kreuz und quer durch die Pyrenäen führten und später durch ganz Europa. Die ersten Ergebnisse spornten mich an, noch besser zu werden. Bei meinen Bemühungen unterstützten mich Maite Hernández, Jordi Canals, das gesamte Team des Hochleistungszentrums und nicht zu vergessen meine Mutter, die mich dauernd durch die Gegend fuhr, damit ich morgens vor der Schule noch trainieren konnte. Es sah so aus, als käme meine Sportlerkarriere so richtig in Schwung. Die ganz großen Erfolge standen zwar noch aus, aber in den unteren Kategorien hatte ich schon sämtliche Preise gewonnen.
Doch das Leben legt einem immer wieder Steine in den Weg! Am 22. Dezember 2006, genau einen Tag nachdem ich zum ersten Mal den Skibergsteiger Agustí Roc besiegt hatte, an dessen Leistungen ich mich maß, lief ich von der Fahrschule nach Hause. Und wie so oft sprang ich von einer Straßenseite auf die andere. Doch diesmal stolperte ich dabei über meine eigenen Füße und schlug hart auf dem Boden auf. Ich verspürte einen heftigen Schmerz im linken Knie und in der rechten Hand.
Irgendwie schaffte ich es nach Hause. Dort setzte ich mich aufs Sofa in der Hoffnung, dass die Schwellung allmählich abklingen und der Schmerz nachlassen würde. Doch das Gegenteil geschah. In den frühen Morgenstunden war mein Knie derartig angeschwollen, dass meine Eltern mich – trotz meiner Proteste – ins Krankenhaus brachten.
„Du hast dir die Kniescheibe und den Mittelhandknochen gebrochen“, erklärte mir die Ärztin. Als ich das hörte, brach für mich eine Welt zusammen. „Das Beste wäre, dich so schnell wie möglich zu operieren und dir eine Cerclage, eine Drahtumschlingung, anzulegen. Damit müsste alles wieder in Ordnung kommen.“
Die Entscheidung fiel mir nicht leicht, und in diesem Moment konnte ich einfach nicht klar denken. Sportlich lief es bis zu diesem Zeitpunkt sehr gut, doch mit gerade mal achtzehn Jahren stand ich bereits vor der Frage, wie es nun weitergehen sollte. War meine Karriere etwa schon beendet? Würde ich mich von dieser Verletzung erholen? Sicherlich könnte ich später noch Sport treiben, aber würde ich je wieder an mein jetziges Niveau herankommen, das ich mir so hart erarbeitet hatte? Ich musste es wissen, und zwar so schnell wie möglich. Den Gedanken, ein Jahr ohne Wettbewerbe, Training oder Sport durchstehen zu müssen, konnte ich einfach nicht ertragen. Aber was sollte ich stattdessen tun? All diese Fragen gingen mir durch den Kopf, während man mich am Knie operierte.
Ich musste mich nach Alternativen umsehen. Wenn ich nicht mehr auf höchstem Wettkampfniveau weitermachen konnte, brauchte ich andere Motive und Ziele, für die es sich zu kämpfen lohnte. Die folgenden drei Monate, in denen mein Bein im Gipsverband steckte, nutzte ich deshalb, um mich intensiv mit dem Thema Skibergsteigen zu beschäftigen. Ich las Studien und Fachtests zum Skilanglauf, deren Ergebnisse ich auf meine Sportart übertrug. Und mithilfe von psychologischen Ratgebern bildete ich mich taktisch weiter. Die Nächte verbrachte ich häufig vor dem Computer. Dabei surfte ich auf Internetseiten über Physiologie und sportliche Strategien, denn ich wollte mehr über meinen Körper und seine Funktionsweise in Erfahrung bringen. Auf diese Weise ersparte ich mir schlaflose Nächte, in denen ich mich mit Fragen gequält hätte.
Im März ging ich ins Krankenhaus, um den Gipsverband abnehmen zu lassen. Als ich mein Bein nach der langen Zeit das erste Mal wiedersah, war ich vollkommen entsetzt. Nein, nein, das konnte unmöglich mein Bein sein! Auf gar keinen Fall! Mein Bein war muskulös und kräftig. Kein behaartes Stück Draht! Oder etwa doch? Plötzlich erschien mir alles düster und schwarz. Ich versuchte mich mit dem Gedanken zu trösten, dass ich mir in den letzten drei Monaten zumindest so viel Wissen angeeignet hatte, dass ich auch weiterhin in irgendeiner Weise mit dem Sport zu tun haben würde.
Die ersten Stunden beim Physiotherapeuten waren schrecklich. Ohne Elektrostimulation war ich überhaupt nicht in der Lage, mein Bein anzuwinkeln, und ohne Krücken konnte ich nicht aufrecht stehen. Wie sollte ich jemals wieder laufen können, wenn ich noch nicht einmal stehen konnte? Doch nach und nach machte ich Fortschritte, und mein Bein begann kräftiger zu werden. Eine Woche später kam ich schon ohne Krücken zurecht, und wenn ich mich auf den Beinen halten konnte, würde ich doch wohl auch auf zwei Skiern stehen können, oder etwa nicht? Einen Versuch war es wert. Ich ging also auf einen Skihang und zog zum ersten Mal seit vier Monaten wieder Skistiefel an. Sicher, die Ärzte wären alles andere als erfreut gewesen, wenn sie mich hier auf der Piste gesehen hätten, aber eigentlich stand ich ja nur, und mein Bein hatte in dem Skistiefel guten Halt. Im Prinzip war das doch genauso, als ob ich zu Hause meine Gymnastikübungen machte … Dann begann ich, den Hang hinaufzusteigen, und obwohl ich körperlich in einer jämmerlichen Verfassung war, stellte ich fest, dass es noch klappte und ich vielleicht doch wieder ganz der Alte werden konnte. Ich spürte, wie das Adrenalin durch meine Adern floss. Als ich schließlich den Gipfel erreichte, war ich derart aufgekratzt, als hätte ich gerade die Olympischen Spiele gewonnen. Ich sang, tanzte und schrie, als wäre ich der einzige Mensch auf der Welt. Die anderen Skifahrer um mich herum musterten mich wie einen Verrückten. Wahrscheinlich waren in den vielen Monaten des Nichtstuns tatsächlich etliche Nervenzellen draufgegangen. Auf meinen Adrenalinrausch folgte allerdings die Ernüchterung, und mit ihr kam die Frage aller Fragen: Wie zum Teufel soll ich den Hügel bloß wieder runterkommen?
Vor Begeisterung darüber, endlich wieder auf Skiern zu stehen, hatte ich ganz vergessen, dass ich nach dem Anstieg logischerweise auch die Abfahrt bewältigen musste. Mithilfe eines Freundes, der mich netterweise huckepack nahm, ging es schließlich bergab. Auf halbem Weg stellten wir allerdings fest, dass das keine gute Lösung war, und so fuhr ich den Rest des Wegs auf nur einem Ski. Auf diese Weise belastete ich lediglich das gesunde Bein. Das kranke hielt ich angewinkelt, damit es den Boden nicht berührte.
Von da an hatte ich nur noch ein Ziel: die Ärzte und Physiotherapeuten davon zu überzeugen, dass ich wieder trainieren durfte. Aller Anfang ist jedoch schwer. Als ich meiner Ärztin mit einem breiten Grinsen erzählte, ich sei Ski fahren gewesen und es sei gar nicht mal so schlecht gelaufen, war ihre Reaktion klar und unmissverständlich:
„Ich packe dich wieder in Gips!“
„Nein, nein, nein, bitte nicht! Ich werde alles tun, was nötig ist: Gymnastik, Schwimmen, Physio …, bloß keinen Gipsverband mehr, bitte!“
Als sich herausstellte, dass die Ärzte meinen Vorschlägen alles andere als aufgeschlossen gegenüberstanden, versuchte ich es bei meinem Physiotherapeuten. Dieser sagte mir, wenn ich in der Lage sei, mein Knie um neunzig Grad zu beugen, könne ich mit Übungen auf dem Ergometer beginnen. Zur Vorbereitung sollte ich im Wasser das Gehen üben. Von da an tat ich alles Erdenkliche, um mein Knie wieder anwinkeln zu können: Ich kniete mich hin, um Druck auf das verletzte Bein auszuüben, und ich arbeitete mit immer schwereren Gewichten, um allmählich die Beweglichkeit in dem angeschlagenen Gelenk zu steigern. Nach und nach zeigten sich erste Erfolge. Was das Training im Wasser anbelangt: Einmal bin ich dort gewesen, doch zwischen lauter Rentnern in einem Schwimmbecken auf und ab zu gehen war überhaupt nicht mein Ding, und so kam ich auf die Idee, die Anweisungen des Physiotherapeuten neu zu interpretieren. Er hatte mir geraten, im Wasser zu üben. Nun, in einem Schwimmbecken befindet sich einfach nur Wasser, und Wasser und Schnee sind im Grunde ja das Gleiche, nur in einem anderen Aggregatzustand … Was konnte ich denn dafür, dass die Physik so launisch ist? Also begann ich zu gehen, und zwar durch Schnee und mit Skiern an den Füßen. Auf diese Weise schaffte ich innerhalb von drei Wochen die ersehnten neunzig Grad und durfte mich endlich auf das Ergometer setzen. Da die erste Stunde kein völliges Desaster war, meinte der Physiotherapeut, ich könne zum Trainieren auch nach Puigcerdà fahren und im dortigen Fitnesscenter mit den Übungen fortfahren.
Okay, ich habe es probiert, aber länger als fünfzehn Minuten hielt ich es einfach nicht auf dem Ergometer aus, der die ganze Zeit von einem Fernseher mit Musikvideos beschallt wurde. Ich kam zu dem Schluss, dass neunzig Grad neunzig Grad sind, egal, ob man auf einem Ergometer oder einem normalen Fahrrad sitzt. Ich sah aus dem Fenster. Die Sonne schien, und die Außentemperatur war okay. Also ging ich nach Hause, holte mein Fahrrad und drehte eine Runde. Ich fuhr eine Passstrecke, dann noch eine, und von da an wechselte ich zwischen Ski- und Fahrradtouren ab. Im Grunde tat ich nur, was man mir geraten hatte: Ich bewegte mich im Wasser und fuhr Rad. Allerdings sagte ich, solange mich niemand danach fragte, vorsichtshalber niemandem, was genau ich machte. In Erklärungsnot kam ich erst, als meine Ärztin die Ergebnisse der katalanischen Meisterschaft im Skibergsteigen zu Gesicht bekam …
„Nun, der Austragungsort ist quasi gleich bei mir um die Ecke …, ich bin einfach mal kurz hingegangen, um zu sehen, wie die Stimmung so ist. Und da ich letztes Jahr passabel abgeschnitten hatte, hatten sie eine Startnummer für mich. Ich kann schlecht Nein sagen, und so habe ich sie eben genommen. Ich bin ganz langsam gefahren und hatte auch nicht vor, die komplette Strecke zu bewältigen, doch letztlich war es leichter, das Ganze bis zum Ende durchzuziehen, statt bergauf auf das Auto umzusteigen, denn die Straßen dort sind wirklich in einem schlechten Zustand … Aber abwärts bin ich nur auf einem Bein gefahren. Ich war wirklich vorsichtig und habe mich nicht überanstrengt“, erzählte ich ihr ganz zerknirscht, konnte mir dabei aber ein Grinsen nicht verkneifen.
„Nun, passiert ist passiert“, meinte sie resigniert. „Aber pass gefälligst auf, dass du nicht stürzt, bevor wir dir den Draht wieder aus dem Knie geholt haben.“
Nach diesem Freibrief hielt mich nichts mehr, und ich fing an, wie ein Verrückter zu trainieren. Mit der Zeit kehrte ich zu meiner alten Form zurück, ja, ich wurde sogar noch besser als vor dem unglückseligen Sturz.
Jeder kommt in seinem Leben an einen Punkt, an dem er sich entscheiden muss, welchen Weg er einschlagen will. Und ist die Entscheidung erst einmal gefallen, darf man keinen Gedanken daran verschwenden, was wohl passiert wäre, wenn man eine andere Richtung gewählt hätte. Lieber sollte man in vollen Zügen genießen, was einem das Leben bereithält. Denn wir werden nie erfahren, wo uns die anderen Wege hingebracht hätten – auch wenn wir nachts manchmal aufwachen, weil wir geträumt haben, dort wäre es schöner. In Wirklichkeit gibt es Vollkommenheit nur in unserer Vorstellung. Jeder Weg führt irgendwo anders hin, und es sind erst unsere eigenen Schritte, die uns auf jedem von ihnen mehr oder weniger glückliche Momente bescheren.
Und so musst du von deinem achtzehnten Lebensjahr an Entscheidungen treffen: für einen Lebensweg, für eine Arbeit, eine Karriere, eine Familie, ein Auto, ein Zuhause, ein Bankkonto. Ob du Haustiere willst, welche Tagesdecke, welche Kücheneinrichtung du kaufst, welches Essen du im Kühlschrank hast, welches Geschirr und Besteck du nimmst, welche Fernsehsender du siehst, welchen Handyvertrag du unterschreibst, was du frühstückst, wie du am Sonntagnachmittag die Zeit totschlägst. Du musst dich für eine Zukunft, für ein Leben entscheiden. Doch all das hat mich nicht interessiert. Meine Wahl fiel auf ein Leben, das ganz anders ist.
„Dennoch ist dieses Buch kein Buch über das Laufen, sondern die Biografie eines Lebens, das nicht reich an Jahren, sondern reich an Erfolgen und Erlebnissen ist.“
„Inspirierende Lektüre besonders für hartgesottene Bergläufer.“
„Ein spannend geschriebenes Buch über einen Ausnahme-Läufer, der seine Liebe zum Laufen und zu den Bergen deutlicher nicht hätte formulieren können als er es Tag für Tag macht.“
„Man liest und staunt.“
„(...) es geht um das Eintauchen in die Welt des Ultra-Traillaufes und das Kennenlernen des Menschen Kilian Jornet, der seine eigenen Leistungsgrenzen erbarmungslos auslotet.“
„›Lauf oder stirb‹ ist zuvorderst ein Einblick in das Leben, Denken und Fühlen eines Extremsportlers in extremen Situationen. Kilian Jornet vermittelt sehr glaubhaft und leidenschaftlich seine Liebe zur Natur und zu seinem Sport, der für ihn persönlich gewiss das Lebenselixier ist. Dabei steckt er den Leser durch seine begeisternde Schilderung derart an, dass dieser kaum das Buch zu Ende lesen wird, ohne zuvor nicht mindestens einmal die Laufschuhe geschnürt und selbst genussvoll eine Runde durch die Natur gedreht zu haben.“
„Ein inspirierendes Buch für alle, die gerne laufen und in den Bergen zu Hause sind.“
„›Lauf oder Stirb‹ ist nicht nur für ambitionierte Läufer bereichernde Lektüre.“
„Jornet beschreibt seine Gefühle, wie er manchmal himmelhoch jauchzend bergab fliegt, und ein anderes Mal völlige Leere und Willenlosigkeit verspürt.(...) Auf der Rückseite des Buches steht der Satz ›Laufen ist kein Sport, Laufen ist pure Leidenschaft.‹. Der Wortteil ›Leiden‹ bekommt hier einen ganz besonderen Stellenwert. Gleichzeitig fühlt man sich wohl nie lebendiger.“
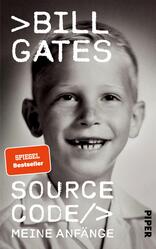
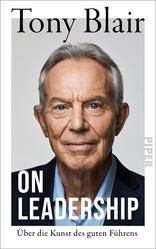

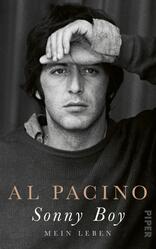



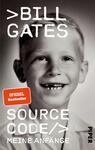


DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.