

Letzter Vorhang für den großen Stefanozzi Letzter Vorhang für den großen Stefanozzi - eBook-Ausgabe
Kriminalroman
— Skurrile Krimi-Komödie um das letzte große Ding„Es ist sehr witzig“ - Gala
Letzter Vorhang für den großen Stefanozzi — Inhalt
Ein irrer Disco-Star, der nochmal das große Ding drehen will – und ein Klatsch-Reporter, der alles in den Sand setzt. Für alle Leser:innen von Karsten Dusse und Fans von schwarzen Komödien wie „Fargo“
„›Für eine Schlagzeile einen ganzen Finger?‹
›Gut, nur die Kuppe.‹
›Madonna.‹“
Der Boulevardreporter Jens „Hoffi“ von Hoffmann und der „Kleine Stefanozzi“, ein abgebrannter Disco-Schlagerstar, wollen noch mal das große Ding drehen. Ihr Ziel: Knaller-Schlagzeilen, die TV-Show „Der Bunker“, Ruhm – Rache! Dabei gerät das Duo zwischen die Fronten eines Bandenkrieges. Am Ende hetzt von Hoffmann durch Berlin, verfolgt von Polizei, Killern und seinen Kollegen. Hoffmanns einzige Chance: Er muss die Wahrheit von Stefanozzis Geheimnis aufdecken. Es geht um enttäuschte Liebe, Verrat, eine Million und den besten Sommerhit aller Zeiten.
Leseprobe zu „Letzter Vorhang für den großen Stefanozzi“
Prolog
„A m’arcord.“
(Italienischer Dialekt für: „Ich erinnere mich.“)
Ich weiß gar nicht, warum ich hier im Dunkeln herumkrieche. Auf allen vieren. Sabbernd und keuchend mit einem Puls im Bebop-Tempo, der mir den Atem abschneidet. Orientierungslos, mit den Sinnen einer alten Schildkröte, die man dazu noch minutenlang in einem Beutel schwindelig geschleudert hat.
Was soll dieses Gekrieche? Es ist ja sinnlos, ich komme aus diesem Loch eh nicht mehr heil raus.
Wo ist meine Brille? Ist sie das, beziehungsweise der Rest von ihr?
Nein.
Herrje, wo ist meine Brille?
[...]
Prolog
„A m’arcord.“
(Italienischer Dialekt für: „Ich erinnere mich.“)
Ich weiß gar nicht, warum ich hier im Dunkeln herumkrieche. Auf allen vieren. Sabbernd und keuchend mit einem Puls im Bebop-Tempo, der mir den Atem abschneidet. Orientierungslos, mit den Sinnen einer alten Schildkröte, die man dazu noch minutenlang in einem Beutel schwindelig geschleudert hat.
Was soll dieses Gekrieche? Es ist ja sinnlos, ich komme aus diesem Loch eh nicht mehr heil raus.
Wo ist meine Brille? Ist sie das, beziehungsweise der Rest von ihr?
Nein.
Herrje, wo ist meine Brille?
Vielleicht krieche ich auch gar nicht. Mein losgetretenes Gehirn schwappt möglicherweise im angeknacksten Schädel hin und her, gaukelt mir irgendwas vor. Vielleicht … Ach egal, es ist alles vollkommen egal.
Kein klarer Gedanke ist zu fassen. Ich taste herum. Fühle aber nur Schmerzen. Mein Körper brennt, als würde er in des Teufels Bratpfanne brutzeln. Ansonsten ist es stockdunkel um mich herum. Finsterste Nacht. Das Ende der Welt. Ich fühle, wie mir irgendwas übers Gesicht läuft. Das muss Blut sein.
Sie haben mich gnadenlos zusammengeschlagen und danach hier unten in den Keller geworfen. Zum Glück habe ich mir nicht in die Hose geschissen. Ein Wunder! Den Unterleib kann man ja im Ernstfall, wenn es hart auf hart kommt, nicht mehr kontrollieren. Und einen solchen Ernstfall habe ich noch nie erlebt, dies ist mein erster.
Ich krieche noch etwas herum, aber dann spüre ich auf einmal: Es ist alles aus. Ich bin verloren. Früher oder später werden sie zurückkommen, mich hochschleifen und wer weiß, was sonst noch alles mit mir anstellen. Ich sehe mich schrecklich deutlich da liegen – ganz tot und kalt.
Ein Schluchzen zittert meine Kehle hinauf. Ich versuche, mich zu kontrollieren, doch ich schaffe es nicht. Hemmungslos heule ich los. Schleim quillt mir zwischen den wackeligen Zähnen und aus der Nase hervor. Die Nase, dieser bröselig-gekokste Knochen! Ausgerechnet die ist bei dem Gekloppe heil geblieben. Und obwohl ich schon seit Jahren nichts mehr richtig rieche, meine ich, den Geruch von modrigem Fell, alter Haut und verrotteten Zähnen in der Luft wahrzunehmen. Sind hier unten Tiere?
Ich schlage mir an den Kopf, damit ich zur Besinnung komme.
Und dann höre ich fern in der Dunkelheit, wie sich jemand gegen die Kellertür wirft. Ein Schlüssel wird im Schloss herumgedreht, Riegel zur Seite geschoben. Ein fahler Lichtschein glimmt zu mir hinab. Ich erkenne die Treppe, die sie mich runtergeschmissen haben.
Oben bewegt sich was.
Sie kommen!
Ich krieche, so schnell ich kann, weg von dem Licht und stoße gegen einen Gegenstand. Was ist das? Fell? Krallen! Ich schaue auf, und in diesem Moment stürzt ein Bär auf mich herab – die Tatzen zum Angriff erhoben, das Maul aufgerissen. Und da ist nicht nur der Bär! Um mich herum sind ein Haufen Tiere. Fauchende Löwen und Tiger, schreiende Affen, tobende Wildschweine, kläffende Doggen.
Das muss der Tod sein.
Ich mache mir in die Hose.
Kapitel 1
Sieben Wochen vorher
Vermittlung, steht auf dem Display des Telefons.
Vermittlung. „Tuuuut.“
Vermittlung. „Tuuuut.“
Setzt der Klingelton ein, verschwinden die schwarzen Stäbchen der Digitalschrift auf der Anzeige. Dann endet das Klingeln, und zack springt das Wörtchen Vermittlung zurück ins Display.
Vermittlung. „Tuuuut.“
Vermittlung. „Tuuuut.“
Immer hin und her. Wie ein Ballwechsel im Tennis.
Vermittlung. Das bedeutet nichts Gutes, sondern in neunundneunzig von hundert Fällen Stress.
Vermittlung. Das sind die Anrufe, die fünfzehn Stockwerke tiefer in der Telefonzentrale des Globus-Gruppe-GmbH-Verlags eingegangen sind und mit denen die Heinis da unten nichts anzufangen wissen. Sie stellen das Ganze nach einem Ich drück mal ’ne Taste-Verfahren in eines der Ressorts hoch. Die Zentrale sollte eigentlich unsere Bastion gegen den Wahnsinn sein, der sich da draußen immer wieder urplötzlich formieren kann. Aber was machen die? Statt alles abzuwimmeln, klicken sie einem die Krawall-Existenzen, die Besserwisser, die Verkaufshuren direkt auf den Schreibtisch.
Menschen kurz vor dem Amoklauf, weil in einem Artikel ein Name oder der Papst falsch geschrieben war. Weil das Kochrezept nicht schmeckte, oder schlimmer, weil die Vorhersagen des Horoskops nicht eintraten. Fans, die nicht verkraften können, dass man ihr Idol kritisierte.
Fans sind sowieso ein gefährlicher Menschenschlag. Die kommen gleich hinter den Fanatikern, weil selbst bei Nichtigkeiten übelst beleidigt und aggressiv.
Oder man hat eine dieser Piepsstimmen-Tussis von den vielen PR-Buden an der Strippe, die versuchen, einem ihr Zeugs aufzuschwatzen. Oder es ist ein Verarsche-Anruf. Oder irgendjemand mit einem IQ im Minusbereich will eine „Hammer-Story“ verkaufen, die sich bereits nach wenigen Sekunden als kompletter Blödsinn entpuppt. Obwohl, zugegeben, manchmal kommt bei diesen Anrufen auch ein sogenannter Knaller raus, eine Geschichte, die für Aufregung und Furore sorgt.
Vermittlung. „Tuuuut.“
Das Tennisspiel auf dem Telefon-Display geht weiter.
Unter dem Schreibtisch ballen sich meine Hände zu Fäusten. Warum stellen die Empfangsdesk-Schergen diese Terror-Anrufe so verdammt gern zu mir hoch? Es gibt doch noch so viele andere! Allein auf dieser Etage der 24/7-Zeitung hockt eine ganze Armada von Schreiberlingen. Die sind so viele, dass ich die meisten gar nicht kenne. Vorn bei den Aufzügen befinden sich das Sekretariat und die gläsernen Büros der Ressortleiter. Dann kommen dicht an dicht die schmalen Tischreihen mit dem Schreiber-Gesocks. Die einfachen Redakteure, Assistenten, Praktikanten, Online-Wusler. Dahinter folgt der Cubicle-Bereich für die Mittelklasse-Tagelöhner. Ein kleines Labyrinth aus brusthohen Bürotrennwänden. Mein sechs Quadratmeter großer Workspace liegt am hinteren Rand, an der Abbruchkante zum Zombieland, wo an den letzten Schreibtischen die Ausgestoßenen und Komplett-Verbrauchten vor sich hin sumpfen.
Vermittlung. „Tuuuut.“
Ich … ich kann nicht ans Telefon. Ich habe mir vorhin ein paar Beruhigungspillen zu viel eingeworfen, weil mein Tinnitus, unter dem ich seit vielen Jahren leide, mal wieder unerträglich in meinen Ohren röhrte. Jetzt kann ich noch weniger sprechen als sonst.
„Tuu…“
Plötzlich ist der Telefonhörer genau vor meinem Gesicht – umschlossen von quittegelben Nikotingriffeln. Eckie Linde steht vor meinem Schreibtisch. Haut mir das Ding fast in die Brille.
„Mann, willst du mich wahnsinnig machen, Hoff?“, ruft er.
Die Frage ist völliger Quatsch, denn Eckie Linde ist bereits wahnsinnig. Die vielen Jahre als Fotograf an der Reporterfront bei 24/7 haben ihn hysterisch wie einen Soldaten nach Tagen im Trommelfeuer gemacht. Er ist ein körperliches Wrack auf Schweißfüßen. Noch sitzt er im Cubicle neben mir, wir haben in vielen Jahren einiges zusammen erlebt, ich mag ihn, doch der Verlag setzt alles daran, Eckie loszuwerden. Drei, vier Auflösungsverträge haben sie ihm schon auf den Tisch gelegt. Bald haben sie ihn weich gekocht. Armer Eckie!
Ich kriege kein Wort raus, schaue nur in dieses zerfurchte Ledergesicht von Eckie, doch er drückt mir gnadenlos den Hörer in die Hand und schmatzt in seinen Sandalen davon. Eckie trägt meistens offenes Schuhwerk, um seine Stinke-Quanten zu lüften. Selbst im Winter nur Canvas-Sneakers.
Beinahe hätte ich das Telefon einfach von mir geworfen, doch jetzt nicht ranzugehen, könnte unklug sein. Unser Verlagshaus lässt gern Testanrufe durchführen, weil man überprüfen will, wie die Mitarbeiter sich im direkten Leserkontakt verhalten. Kundenfreundlichkeit, Service, offenes Ohr und so.
Verflucht!
Ich schaffe es, den Hörer mit meinen zittrigen Händen ans Ohr zu bekommen. „Ffffff …“ Ich will eigentlich 24/7, den Namen unsere Zeitung, sagen, aber ich kann nur zischen. O nein, das geht nicht gut.
„Ist da Herr von Hoffmann? Von 24/7?“ Eine Männerstimme, grau wie der Inhalt eines Aschenbechers, kommt mir entgegen.
„Am Apparat“, kriege ich hin.
Egal, ob es ein Testanruf ist oder nicht, ich muss das Telefonat so schnell wie möglich beenden, dermaßen flattern Sinne und Stimme. Und wenn ich mit einem „Feueralarm!“-Schrei alles hinschmeiße.
„Da will Sie wer sprechen.“
Am anderen Ende wird der Hörer abgelegt. Der Apparat muss sich in einer Kneipe befinden. Ich höre jetzt schwach, aber deutlich genug Musik. Musik, wie sie nur in diesen Absturz-Pinten läuft, wo man eigentlich nicht mehr abstürzen kann, weil man bereits ganz unten ist. Der Gesang ist recht klar zu verstehen: „Ich will mit dir den Wahnsinn spüren, auch das Feuer, das mich verbrennt. Und diese Sehnsucht, die kein Ende nimmt, das Tor zum Paradies öffnet der Wind.“
Mariacron-Altherren-Schunkelgesinge, dünnes Keyboard-Geklimper, schwachbrüstiger Wabbel-Beat: Von welchem der zigtausend Schlager-Volldeppen ist die Nummer noch mal? In Gedanken steige ich hinab in den Keller meines geistigen Musikarchivs. Schreite die endlos langen Ordnerschränke meines Wissens ab.
Wahnsinn spüren?
Sehnsucht ohne Ende?
Tor zum Paradies?
„Hoffi?“, kommt es mir nun dazwischen. Räuspern in der Leitung. Dann Hüsteln, das in drei, vier Ach, wie sag ich’s nur-Kicherstöße übergeht. Jemand anders ist jetzt am Telefon. Ich stolpere aus der Archiv-Gruft zurück ans Licht. „Hastä neue Nummer, te briccone, was? Erkenne er mein Stimmä?“
Ich kann mich zwar schlecht anderen mitteilen, weil in meinem Kopf so ein Chaos herrscht, aber natürlich erkenne ich diese Stimme, da reichen eine Handvoll Worte, obwohl es schon eine Weile her ist, dass ich sie zuletzt gehört habe. Dieser quäkende Tenor, der innerhalb weniger Silben gern die Tonleiter hochtänzelt … unverwechselbar. Früher Dauergast im Radio, im Fernsehen, auf Partys, beim Karneval, auf der Wiesn, bei allen Schlagermusik-Sausen. Unzählige Male hat diese Stimme zu mir in Interviews gesprochen. Mir Irres, Schmutziges, Unglaubliches und unglaublich Witziges erzählt. Diese Stimme und der Mann, in dessen Kehle sie bis heute erstaunlicherweise einigermaßen unbeschadet überleben konnte, haben viele Kampfnamen verpasst bekommen.
Voca d’oro – die goldene Stimme des Südens.
Motore a vapore – die Dampfmaschine.
Der Rambazamba aus Rimini.
Der piccolo Partymacher.
Der Papagallo Knallo.
Oder einfach nur … der kleine Stefanozzi!
„Si, si. Na bitte schön, erkennt er mich, mein Freund! Wusst es doch. Come stai? Bene?“
Ich muss irgendetwas gesagt haben, denn ein Wortschwall Italo-Deutsch-Kauderwelsch, unterbrochen hier und da von Stoßräuspern und Kicher-Hustern, rauscht durch den Hörer in mein Ohr.
„Ich selber auch bene, bene, benissimo“, quasselt es weiter auf mich ein. „Wind und Wetter schlagen an die Felsen von Rimini. Doch der kleine Stefanozzi steht. Steht alles. ALLES! Capisci?“
Der Stefanozzi erwartet für den Bruchteil einer Viertelsekunde wohl wirklich eine Antwort, doch dann palavert er auch schon weiter, so schnell, dass ich nicht mitkomme. Ein paar Namen fallen, die ich nicht kenne, garniert mit Vigliacco-, Imbecille- und Coglione-Flüchen.
Aus den Augenwinkeln sehe ich, dass Bewegung in die Redaktionsetage kommt. Die Morgenkonferenz unseres Entertainment-Ressorts. Ralf Schneider, einer der Chefreporter, stechschreitet an meinem Cubicle vorbei, ohne mich eines Blickes zu würdigen, obwohl wir uns schon seit dreißig Jahren kennen. Na ja, Schneider grüßt nie und niemanden. Mit seinem runden Glatzenschädel und dem Haarkranz aus schulterlangen Locken erinnert er an den teuflischen Clown aus Stephen Kings ES. Mit Schneider ist ebenfalls nicht zu spaßen! Ein Kampfschwein alter Schule. Hinterhältig, egoistisch, eitel. Selbst drei Bandscheiben-OPs haben ihn nicht kleingekriegt.
Eigentlich muss ich ebenfalls zur Morgenkonferenz. Sie findet vorn bei den Glaskasten-Büros an der sogenannten Brücke statt. Doch ich drehe mich zur Seite, beuge mich leicht vor. Wenn jetzt jemand in meinen Cubicle guckt, denkt er, dass ich ein wichtiges Gespräch führe.
Der Stefanozzi hat sich mittlerweile ausgeflucht und kommt zum Punkt. „Und weißt du, deswegen rufe ich dich an. Nur dich, weißt du?! Wir können ja mal wieder was zusammen machen.“
Der Satz „Wir können ja mal wieder was zusammen machen“ fällt meistens, wenn einem ein verzweifelter Prominenter irgendeinen Quatsch andrehen will. Und der Stefanozzi, das ist ein offenes Geheimnis, zählt seit vielen Jahren nicht nur zu den Verzweifelten, sondern zu den hoffnungslos Verdammten.
„Ich komme zurück! Ganze big, big, big. Si, si. Ist noch geheim, weiß keiner.“ Der Stefanozzi presst den Hörer derart gegen seine Lippen, dass die Zähne auf die Muschel schlagen. Er klingt wie ein Agent, der einen Atomraketen-Geheimcode durchgibt. „Grande, big grande segreto. Bist der Erste, mit dem ich rede. Erster! Bist doch mein Vertrauensmann. Meine compagno, si, si!“
„Du bist der Erste (oder sogar: der Einzige), mit dem ich rede.“ Noch so ein Ködersatz. Fast immer gelogen. Leeres Gelaber, Zeitverschwendung, riesiger Bullshit.
Ich bekomme meine Stimme mit einem Husten in Bewegung. „Klingt irre. Aber muss jetzt in eine, äh, Konferenz. Melde mich die Tage.“
Das ist natürlich nicht die Antwort, die ein Verzweifelter wie der Stefanozzi hören will. Nervöses Räuspern. „Nix Tage. Wir müssen uns heute treffen.“
Hört, hört: Der Mann hat das aufgeplusterte Italo-Idiom nun komplett weggelassen. Dann scheint tatsächlich was los zu sein. Nicht, dass es mich wirklich interessiert, mich interessiert kaum noch was, aber so käme ich mal wieder aus dem Büro-Bau raus.
„Wo? Wann?“, frage ich.
Der Stefanozzi gibt mir alles durch. Er hockt in einem Laden in Kreuzberg, der Bei Willi heißt.
Bei Willi? Ach du Schande!
„Ist Beste, wenn du kommst sofort. Subito! Sie sind hinter mir her, Hoffi!“
Kapitel 2
Nachdem ich aufgelegt habe, lehne ich mich in meinen Bürostuhl zurück. In meinem Kopf nörgelt der Tinnitus. Es ist keines der üblichen Ohrgeräusche, das viele Menschen haben. Kein Rauschen, kein Brummen, sondern ein Saxofon, genauer ein Saxofon-Solo des schwarzen Jazz-Gottes Charly Pinker. So ein „Trölötertetttütatatatatatatatata“! Seit neun Jahren ist es mein ständiger Begleiter. Nach einer exzessiven 24-Stunden-Party wollte ich zu Hause mit ein wenig Charly-Bebop entspannen – im Blut einen Cocktail aus Koks, LSD und Muntermacher-Pillen. Dabei bekam ich wohl einen Schwächeanfall, die Ärzte konnten das im Nachhinein auch nicht richtig erklären. Jedenfalls kippte ich vor meiner Stereoanlage aus den Socken, lag drei, vier Stunden bewusstlos in meiner Wohnung, die Kopfhörer mit Volle-Pulle-Pinker auf dem Kopf. Als ich aufwachte, hatte sich Charlys Saxofonspiel in meine Gehörwindungen gefräst. „Trölötertetttütatatatatatatatata!“ Es ist das Solo von Pinker aus seinem Stück Take Five at Six, das seitdem in Dauerschleife durch meine Ohren hallt. Immerhin ein legendäres Solo. Wenn ich nervös und gestresst bin, wird es lauter.
Im Laufe der Jahre habe ich es zumindest geschafft, das Geräusch ein wenig zu kontrollieren, indem ich mich mit Charly Pinker in meinen Gedanken unterhalte. Was eben der Grund ist, warum ich es nicht mehr so drauf habe, mit meinen Mitmenschen zu kommunizieren. Ah, wenn man vom Teufel spricht, da ist er ja höchstselbst.
Guten Morgen, Charly, wie geht es dir? Ja, der Tag ist schon seit ein paar Stunden im Gange, du hast aber nicht viel verpasst. Charly, du wirst nie erraten, wer gerade angerufen hat: der Stefanozzi. Ja, der kleine Stefanozzi, dieser ehemalige Italo-Disco-Held. Hör auf, der Sound von dem war mal sehr erfolgreich, und nicht jeder kann ein Musik-Genie sein wie du. Jeder muss das Beste aus dem machen, was ihm der liebe Gott bei der Geburt mitgegeben hat. Du, Charly, hattest kein Geld, aber eben die Gabe, unglaublich das Saxofon zu blasen.
Ich schaue auf meine Uhr. Ich habe das Gefühl, als hätte ich eine Ewigkeit an der Strippe gehangen, doch die Zeiger stehen erst auf kurz nach zehn. Die Morgenkonferenz unseres Ressorts geht jetzt dem Ende zu, aber es macht keinen Sinn, da noch verspätet hineinzuwackeln, es sei denn, man hat die exklusive Info, dass gleich die Welt untergeht. In wenigen Minuten marschieren unsere Chefs – heute führen Lubischek und Helene Göttiner die Geschäfte – sowie alle anderen Ressortleiter von den anderen Etagen hoch zur Chefredaktion. Nächste Konferenz. Dort wird dann die Strategie für die morgige Printausgabe von 24/7 festgelegt, und was wir den lieben Tag auf 24/7.de und auf den sonstigen Internet-Plattformen anstellen.
Da ich immer noch ein Senior Editor bin, darf ich an der Elefantenrunde teilnehmen, ich mache es aber seit Jahren nicht mehr. Die Sitzung unseres Ressorts ist schon ein einziges Hauen und Stechen, aber da oben geht es zu wie bei einer Horde gereizter Zuchtbullen, die man in einen zu kleinen Stall gesperrt hat. Kein Tag ohne Blut, Schweiß und Tränen.
Am besten hauen wir ab, Charly, bevor Lubischek und Helene Göttiner voller Wut und Rachsucht von diesem Schlachtfeld zurückkehren. Ich bin zwar schon lange nicht mehr in der Position, dass ich mich einfach davonstehlen kann, aber egal. Generell überlebt man in diesem Job nur, wenn man weiß, wann es Zeit ist abzutauchen oder einen Kollegen zu verpfeifen.
Ich versuche, meinen Atem zu beruhigen, was nicht leicht ist, denn im Latexbody, den ich wie jeden Tag unter der schwarzen Anzughose und dem Rollkragenpullover trage, hat sich viel Hitze angesammelt. So ist das mit den Dingern, aber dafür halten sie meinen Körper zusammen und mich aufrecht.
Im Aufbrechen bleibt mein Blick an der Galerie des Wahnsinns hängen, die am Ausgang meines Cubicles ihren Anfang nimmt und sich von dort über einen Trennwand-Ausläufer gut zehn Meter in die Etage hinein erstreckt. Die Galerie des Wahnsinns ist ein Durcheinander aus Zeitungsmeldungen, Magazinschnipseln, Autogrammkarten, Fotos und ausgedruckten Internetsachen. Die skandalösesten und peinlichsten Patzer aus der Promiwelt, über Jahre von den Mitarbeitern unseres Entertainment-Ressorts mit Lust, Wut oder Verzweiflung kreuz und quer mit Nadeln und Klebstoff am Filzbezug befestigt. Wenn man da draufguckt, bleibt man hängen, es ist immer wieder faszinierend, die Härtefälle der Celebrity-Mischpoke auf einem Haufen versammelt zu sehen. All die Hoffnungslosen und Arschlöcher. All die Affen und Alkoholbirnen. Die Betrogenen und Blender. Die Heulsusen, Nervensägen, Aufschneider, Sexsüchtigen, Volloperierten, Halbtoten.
Nur noch eine Handvoll Menschen weiß, wie die Galerie des Wahnsinns einst entstanden ist. Ich war es, der das bunte Ungetüm ins Leben rief.
Ja, Charly, da guckst du! Unfreiwillig, aber ich war’s!
Vor Urzeiten – und ich meine vor Urzeiten – hatte ich in Aufwallung einer Ich mach’s mir heimelig-Regung eine Handvoll Schwarz-Weiß-Fotos der größten Jazzköpfe an meinen Cubicle-Ausgang hingepinnt. Du natürlich Charly, klar. Dazu Miles Davis, Coltrane, Fitzgerald, Ellington … Moment, oder war’s Monk statt Ellington? Sorry, ich kann’s nicht mehr genau sagen, man sieht die Bilder ja nicht mehr.
Ein, zwei Jahre schickten die Götter ihre traurigen, Zigarettenrauch umschlängelten Blicke unbehelligt in die Etage. Doch eines Tages nagelte irgendein Arsch eine Autogrammkarte von Helge Schneider und ein Foto von Paulchen Kuhn (der Klavier-Mann mit den tellergroßen Tränensäcken) zwischen Charly Pinker und Miles in den Filz. Für Amateure sind die zwei natürlich auch irgendwie Jazz. Danach schlichen sich James Last, Rex Gildo, Peter Kraus, Roy Black, Roger Whittaker dazu. Ein paar Wochen weiter Gottlieb Wendehals, Ilja Richter, Johannes Heesters, Guildo Horn, Heino, Moik, Schenk. Spätestens zu diesem Zeitpunkt hätte ich den Mob in die Schranken weisen und die Jammerlappen von der Wand fetzen müssen, aber ich dachte: Ist ein freies Land, genug Platz für alle, leben und leben lassen, solange jeder in seinem Bereich bleibt und es nicht übertreibt.
Ein Fehler. Die Kollegen entdeckten ihre Deko-Leidenschaft, entwickelten immer größeren Spaß daran, Skandalgeschichten aufzuhängen, um sich beim Feierabendbier darüber kaputtzulachen.
Und so ging es lustig weiter.
Als schließlich die Gefahr bestand, dass meine Ikonen mit dem Dreck in Berührung kommen könnten, wollte ich handeln. Doch genau an dem Tag, als ich zum Gegenangriff übergehen wollte, hatte ich meinen Zusammenbruch vor der Stereoanlage und danach den Saxofon-Tinnitus: „Trölötertetttütatatatatatatatata!“
Ich war damals zuerst krankgeschrieben, dann ließ ich mich beurlauben, verbrachte die nächsten Monate abgeschottet in einem Therapiezentrum. Die offizielle Sprachregelung war, dass ich in einem Sabbatical sei, in der Südsee Schildkrötenbabys half, den Weg in den Ozean zu finden. Natürlich wussten alle, was wirklich los war. Infusionen, Entgiftung, Hyperdruckkammer, Hypnose, Geräuschbehandlung, Schläge auf den Hinterkopf: Nichts half, den Trölötertetttütatatatatatatatata-Saxofon-Tinnitus abzuschalten.
Wie lebt es sich eigentlich da oben in meinem Oberstübchen, Charly? Ah, wenn’s um dich geht, hältst du immer schön die Klappe. Na gut.
Zurück zur Galerie des Wahnsinns. Als ich nach den vielen Monaten meines Genesungsversuchs zurück in die Redaktion kam, waren Charly, Miles und Co. unter einer Flut von Gruselpromis verschwunden. Die Galerie des Wahnsinns war geboren, es gab kein Zurück mehr. Alles, was nervte, sich blamierte, sich verunstaltete, sich in unseren Publikationen oder anderswo um Kopf und Kragen laberte, beichtete, soff, vögelte und blitzheiratete, landete hier.
Über die Jahre befiel der Abschaum wie ein Krebsgeschwür die weiteren Cubicle-Wände, ließ die Galerie des Wahnsinns zu einem mehrschichtigen Papierdurcheinander aus Fratzen und Schlagzeilen anschwellen. Irgendwann war alles voll, es passte nichts mehr dran, und mittlerweile pinnt auch kaum noch einer eine irre Headline oder Knaller-Story in die Galerie. Nicht, weil es keine Skandale mehr gibt. Im Gegenteil, es gibt zu viele! Durch das Internet gehen tagtäglich Hunderte von peinlichen Fotos und Storys um die Welt. Popstars, Pornostars, Politikstars, Modelstars, Designerstars, Internetstars, It-Girls, Spielerfrauen: Da werden Skandale im Minutentakt fabriziert! Mit der Masse an Unfällen, die heute an einem Tag passieren, kann man die gesamten Redaktionsräume tapezieren.
Und so steht die Galerie des Wahnsinns heute wie ein ausgestopftes Ungeheuer da, dessen schillernder Körper im Laufe der Zeit ausgetrocknet und vergilbt ist, das sich jedoch niemand traut zu entsorgen. Irgendwann habe ich versucht, in meiner Ecke die Jazz-Fotos wieder freizulegen, doch schnell aufgegeben. Es war einfach alles zu fest zusammengetackert und -geklebt.
Die Jazz-Götter zugenagelt mit Schande. Charly, es tut mir leid.
Mit diesem unangenehmen Früher war alles besser-Gefühl wage ich mich aus meinem Kästchen-Reich hinaus und schreite die Galerie des Wahnsinns ab.
Wo ist der kleine Stefanozzi? Durch die lange Fensterfront scheint die Sonne derart hell über Berlin in unser Büro, dass mir das Gucken schwerfällt. Ich schiebe die Brille zurecht, kneife die Augen zusammen und versuche in dem Sammelsurium aus Buchstaben, Bildern und Fetzen den Überblick zu behalten. Botox-Grinsen, Föhnfrisuren, Vokuhila, Bis-Zum-Bauchnabel-Dekolletés, Kunterbunt-Outfits, schneeweiße Knabberleisten, Daumen-Hoch-Fäuste, Victory-Zeichen, XL-Brüste, XXL-Ärsche und Schampus-Pullen. Viel Schein, wenig Sein.
Bei einigen Promis sind die Stecknadeln in die Augen gerammt worden.
Die älteren Sachen sind bis auf wenige Zipfel zugedeckt von den vielen Reality-TV-Fratzen und ihren Nackt-Selfie-Fotos, die in schöner Regelmäßigkeit an die Öffentlichkeit gehackt werden. Früher die Brigitte Nielsens und Lolo Ferraris. Heute all die Kim Kardashians und Botox-Boys, die auf dem roten Teppich und im Internet ihr Unwesen treiben.
Was ist das für eine Geschichte? Ah, eine Koks-Beichte. Daneben ein Stück Titelseite mit irgendeiner weiteren Sex- und Drogenorgie. Orgien, wir wollen Orgien! Daneben was mit Steuerhinterziehung und eine Knast-Story.
Was gibt’s noch? Alles, Charly!
Betrunkenvideos, Erbstreit, Fremdfummeln, Fremdgehen, Rosenkrieg, Scheidung, missglückte Lippen-OP, Skiunfall, Busenblitzer, Arschgeweih, Entzugsklinik, Kneipenschlägerei, Vaterfreuden mit fünfundachtzig, Suff-Fahrt, Porsche-Crash, offener Sarg …
Früher hatten die Stars noch Fallhöhe, kriegten nebenbei noch die eine oder andere Großtat hin. Heute fabrizieren die meisten bereits reihenweise Patzer beim ersten Boarden ihres Karriere-Flugzeugs – was allerdings auch hilfreich sein kann, um überhaupt zu irgendeiner Art von Karriere abzuheben.
Aber wo ist nun der Stefanozzi? Hier, etwas links von der Mitte, müsste er doch irgendwo sein! Haufenweise Knaller-Storys hat er geliefert. Verrückt, hemmungslos, bis zum Schnauzer voll mit Testosteron, Gier und Disco-Hits.
Aber nichts. Kann doch nicht sein! Wo ist der Stefanozzi? Ich gehe weiter. Suche. Sehe irgendwas mit Arnold Schwarzenegger, Michael Jackson, Siegfried und Roy.
Als meine Augen schon spastische Zuckungen erleiden, werde ich endlich fündig: eine Stefanozzi-Autogrammkarte! Zerfleddert, aber der Meister im unberührten Glanz, klein und kugelig, wie er nun mal ist, dafür um Größe und Breite bemüht, mit Breitwand-Jacketkronen-Grinsen und weit ausgebreiteten Armen, als wollte er zum Singen ansetzen oder „Schätzchen, ich kann nun mal nicht anders“ sagen – eher wohl das Letzte. In der einen Hand ein goldenes Mikro im Fifties-Look. Posiert vor einer violetten Wand, über die eine gelbe Neonröhre in Form eines … na ja … eines Blitzes zischt.
Der Stefanozzi trägt das Outfit, mit dem man ihn heute noch kennt, den Rambazamba Rimini-Style. Dunkle Jacke mit viel Glitzerzeugs drauf, eine Mischung aus Anzug-Jackett und Blouson. Oben mit Schulterpolstern, an der Wampe tailliert, ein Versuch, die Kugel ins Sportlich-Eckige zu pressen. Das Revers ist mit schmalen Längsstreifen überzogen. Grün, Weiß, Rot: die italienischen Farben! Der berühmte, knallrote Si!-Button – an der Stelle, wo eigentlich die Brusttasche wäre. Aus dem tiefen V-Ausschnitt der Jacke kräuseln sich pechschwarze Haare, in deren Gewirr ein Bling-Bling-Anhänger versinkt. Der kurzbeinige Unterbau steckt in irgendetwas Schwarzem und Slippers, völlig egal halt, der Stefanozzi war und ist Brust und vor allem Fresse. Eine Visage, die ohne Hals auf dem Kugel-Oberkörper gepflanzt wurde.
Und was für eine Fresse! Als hätte ein Karikaturist sie im Koks-Wahn hingestrichelt und dabei versucht, Danny DeVito, Drafi Deutscher und Rudolph Moshammer in eine Gestalt zu stopfen. Mächtiger schwarzer Schnauzer, in den sich eine Hakennase hineinverneigt. Breites Kinn, Unterbiss – die obere Keramikpracht kann die untere Zahn-Turm-Reihe gerade so zurückhalten. Auf dem Nasenbuckel eine verspiegelte Sonnenbrille, die links und rechts ein gutes Stück über das Gesicht hinausragt. Darüber schwarze Augenbrauen-Balken und eine leicht eierförmige Stirn, die sich aus dem ausladenden Unterkieferfundament nach oben zieht. Am Vorderkopf keine Haare, aber hinten züngeln Minipli-Locken wie Flämmchen um die Birne. Dazu ein rundes Hütchen, so ein Ding, wie es die Mafiosi im Film oft tragen.
Diese Brille! Oft habe ich mich gefragt, wie das Gestell auf der platten Nase des Stefanozzi Halt findet. Neben all den anderen Dingen, über die man sich beim Stefanozzi wundert. Zum Beispiel, wie dieser Kerl all das Marschierpulver an der krummen Nasenscheidewand vorbei in den Hirnkasten hochziehen konnte. Warum der Stefanozzi überhaupt noch unter den Lebenden weilt.
Es gibt nur zwei Personen, die fast jeder in Deutschland sofort erkennt. Thomas Gottschalk. Und den kleinen Stefanozzi. Und Helene Fischer! Na gut, drei Personen …
„Sind Sie gerade im Fantasialand, Hoff? Abhängen in der guten, alten Zeit?“
Ich drehe mich um. Hinter mir hat sich Lubischek aufgebaut. Unsere Morgenkonferenz ist vorüber, und er will die wenigen Minuten nutzen, bis er hoch zur Metzelei muss, um mir noch einen zu verpassen. „Schön, dass Sie sich noch dazu entschlossen haben, am Leben teilzunehmen“, sagt er. „Wo waren Sie bei unserer Konferenz? Ich habe Sie nicht gesehen.“
Ich versuche, Lubischeks süffisant-ätzenden Ton mit der Taktik an mir abprallen zu lassen, indem ich es als saloppes Kumpel-Sprech abtue. Was es natürlich nicht ist. Der Mann ist zusätzlich zu seinem Ressortleiter-Posten auch Mitglied der Chefredaktion, und er hasst mich abgrundtief.
„Wichtiges Gespräch.“
Lubischek blitzt mich verächtlich an. „Mit wem? Ihrem Dealer?“
Lubischek weiß genau, wo bei mir der Hammer hängt, dass ich polytoxikoman bin und meine Birne erheblich entgleist ist. Er war ja selbst mal nah am Abgrund, wäre beinahe im Suff untergegangen. Nun ist er die Disziplin in Person, trägt Hosenträger und liebt es, mir meine Sucht unter die krustige Nase zu reiben. Früher habe ich gekontert, aber seit ein paar Jahren bin ich zu durcheinander dafür. Also lasse ich ihn seine Sätze raushauen, ziehe in solchen Momenten mein Putztuch hervor und poliere meine Brille. Das reicht, um ihn vollkommen fuchsig zu machen.
„Wenn Sie sich beim nächsten Mal entschließen, der Konferenz nicht beizuwohnen, wäre ich Ihnen sehr, sehr verbunden, wenn Sie sich vorher abmelden, Hoff.“
Eigentlich heiße ich von Hoffmann. Jens von Hoffmann. Die meisten nennen mich allerdings „Hoff“ oder „Hoffi“. Ist auch in Ordnung. Das „von“ bedeutet mir nicht wirklich viel. Aber keiner schafft es, dieses Wort mit so viel Spott auszusprechen, wie Lubischek.
In Gedanken zeige ich ihm meinen ausgestreckten Mittelfinger. Und höre mich sagen: „Ich bin da an einer, äh, Story dran.“
„An einer Story sind Sie dran? Wollen Sie Ihren Chef mal aufklären, an was für einer?“ Lubischek greift mit beiden Händen an die Hosenträger.
„Ist … noch nicht spruchreif.“
„Noch nicht spruchreif, aha.“ Lubischek liebt es, die Worte seines Gesprächspartners zu wiederholen und einen damit lächerlich zu machen. „Mann, Mann, Hoff. Klingt ja nach einer irre aufregenden Sache.“
Ich schaue Lubischek an. Ohne die Brille bleibt sein Gesicht ein verschwommenes Etwas, in dem sein hasserfüllter Blick absäuft.
Ja, denke ich, irre wird’s wohl. Was sonst bei so einem wie dem Stefanozzi.
Ich setze die Brille wieder auf. Lubischeks Hass nun scharf, live und in Farbe. „Eine, ja, heiße Sache. Deswegen muss ich, also … Ich muss mal los.“
„Es ist sehr witzig“
„Sind Sie stark genug für dieses völlig verrückte Buch? (…) Die Story ist so verrückt wie Jens von Hoffmann, gennant ›Hoff‹, die Hauptfigur des Krimis. (…) Ach, lesen Sie’s einfach selbst! Starke Nerven sollten Sie allerdings haben.“
„Gute Lektüre. Es geht um einen alternden Italo-Disco-Star sowie den Klatschreporter Jens ›Hoffi‹ von Hoffmann, die ihrem späten Ruhm hinterhertragen und in einen Bandenkrieg geraten. Die skurrile Krimikomödie erscheint am 1. August im Piper-Verlag.“





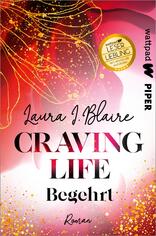




DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.